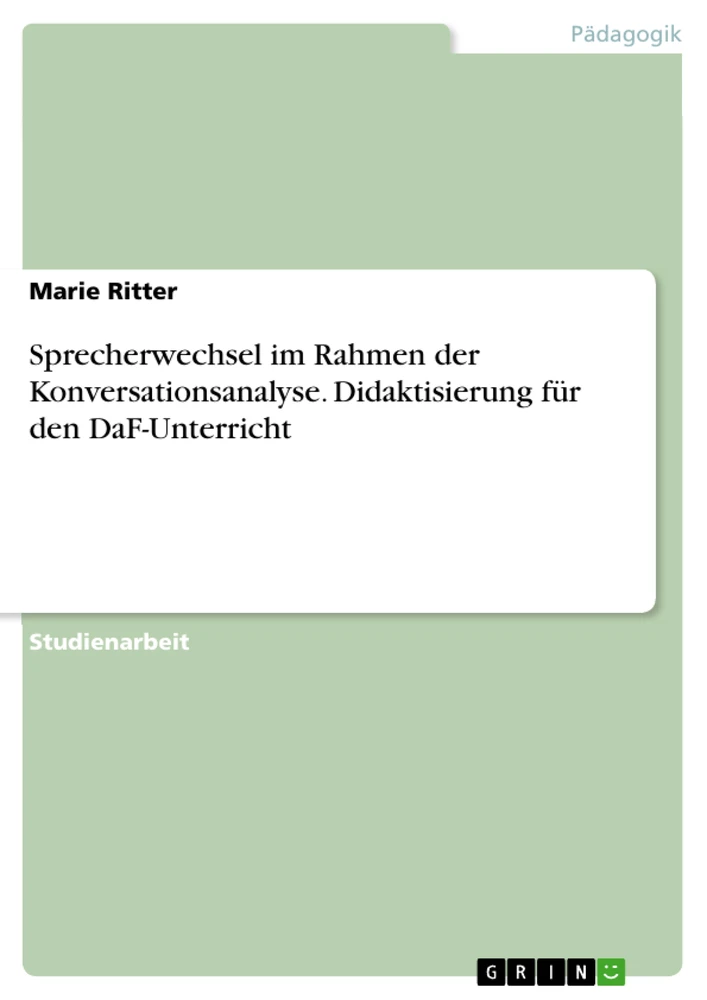Die Bedeutung der mündlichen Kommunikation im Deutschunterricht für Deutschlernende aus dem Ausland steht im Fokus dieser Arbeit. Oft erleben Lernende einen "Praxisschock", wenn sie trotz guter Beherrschung des Schriftdeutschen Schwierigkeiten haben, gesprochenes Deutsch zu verstehen. Diese Arbeit soll eine Möglichkeit für den Einsatz von Transkripten im Deutschunterricht darstellen und die Frage beantworten, wie das umsetzbar sein kann. Durch die Einbeziehung von Transkripten authentischer Kommunikation im Unterricht können diese Verständnisprobleme reduziert werden. Im Vergleich zu konstruierten Gesprächen bieten Transkripte einen realistischen Einblick in die deutsche Alltagskommunikation und ermöglichen es, wiederkehrende Gesprächsmerkmale zu erkennen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern ein Phänomen der gesprochenen Sprache im Rahmen des DaF-Unterrichts didaktisiert werden kann. Dafür wird sich diese Arbeit in zwei Bereiche untergliedern. Zunächst wird mithilfe des theoretischen Teils eine Grundlage geschaffen. Diese Grundlage besteht aus der Vorstellung der Konversationsanalyse sowie der Darlegung der notwendigen Begriffe.
Im zweiten, empirischen Teil der Arbeit werden zunächst die Datengrundlage und das verwendete Vor-gehen sowie die konkrete Beschreibung des Unterrichtskontextes vorgestellt, für welchen das Phänomen didaktisiert wurde. Das Phänomen, auf das sich in dieser Arbeit fokussiert wird, ist der Sprecherwechsel.
Der Sprecherwechsel ist eines der prägnantesten Merkmale innerhalb eines mündlichen Gesprächs, wes-halb er auch in dieser Arbeit im Vordergrund steht. An ausgewählten Szenen des Transkripts wird gezeigt, dass sich hinter den scheinbar spontan ablaufenden Prozessen der Sprecherorganisation nachweisbare Regelhaftigkeiten befinden. Nach der Analyse und Auswertung der Daten werden diese vor dem Hintergrund einer möglichen Didaktisierung diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
Da der bereitgestellte Text keinen Inhaltsverzeichnis enthält, kann hier keins erstellt werden.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text zielt darauf ab, Einblicke in das Essverhalten zweier Gesprächspartner zu geben. Die Konversation konzentriert sich auf die Gewohnheiten, Vorlieben und Einstellungen zum Essen, sowohl zu Hause als auch außer Haus. Es wird ein informeller und persönlicher Ansatz gewählt.
- Essgewohnheiten zu Hause und unterwegs
- Vorlieben bezüglich der Art der Mahlzeiten
- Bedeutung von Gesellschaft beim Essen
- Der Aspekt von Bequemlichkeit und Zeitersparnis beim Essen
- Die emotionale Komponente des Essens und das Gefühl von Sättigung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Der Text beginnt mit einer allgemeinen Diskussion über das Essverhalten der beiden Gesprächspartner. S1 berichtet über ein geringes Essverhalten zu Hause, im Gegensatz zu häufigem Essen außer Haus. S2 beschreibt den Konsum von Brot und Tiefkühlkost zu Hause. Die Diskussion berührt die Aspekte von Gesundheit und Bequemlichkeit in Bezug auf die Essenswahl. Das Thema der sozialen Komponente des Essens wird angesprochen, wobei S1 die Vorliebe für gemeinsame Mahlzeiten hervorhebt. Der Unterschied zwischen dem Essverhalten im Alltag und dem im YouTube-Haus wird kurz erwähnt.
Schlüsselwörter
Essverhalten, Essgewohnheiten, Mahlzeiten, Zuhause, Außer Haus, Gesellschaft, Bequemlichkeit, Gesundheit, Sättigung, Vorlieben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse des Essverhaltens
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert das Essverhalten zweier Gesprächspartner. Er beleuchtet deren Gewohnheiten, Vorlieben und Einstellungen zum Essen sowohl zu Hause als auch außer Haus. Der Fokus liegt auf einem informellen und persönlichen Ansatz.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen umfassen die Essgewohnheiten zu Hause und unterwegs, Vorlieben bezüglich der Art der Mahlzeiten, die Bedeutung von Gesellschaft beim Essen, den Aspekt von Bequemlichkeit und Zeitersparnis, sowie die emotionale Komponente des Essens und das Gefühl der Sättigung.
Gibt es ein Inhaltsverzeichnis?
Nein, der bereitgestellte Text enthält kein Inhaltsverzeichnis.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text bietet eine umfassende Vorschau mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, einer Zusammenfassung der Kapitel und einer Liste von Schlüsselbegriffen. Er beginnt mit einer allgemeinen Diskussion über das Essverhalten der beiden Gesprächspartner und beleuchtet deren unterschiedliche Ansätze.
Was wird im ersten Kapitel beschrieben?
Kapitel 1 beschreibt die anfängliche Diskussion über das Essverhalten der beiden Gesprächspartner. Es wird der Unterschied zwischen dem Essen zu Hause und außer Haus beleuchtet, wobei ein Gesprächspartner von geringem häuslichem Essverhalten und häufigem Essen außer Haus berichtet, während der andere Brot und Tiefkühlkost zu Hause konsumiert. Gesundheit, Bequemlichkeit und die soziale Komponente des Essens werden ebenfalls angesprochen. Der Unterschied zwischen dem alltäglichen Essverhalten und dem im YouTube-Haus wird kurz erwähnt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Essverhalten, Essgewohnheiten, Mahlzeiten, Zuhause, Außer Haus, Gesellschaft, Bequemlichkeit, Gesundheit, Sättigung, Vorlieben.
Für welche Art von Anwendung ist diese Textanalyse gedacht?
Die Analyse ist für akademische Zwecke gedacht, insbesondere für die strukturierte und professionelle Analyse von Themen im Text.
- Arbeit zitieren
- Marie Ritter (Autor:in), 2024, Sprecherwechsel im Rahmen der Konversationsanalyse. Didaktisierung für den DaF-Unterricht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1459297