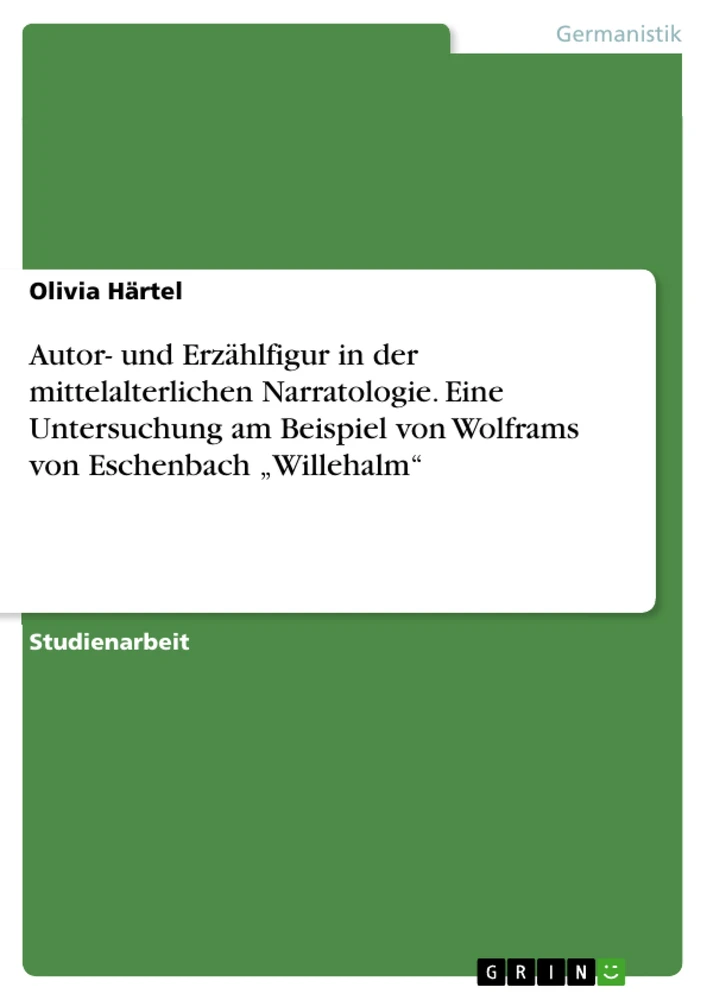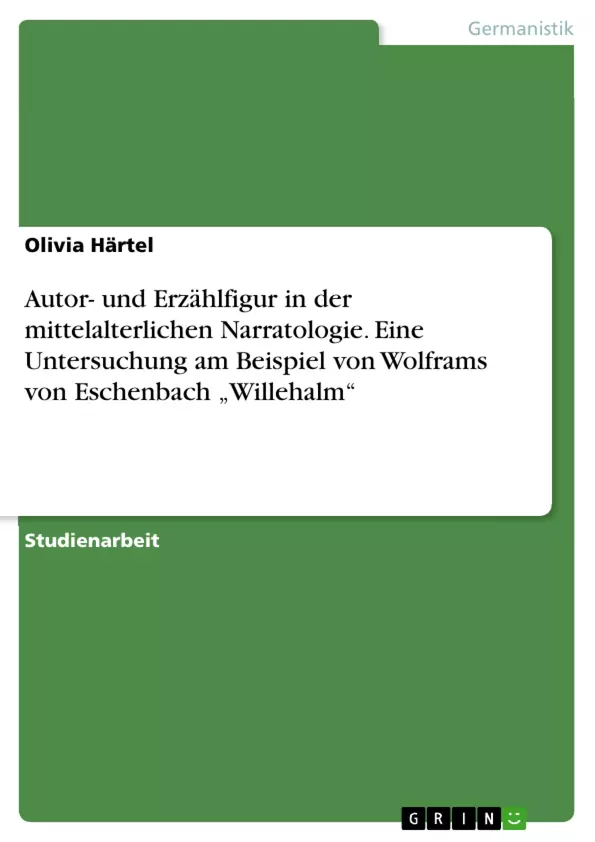Die vorliegende Untersuchung taucht in die mittelalterliche Erzählkunst ein, indem sie die Rollen von Autor*in und Erzähler*in am Beispiel von „Willehalm“ von Wolfram von Eschenbach analysiert. Dabei werden die Grenzen und Verflechtungen zwischen diesen beiden Instanzen sowie ihre Bedeutung für die narrative Gestaltung und die Leserbindung herausgearbeitet. Durch die Differenzierung dieser Rollen und die Betrachtung ihrer Funktionen im Erzählprozess wird ein neues Licht auf die Techniken geworfen, die zur Verstärkung der narrativen Effekte wie Glaubwürdigkeit und Eindringlichkeit genutzt werden.
Die Unterscheidung zwischen dem oder der Autor*in und dem oder der Erzähler*in gehört zu den literaturwissenschaftlichen Grundlagen innerhalb der narrativen Kommunikation und hat bis dato eine Vielzahl an facettenreichen wirkungs- und rezeptionsästhetischen Konzepten – wie par exemple dem des impliziten Autors oder der impliziten Autorin –, aber auch prägenden Debatten – man denke an den durch den poststrukturalistischen Philosophen Roland Barthes adaptieren Tod des Autors oder der Autorin – hervorgerufen. Doch wie verhalten sich jene Terminologien, werden sie nicht etwa auf die zeitgenössischen, sondern mittelalterlichen Erzähltexte angewendet?
Inhaltsverzeichnis
- I. Autor*in, Erzähler*in und die Frage nach der Notwenigkeit ihrer Präsenz innerhalb der mittelalterlichen Narratologie am Beispiel des Willehalm
- II. Autor*in vs. Erzähler*in: eine terminologische Differenzierung
- II.1. Autor*in als Urheber*in?
- II.2. Das Geflecht von Autor*in, Erzähler*in und Rezipienten oder Rezipientin
- III. Exkurs: Autor-, Erzähler- und Vortragsstimme
- IV. Dimensionen des Erzählens in Wolframs von Eschenbach Willehalm
- IV.1. Der Prolog als Mittel zur Herstellung von Glaubwürdigkeit
- IV.2. Die Beeinflussung der Meinungsbildung anhand des Publikumskontaktes
- IV.3. Die Erzeugung von Lebhaftigkeit
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Autor*in und Erzähler*in in mittelalterlichen Erzähltexten, insbesondere am Beispiel von Wolframs von Eschenbach Willehalm. Sie untersucht, ob diese Unterscheidung in der mittelalterlichen Narratologie überhaupt relevant ist und wie sie sich auf die Interpretation des Textes auswirkt.
- Die Rolle des Autors/der Autorin und des Erzählers/der Erzählerin in mittelalterlichen Erzähltexten
- Die Bedeutung des Prologs im Willehalm für die Herstellung von Glaubwürdigkeit
- Die Einbeziehung des Publikums in den Erzählprozess
- Die Frage nach der Relevanz der Unterscheidung zwischen Autor/Autorin und Erzähler/Erzählerin für die Interpretation von mittelalterlichen Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Dieses Kapitel beleuchtet die Unterscheidung zwischen Autor*in und Erzähler*in und deren Relevanz in der mittelalterlichen Narratologie, insbesondere im Kontext von Wolframs Willehalm. Es werden die Schwierigkeiten bei der Anwendung moderner narratologischer Konzepte auf mittelalterliche Texte und die mangelnde Berücksichtigung dieser Thematik in der Mediävistik diskutiert.
Kapitel II: Hier wird die terminologische Differenzierung zwischen Autor*in und Erzähler*in aus moderner Sicht betrachtet. Es wird die Rolle des Autors/der Autorin als Urheber*in des Textes erläutert und die Unterscheidung von fiktiven Sprechern innerhalb des Textes, wie Erzählern und Figuren, sowie dem impliziten Autor/der impliziten Autorin herausgestellt.
Kapitel III: In diesem Exkurs wird der Unterschied zwischen Autor-, Erzähler- und Vortragsstimme anhand von Beispielen aus dem Willehalm-Prolog erläutert. Es wird der Fokus auf die Stimme gelegt, die den Text präsentiert, und wie diese mit der des Autors/der Autorin und des Erzählers/der Erzählerin in Beziehung steht.
Kapitel IV: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Dimensionen des Erzählens im Willehalm, darunter der Prolog als Mittel zur Herstellung von Glaubwürdigkeit, die Beeinflussung der Meinungsbildung durch den Publikumskontakt und die Erzeugung von Lebhaftigkeit. Es werden die Strategien des Erzählers/der Erzählerin, die den Leser/die Leserin zu involvieren und zu fesseln, untersucht.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit zentralen Themen der narrativen Kommunikation im Mittelalter, insbesondere mit der Rolle von Autor*in und Erzähler*in in Wolframs von Eschenbach Willehalm. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind daher: Narratologie, mittelalterliche Literatur, höfisches Erzählen, Autor*in, Erzähler*in, Prolog, Publikumskontakt, Lebhaftigkeit, Willehalm, Wolfram von Eschenbach.
- Arbeit zitieren
- Olivia Härtel (Autor:in), 2022, Autor- und Erzählfigur in der mittelalterlichen Narratologie. Eine Untersuchung am Beispiel von Wolframs von Eschenbach „Willehalm“, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1452265