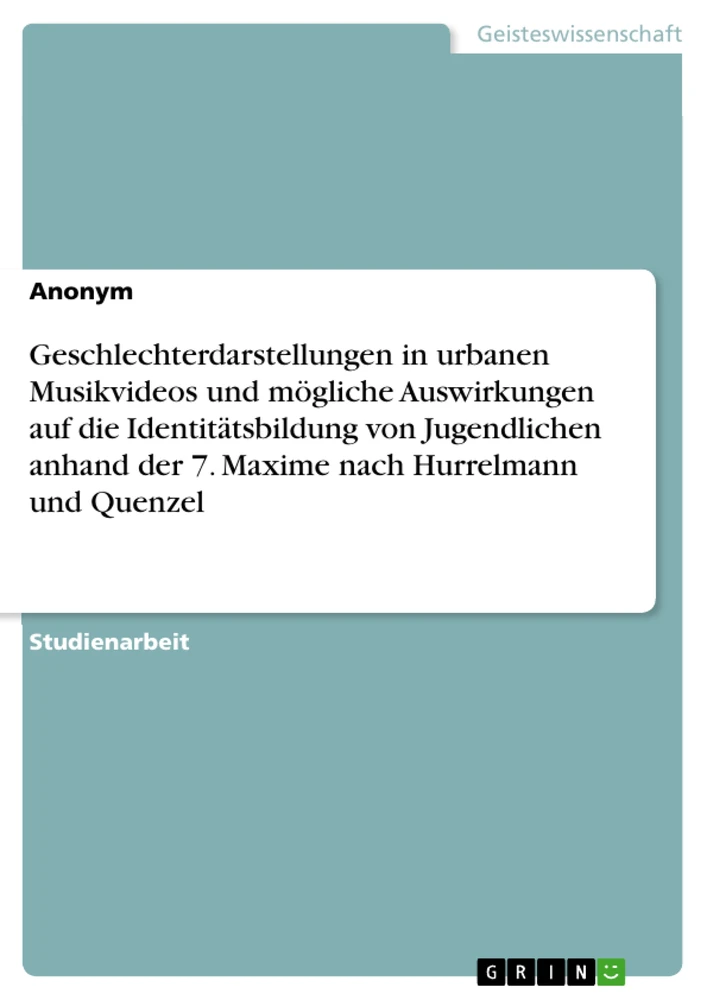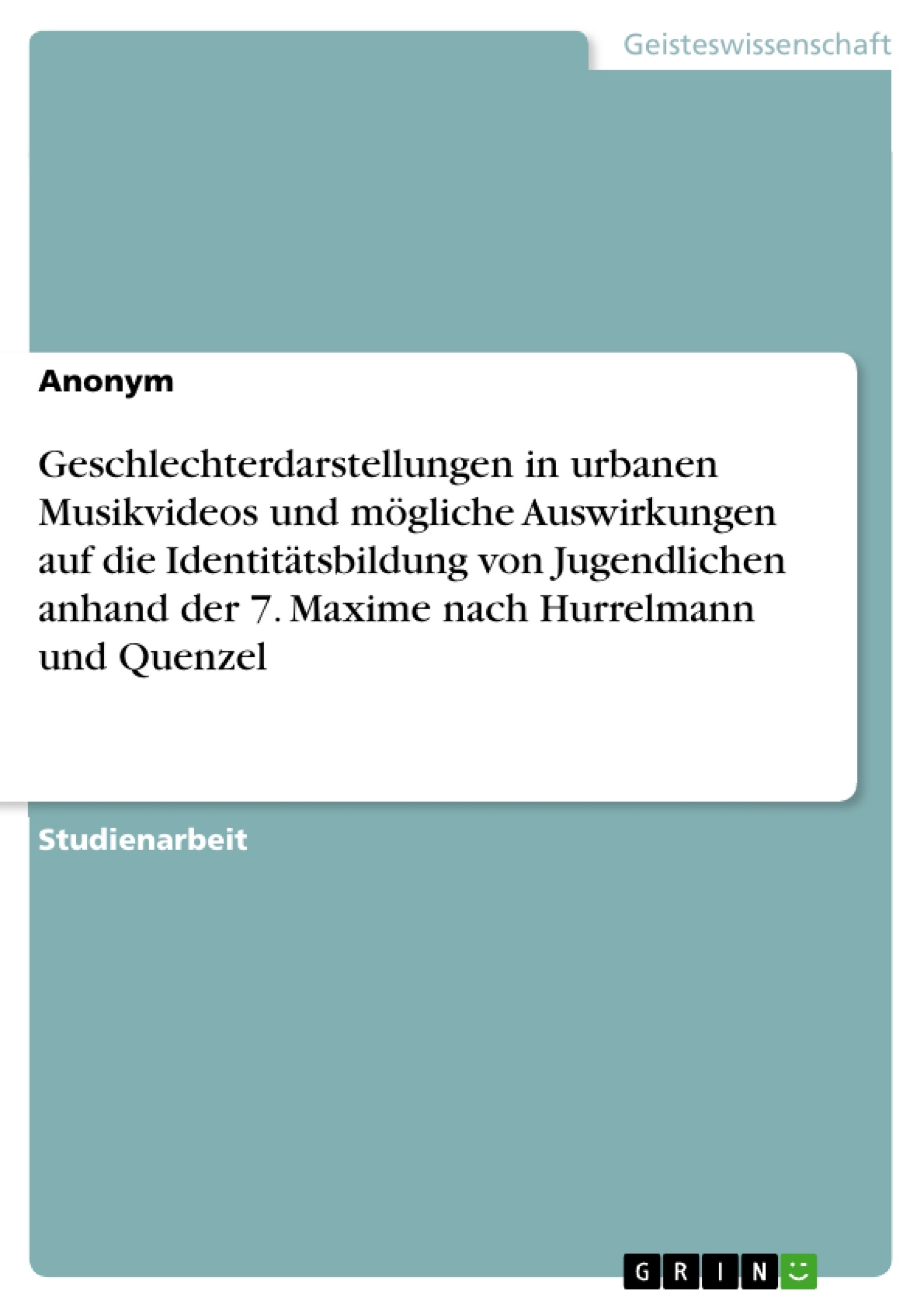In der folgenden Arbeit soll die Darstellung von Frauen und Männern, unter Berücksichtigung des ‚Modells der produktiven Realitätsverarbeitung‘, in Musikvideos der Genres Hip-Hop/Rap, RnB und Pop untersucht werden sowie der potentielle Einfluss auf Jugendliche insbesondere im Hinblick auf die 7. Maxime von Hurrelmann und Quenzel.
Musikvideos sind ein zentrales Medium für Künstler*innen um die Wirkung oder Aussage von Liedern zu verstärken, ein individuelles Image zu schaffen, es zu visualisieren sowie die eigene Kreativität auszuleben. Aber auch für Fans stellen die Produktionen eine wichtige Instanz dar, um ihren Idolen näher zu kommen und die einzelnen Musikstücke noch intensiver wahrzunehmen. Besonders bei Jugendlichen sind Musikvideos ein wichtiger Bestandteil des Medienkonsums, da diese hierdurch Einblicke in vermeintliche Realitäten, abseits des ihnen bekannten näheren Umfeldes, bekommen. Wachsende Beliebtheit in dieser Altersgruppe erlangten in den letzten Jahrzehnten die Genres Hip-Hop/Rap und RnB, welche somit auch großen Einfluss auf die populärste Musikrichtung Pop hatten. Doch vor allem die aus den amerikanischen Armenvierteln stammende Musikrichtung Hip-Hop/Rap steht immer wieder in der Diskussion, da frauenverachtende Texte sowie Gewalt und Kriminalität verherrlichende Inhalte Teil der Musikrichtung sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Musikvideos in Lebenswelten von Jugendlichen
- 3. Geschlechterdarstellung in urbanen Musikvideos
- 3.1 Darstellung von Frauen
- 3.2 Darstellung von Männern
- 4. Auswirkungen auf Jugendliche (im Hinblick auf die 7. Maxime)
- 4.1 Einführung in die Sozialisation, Identitätsbildung und 7. Maxime
- 4.2 Schlussfolgerungen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschlechterdarstellungen in urbanen Musikvideos (Hip-Hop/Rap, RnB, Pop) und deren potenziellen Einfluss auf die Identitätsbildung von Jugendlichen. Im Fokus steht die Analyse im Kontext der 7. Maxime des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung nach Hurrelmann und Quenzel.
- Analyse der Geschlechterdarstellungen in urbanen Musikvideos
- Untersuchung der Relevanz von Musikvideos im Medienkonsum Jugendlicher
- Bewertung des Einflusses der Darstellungen auf die Identitätsbildung
- Anwendung des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung auf die Thematik
- Kontextualisierung der Ergebnisse im Hinblick auf die 7. Maxime von Hurrelmann und Quenzel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Geschlechterdarstellungen in urbanen Musikvideos ein und benennt die Forschungsfrage. Sie betont die Bedeutung von Musikvideos für Jugendliche und ihren Einfluss auf den Sozialisationsprozess, insbesondere im Hinblick auf die Identitätsbildung und die Geschlechterrollenfindung. Die Arbeit fokussiert sich auf die Genres Hip-Hop/Rap, R&B und Pop, und kündigt die methodische Vorgehensweise an, die auf dem Modell der produktiven Realitätsverarbeitung von Hurrelmann und Quenzel basiert, insbesondere deren 7. Maxime.
2. Musikvideos in Lebenswelten von Jugendlichen: Dieses Kapitel belegt die hohe Relevanz urbaner Musikvideos im Leben von Jugendlichen. Es stützt sich auf verschiedene Studien, die den hohen Konsum von Hip-Hop/Rap, Pop und R&B Musik unter Jugendlichen belegen und die zentrale Rolle von YouTube und Smartphones im Konsumverhalten hervorheben. Der Wandel vom Fernseh- zum Onlinekonsum wird beschrieben, und die damit verbundene Veränderung der Zugangsbeschränkungen (Sendezeiten, Altersbeschränkungen) wird analysiert. Die erhöhte Verfügbarkeit und der vereinfachte Zugang durch mobile Endgeräte und Online-Plattformen werden als entscheidende Faktoren für den Einfluss von Musikvideos auf Jugendliche herausgestellt.
3. Geschlechterdarstellung in urbanen Musikvideos: Dieses Kapitel analysiert die Geschlechterdarstellungen in den untersuchten Musikgenres. Es wird deutlich, dass die Darstellung von Frauen häufig von Hierarchisierung, Objektifizierung, Hypersexualisierung und Stereotypisierung geprägt ist, wobei US-amerikanische Produktionen häufig extremer ausfallen als deutsche. Die Analyse berücksichtigt Kleidung, Kameraführung, Erzählperspektiven sowie Mimik und Gestik als relevante Faktoren. Die Unterordnung der Frau gegenüber dem Mann wird als dominantes Muster identifiziert.
Schlüsselwörter
Medienbildung, Musikerziehung, Postmoderne, Geschlechterdarstellung, urbane Musikvideos, Hip-Hop/Rap, RnB, Pop, Identitätsbildung, Jugendliche, Sozialisation, 7. Maxime Hurrelmann/Quenzel, produktive Realitätsverarbeitung, Hypersexualisierung, Objektifizierung, Stereotypisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Geschlechterdarstellung in urbanen Musikvideos und deren Einfluss auf die Identitätsbildung Jugendlicher
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Geschlechtern in urbanen Musikvideos (Hip-Hop/Rap, R&B, Pop) und deren potenziellen Einfluss auf die Identitätsbildung Jugendlicher. Der Fokus liegt auf der Anwendung des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung nach Hurrelmann und Quenzel, insbesondere der 7. Maxime.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Geschlechterdarstellungen in urbanen Musikvideos zu analysieren, deren Relevanz im Medienkonsum Jugendlicher zu untersuchen, den Einfluss dieser Darstellungen auf die Identitätsbildung zu bewerten und das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung auf die Thematik anzuwenden, insbesondere im Hinblick auf die 7. Maxime von Hurrelmann und Quenzel.
Welche Musikgenres werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die Genres Hip-Hop/Rap, R&B und Pop.
Wie wird die Relevanz von Musikvideos für Jugendliche belegt?
Die Arbeit stützt sich auf Studien, die den hohen Konsum urbaner Musikvideos bei Jugendlichen belegen und die Bedeutung von YouTube und Smartphones im Konsumverhalten hervorheben. Der Wandel vom Fernseh- zum Onlinekonsum und die damit verbundene Veränderung der Zugangsbeschränkungen werden ebenfalls analysiert.
Wie werden die Geschlechterdarstellungen in den Musikvideos analysiert?
Die Analyse der Geschlechterdarstellungen berücksichtigt Aspekte wie Kleidung, Kameraführung, Erzählperspektiven, Mimik und Gestik. Es wird untersucht, ob und wie Frauen und Männer dargestellt werden, z.B. in Bezug auf Hierarchisierung, Objektifizierung, Hypersexualisierung und Stereotypisierung.
Welche Rolle spielt das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung nach Hurrelmann und Quenzel?
Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung, insbesondere die 7. Maxime, dient als theoretischer Rahmen für die Analyse des Einflusses der Geschlechterdarstellungen auf die Identitätsbildung Jugendlicher.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Art und Weise, wie Geschlechter in urbanen Musikvideos dargestellt werden und welchen potenziellen Einfluss diese Darstellungen auf die Identitätsbildung Jugendlicher haben können. Diese Schlussfolgerungen werden im Kontext der 7. Maxime von Hurrelmann und Quenzel diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Medienbildung, Musikerziehung, Postmoderne, Geschlechterdarstellung, urbane Musikvideos, Hip-Hop/Rap, RnB, Pop, Identitätsbildung, Jugendliche, Sozialisation, 7. Maxime Hurrelmann/Quenzel, produktive Realitätsverarbeitung, Hypersexualisierung, Objektifizierung, Stereotypisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Musikvideos in den Lebenswelten von Jugendlichen, ein Kapitel über die Geschlechterdarstellung in urbanen Musikvideos, ein Kapitel über die Auswirkungen auf Jugendliche im Hinblick auf die 7. Maxime, und ein Fazit.
Gibt es Unterschiede in der Geschlechterdarstellung zwischen US-amerikanischen und deutschen Produktionen?
Ja, die Analyse zeigt, dass US-amerikanische Produktionen häufig extremer in der Darstellung von Frauen (Hierarchisierung, Objektifizierung, Hypersexualisierung und Stereotypisierung) sind als deutsche Produktionen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Geschlechterdarstellungen in urbanen Musikvideos und mögliche Auswirkungen auf die Identitätsbildung von Jugendlichen anhand der 7. Maxime nach Hurrelmann und Quenzel, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1449022