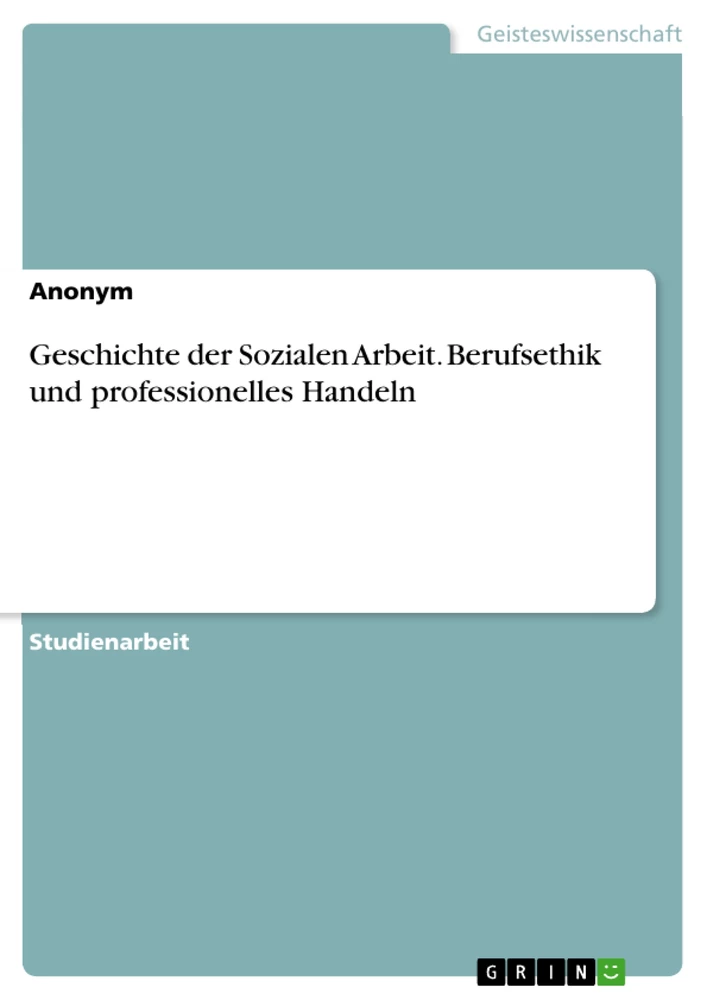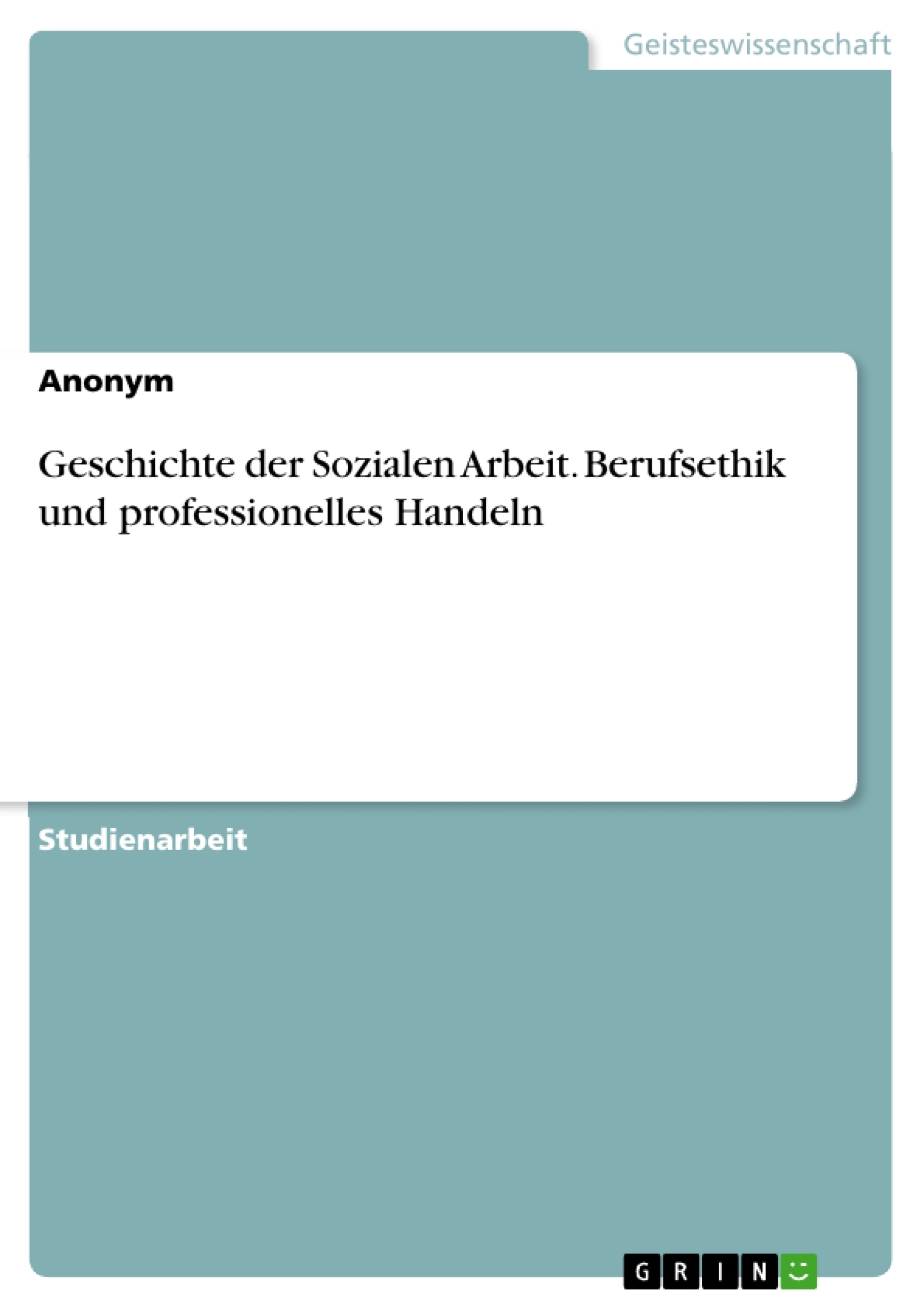Die Arbeit beschäftigt sich zunächst mit der Geschichte von der Euthanasie/Sterbehilfe. Es wird eingegangen auf das Mittelalter, die frühe Neuzeit, die Zeit zwischen 1800 bis 1900 und auf die heutige Zeit. Dabei werden unter anderem auf verschiedene Philosophien der jeweiligen Epoche eingegangen. Im zweiten Teil der Arbeit wird ein Fallbeispiel aus einem Altenpflegeheim für demenzerkrankte Personen unter ethischen Aspekten beurteilt.
Es wird sich dabei mit dem Sozialarbeiter in der jüngeren Geschichte der Sozialen Arbeit im Handlungsfeld Seniorenheim für demenziell erkrankte Menschen beschäftigt. Dabei wird auf die Nahrungseinstellung und ihre Folgen wie auch auf die Berücksichtigung des Lebenswillens eingegangen. Dabei wird der Fall mithilfe der ethischen Urteilsfindung nach Heinz Eduard Tödt beurteilt. Zum Schluss wird eine ethische Entscheidung getroffen, wie mit der Situation des Fallbeispiels umgegangen werden sollte.
Die Geschichte der Euthanasie/Sterbehilfe reicht bis in das antike Griechenland und Rom noch vor Christi Geburt hin. Schon damals in der griechischen Antike (800 v. Chr. Bis 146 n. Chr.) wurde über die Sterbehilfe debattiert. Eine der Grundannahmen des medizinethischen Selbstverständnisses zum Thema Sterbehilfe war damals wie heute der hippokratische Eid, der garantiert, dass niemand jemandem ein tödliches Medikament verabreichen darf oder auch nur darüber informiert, selbst wenn er darum gebeten wird.
Auch heute sind diese Begriffe hochaktuelle Themen in unserer Gesellschaft. Die beiden Begriffe können gleichgestellt werden, beide haben das gleiche Ziel. Von beiden geht ein guter Tod aus. Die Euthanasie kommt von dem griechischen Wort "Euthanatos" und bedeutet "guter Tod". Es handelt sich bei der Euthanasie also um einen guten und friedlichen Tod. Die Sterbehilfe bezeichnet, dass jemand eine andere Person dabei hilft zu sterben. Dies kann bei Menschen vorkommen, die z. B. schwer krank sind. Es gibt eine Menge an Untersuchungen zu der Geschichte der Euthanasie/Sterbehilfe.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte der Sozialen Arbeit
- 2.1 Sterbehilfe im Mittelalter
- 2.2 Renaissance
- 2.3 Frühe Neuzeit und 19. Jahrhundert
- 2.3 Anfang des 20. Jahrhunderts
- 2.4 Im Nationalsozialismus 1933 – 1945
- 2.4.1 Die Kinder- und Jugendlicheneuthanasie
- 2.4.2 Erwachseneneuthanasie
- 2.4 ab 1945 bis heute
- 2.5 Fazit zur Geschichte
- 3. Berufsethik und professionelles Handeln
- 3.1 Ethik
- 3.2 Ethik Sozialer Arbeit
- 3.3 Berufsethik nach dem DBSH
- 3.4 Fallvorstellung
- 3.5 Ethische Urteilfindung nach Heinz-Eduard Tödt
- 3.5.1 Wahrnehmung, Feststellung und Bestimmung des Problems
- 3.5.2 Analyse der Situation
- 3.5.3 Erwägung der Handlungs- bzw. Verhaltensoptionen
- 3.5.4 Auswahl und Prüfung von Normen, Gütern und Perspektiven
- 3.5.5 Prüfung der sittlich-kommunikativen Verbindlichkeit der wählbaren Handlungs- und Verhaltensoptionen
- 4. Urteilsentscheid und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Euthanasie/Sterbehilfe und deren ethische Implikationen im Kontext der Sozialen Arbeit. Sie analysiert historische Perspektiven auf die Sterbehilfe, von der Ablehnung im Mittelalter bis zu den ethischen Debatten des 20. Jahrhunderts. Ein Fallbeispiel aus einem Altenpflegeheim für Demenzerkrankte dient der Anwendung ethischer Prinzipien im professionellen Handeln.
- Historische Entwicklung der Sterbehilfe
- Ethische Aspekte der Sterbehilfe
- Berufsethik in der Sozialen Arbeit
- Anwendung ethischer Entscheidungskriterien
- Fallbeispiel: Nahrungseinstellung bei Demenzkranken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Euthanasie und Sterbehilfe ein und stellt die beiden Begriffe einander gegenüber. Sie skizziert den historischen Kontext und die Relevanz des Themas in der heutigen Gesellschaft, bevor sie die Struktur und den Fokus der Arbeit darlegt, der auf der Geschichte der Sterbehilfe und einem ethischen Fallbeispiel in einem Altenpflegeheim liegt.
2. Geschichte der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel bietet eine umfassende historische Betrachtung der Euthanasie/Sterbehilfe, beginnend mit dem Mittelalter, wo sie abgelehnt und als Todsünde betrachtet wurde. Die Renaissance zeigt eine differenziertere Sichtweise mit Thomas Morus' Konzept der freiwilligen Beendigung des Lebens unter Zustimmung des Priesters, während andere Denker wie Martin Luther und Francis Bacon unterschiedliche Positionen einnahmen. Die Frühe Neuzeit und das 19. Jahrhundert sind durch rechtliche Verbote und die Auseinandersetzung von Medizinern mit palliativer versus kurativer Behandlung geprägt. Das Kapitel skizziert die Entwicklung der Diskussion um aktive und passive Sterbehilfe und die allmähliche Verschiebung der medizinischen und gesellschaftlichen Haltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Geschichte der Euthanasie/Sterbehilfe und deren ethische Implikationen in der Sozialen Arbeit"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Geschichte der Euthanasie und Sterbehilfe und deren ethischen Implikationen im Kontext der Sozialen Arbeit. Sie analysiert historische Perspektiven von der Ablehnung im Mittelalter bis zu den heutigen ethischen Debatten. Ein Fallbeispiel aus der Altenpflege (Nahrungseinstellung bei Demenzkranken) veranschaulicht die Anwendung ethischer Prinzipien im professionellen Handeln.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Sterbehilfe, ethische Aspekte der Sterbehilfe, die Berufsethik in der Sozialen Arbeit, die Anwendung ethischer Entscheidungskriterien und ein Fallbeispiel zur Nahrungseinstellung bei Demenzkranken. Die historische Betrachtung umfasst die Entwicklung von der Ablehnung im Mittelalter über die Renaissance, die Frühe Neuzeit, das 19. und 20. Jahrhundert (inkl. des Nationalsozialismus) bis zur Gegenwart.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Geschichte der Sozialen Arbeit (inkl. detaillierter Unterkapitel zu verschiedenen Epochen und dem Nationalsozialismus), ein Kapitel zur Berufsethik und zum professionellen Handeln (mit einem ausführlichen Abschnitt zur ethischen Urteilfindung nach Heinz-Eduard Tödt) und ein abschließendes Kapitel mit Urteilsentscheid und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen erleichtern die Navigation.
Welche Epochen werden in der historischen Betrachtung der Sterbehilfe berücksichtigt?
Die historische Betrachtung umfasst das Mittelalter, die Renaissance, die Frühe Neuzeit, das 19. Jahrhundert, den Nationalsozialismus (mit Fokus auf Kinder- und Erwachseneneuthanasie) und die Zeit ab 1945 bis heute. Die jeweiligen Haltungen und Entwicklungen der Diskussion um aktive und passive Sterbehilfe werden dabei differenziert dargestellt.
Welches Fallbeispiel wird verwendet?
Das Fallbeispiel behandelt die ethische Problematik der Nahrungseinstellung bei Demenzkranken in einem Altenpflegeheim. Es dient der praktischen Anwendung der im theoretischen Teil erarbeiteten ethischen Prinzipien und Entscheidungskriterien.
Welche ethischen Prinzipien und Entscheidungskriterien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Berufsethik nach dem Deutschen Berufsverband für Sozialarbeit (DBSH) und die ethische Urteilfindung nach Heinz-Eduard Tödt. Tödt's Modell umfasst die Wahrnehmung des Problems, die Situationsanalyse, die Erwägung von Handlungsoptionen, die Prüfung von Normen und Perspektiven und die Prüfung der sittlich-kommunikativen Verbindlichkeit der Handlungsoptionen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Geschichte der Sozialen Arbeit. Berufsethik und professionelles Handeln, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1446474