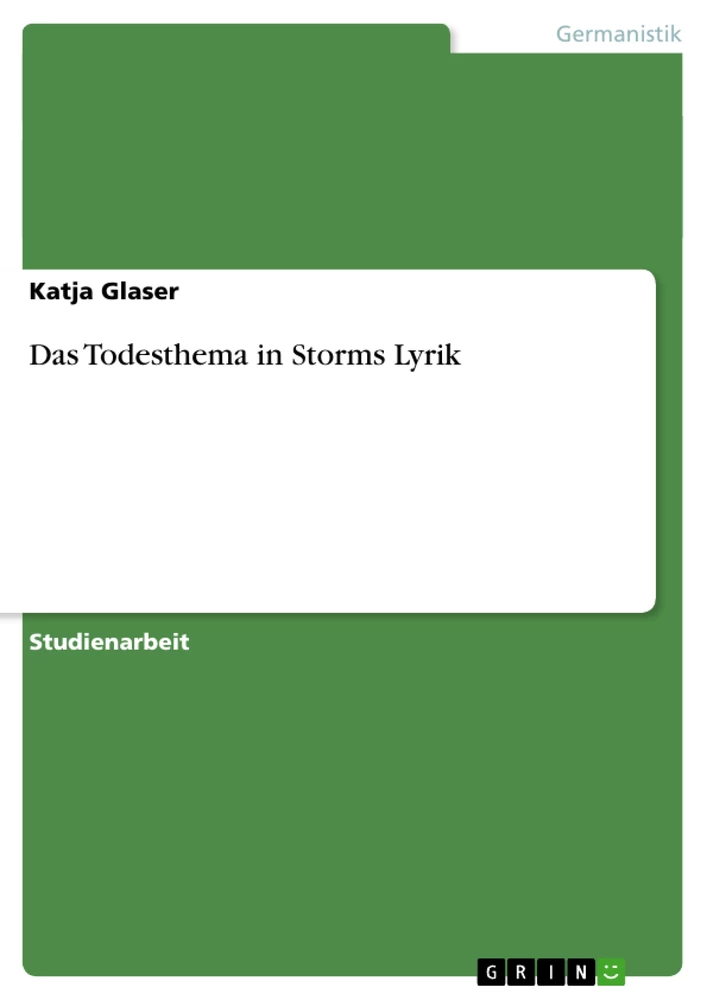Die Rezeption des Todes in der Lyrik ist schon seit es Dichtung gibt ein nicht selten aufgegriffenes Thema. Sei das Motiv für die Beschäftigung mit dem Tod der Glaube an ein Jenseits oder auch die Angst vor dem Unbekannten – die Umsetzung ist immer irgendwie unvollständig. Der Grund dafür ist einfach, dass der Dichter vom Tode – im Gegensatz zu anderen Erlebnissen - nicht aus eigener Erfahrung berichten kann. Daher kann der Tod bei seiner Rezeption in der Lyrik auch niemals als etwas tatsächlich Erlebtes wiedergegeben werden. Wie Theodor Storm mit dieser Komponente des Ungewissen umgeht und das Thema des Todes in seiner Lyrik behandelt, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Dabei soll an ausgewählten Beispielen sowohl unter Einbeziehung biographischer Aspekte als auch in Rücksichtnahme auf spezielle persönliche Eigenschaften des Menschen Storm herausgestellt werden, in welchen Situationen und unter welchen Einwirkungen von außen seine Todeslyrik entstanden ist.
2. Interpretation der Gedichte
2.1 Einer Toten1
Dieses Gedicht schrieb Storm anlässlich des Todes seiner ältesten Schwester Helene Lorenzen, die am 10. November 1847 im Kindbett starb.2
Im ersten Teil des Gedichts schildert er die Situation kurz vor ihrem Tode. Ihre Qual wird beschrieben: „Noch eine Nacht, noch eine war gegeben! Auch die verrann; dann kam das Morgenlicht.“ Sie ist hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, von ihrem Leid erlöst zu werden, wofür die „Nacht“ als Symbol steht und ihrem Lebenswillen und der Hoffnung, die vom „Morgenlicht“ symbolisiert werden:„Mein guter Mann, wie gerne wollt ich leben!“ Das Bewusstsein, sterben zu müssen, wird mit Fortschreiten der Nacht deutlicher: „Sorg für das Kind – ich sterbe, süßer Mann.“
Allerdings wird anfangs auch angedeutet, dass dieses Siechtum der jungen Mutter scheinbar keine neue Erscheinung ist: „Du glaubtest nicht an frohe Tage mehr, Verjährtes Leid ließ nimmer dich genesen; Die Mutterfreude war für dich zu schwer, Das Leben war dir gar zu hart gewesen. - “ Offenbar war die Frau auch vorher bereits ein eher kränklicher Typ, denn „Verjährtes Leid“ deutet eigentlich auf ein langfristiges, chronisches Leiden hin. So war die Geburt des Kindes dann wohl das Todesurteil für die junge Frau. Aufgrund ihrer schwachen Konsistenz hat sie diese Anstrengung nicht bewältigen können. Auch steht die „Mutterfreude“ in Antagonie zum Tode- sie hat Leben geschenkt und geht selbst daran zugrunde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interpretation der Gedichte
- Einer Toten
- Lucie
- Beginn des Endes
- Tiefe Schatten
- Crucifixius
- Constanze
- Heinrich Heine:,, Wie langsam kriechet sie dahin".
- Vergleich der Gedichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rezeption des Todes in der Lyrik Theodor Storms. Ziel ist es, zu analysieren, wie Storm dieses Thema in seinen Gedichten behandelt und welche Aspekte der menschlichen Erfahrung des Todes er in den Vordergrund stellt. Hierzu werden ausgewählte Gedichte unter Einbezug biographischer Aspekte und unter Berücksichtigung der Persönlichkeit Theodor Storms untersucht.
- Die Darstellung des Todes in Storms Gedichten
- Die Rolle der Natur in der Todeslyrik
- Die subjektive Erfahrung des Todes
- Die Beziehung zwischen Leben und Tod in Storms Werk
- Die Bedeutung von Verlust und Trauer in Storms Gedichten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Todeslyrik ein und beleuchtet die Herausforderungen, die sich für den Dichter aus der Thematik des Todes ergeben. Anschließend werden die Gedichte ,,Einer Toten“ und ,,Lucie“ interpretiert. Beide Gedichte behandeln den Tod von engen Familienmitgliedern und geben Einblick in Storms Umgang mit Trauer und Verlust.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Todeslyrik, Verlust, Trauer, Natur, Biographie, Theodor Storm, „Einer Toten“, „Lucie“, und die subjektive Erfahrung des Todes.
- Arbeit zitieren
- Katja Glaser (Autor:in), 2003, Das Todesthema in Storms Lyrik, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/144503