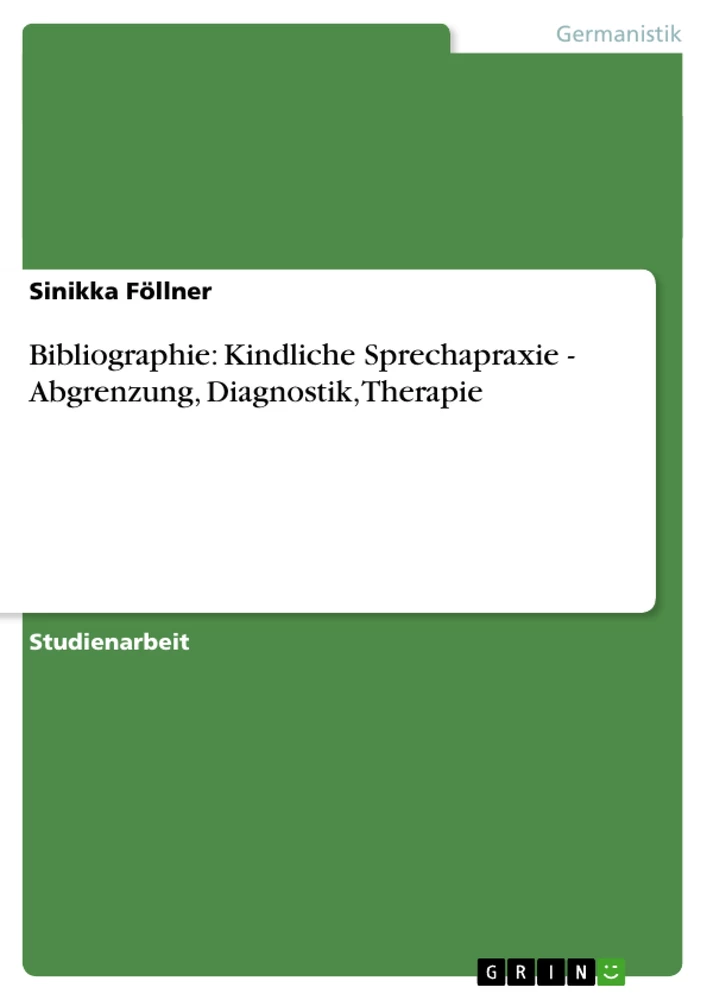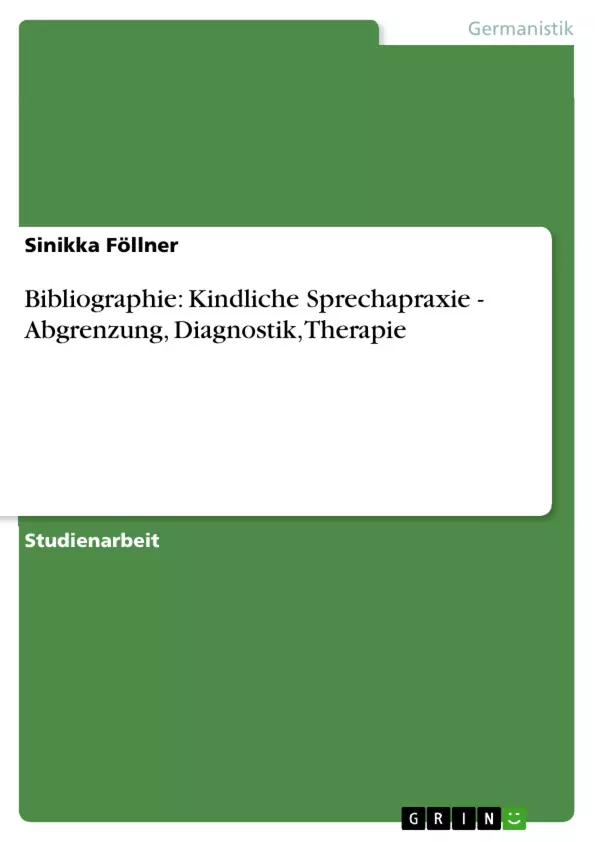Sprechapraktische Störungen treten im Erwachsenen- als auch im frühen Kindesalter auf.
Jedoch unterscheiden sich die beiden Störungsbilder maßgeblich. Und während die erworbene Sprechapraxie schon ein bereits anerkanntes Störungsbild ist, stellt die kindliche Sprechapraxie einen eher unklaren, unbekannten Befund dar.
Es existieren verschiedene, teilweise differierende Definitionen der kindlichen Sprechapraxie. Allen gemein ist, dass die willkürliche Planung und Programmierung der Sequenzierung von
Sprechbewegungen für die Kinder mit Sprechapraxie das Kardinalsymptom darstellt. Aufgrund einer vielfältigen Variation an Begleitsymptomen ist es jedoch sehr wichtig kindliche Sprechapraxie von klinischen Nachbarn abzugrenzen.
Auch eine eindeutige Diagnostik ist maßgeblich für die spätere therapeutische Intervention. Hierfür sind vor allem Kriterien und standardisierte Verfahren zur eindeutigen Identifikation notwendig.
Letztendlich sind effektive Therapiemethoden unabdingbar.
Aufgrund der Aktualität und den immer lauter werdenden Forderungen nach evidenzbasierten Therapiemethoden und standardisierten Diagnostikverfahren habe ich mich mit dieser Thematik beschäftigt.
In der folgenden Bibliographie werden aktuellen Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung zum Thema „kindliche Sprechapraxie – Abgrenzung, Diagnostik und Therapie“ dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Differentialdiagnostik
- Bahr, R. H. (2005). Differential diagnosis of severe speech disorders using speech gestures.
- Davis, B. L., Jakielski, K. J., & Marquardt, T. P. (1998). Developmental apraxia of speech: determiners of differential diagnosis.
- Diagnostik
- Diagnostikkriterien für kindliche Sprachapraxie
- Diagnostikverfahren
- Therapie
- Überblicksartikel/ Reviews
- Einzelfallstudien: phonologisch orientierte Therapie
- Einzelfallstudien: alternative Therapiemethoden
- Autorenverzeichnis
- Stichwortverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bibliographie fasst aktuelle Forschungsarbeiten zum Thema kindliche Sprechapraxie zusammen, mit Fokus auf Abgrenzung, Diagnostik und Therapie. Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu geben und die Herausforderungen bei der Diagnose und Behandlung dieser Störung aufzuzeigen.
- Abgrenzung der kindlichen Sprechapraxie von ähnlichen Störungen
- Kriterien und Verfahren zur Diagnostik kindlicher Sprechapraxie
- Effektive Therapiemethoden für kindliche Sprechapraxie
- Bewertung des aktuellen Forschungsstandes und identifizierte Forschungslücken
- Analyse verschiedener Therapieansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die Problematik der kindlichen Sprechapraxie, die im Vergleich zur erworbenen Sprechapraxie weniger erforscht ist und durch unterschiedliche Definitionen gekennzeichnet ist. Es betont die Wichtigkeit einer klaren Abgrenzung zu ähnlichen Störungen, einer eindeutigen Diagnostik und effektiver Therapiemethoden. Der Mangel an evidenzbasierten Therapiemethoden und standardisierten Diagnostikverfahren wird hervorgehoben, was die Motivation für die vorliegende Bibliographie darstellt. Die Recherchemethode, inklusive der verwendeten Suchbegriffe und Datenbanken, wird detailliert beschrieben, ebenso wie die Auswahl der 32 relevanten Artikel aus einer größeren Auswahl. Abschließend wird der anhaltende Bedarf an weiterer Forschung kritisch angemerkt, insbesondere im Hinblick auf kontrollierte Studien zur Behandlungseffektivität.
Differentialdiagnostik: Dieses Kapitel präsentiert zwei Studien zur Differentialdiagnose von schweren Sprachstörungen, insbesondere zur Abgrenzung von kindlicher Sprechapraxie und schweren phonologischen Störungen. Bahr (2005) untersucht die Verwendung von Artikulationsgesten und deren akustische Analyse zur Unterscheidung der beiden Störungen. Davis et al. (1998) beleuchten die Schwierigkeiten bei der Diagnose von kindlicher Sprechapraxie aufgrund der unterschiedlichen Symptome und der kontroversen Diskussionen um die Ätiologie und Behandlung. Die Kapitel zeigen die Komplexität der Diagnostik und die Notwendigkeit von standardisierten Verfahren auf.
Schlüsselwörter
Kindliche Sprechapraxie, Differentialdiagnostik, Diagnostikverfahren, Therapiemethoden, evidenzbasierte Medizin, Sprachentwicklungsstörung, Artikulationsgesten, phonologische Störung, Einzelfallstudien, Reviews.
Häufig gestellte Fragen zur Bibliographie: Kindliche Sprechapraxie
Was ist der Inhalt dieser Bibliographie?
Diese Bibliographie bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur kindlichen Sprechapraxie. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie ein Schlüsselwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung der Störung von ähnlichen Erkrankungen, den diagnostischen Verfahren und den verfügbaren Therapiemethoden.
Welche Themen werden in der Bibliographie behandelt?
Die Bibliographie behandelt die Differentialdiagnostik, die Diagnostik (inklusive Kriterien und Verfahren) und die Therapie der kindlichen Sprechapraxie. Es werden sowohl Überblicksartikel als auch Einzelfallstudien zu verschiedenen Therapieansätzen (phonologisch orientierte Therapie und alternative Methoden) berücksichtigt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Herausarbeitung der bestehenden Forschungslücken und der Notwendigkeit weiterer Forschung, insbesondere im Bereich evidenzbasierter Therapiemethoden.
Welche Studien werden in der Bibliographie erwähnt?
Die Bibliographie bezieht sich auf verschiedene Studien, darunter Bahr (2005) zur Differentialdiagnose mittels Sprachgesten und Davis et al. (1998) zu den Schwierigkeiten bei der Diagnose der kindlichen Sprechapraxie. Die genaue Anzahl der zitierten Artikel beträgt 32, ausgewählt aus einer größeren Menge an Rechercheergebnissen.
Wie ist die Bibliographie aufgebaut?
Die Bibliographie gliedert sich in verschiedene Kapitel: Ein Vorwort, das die Problematik der kindlichen Sprechapraxie erläutert, ein Kapitel zur Differentialdiagnostik, ein Kapitel zur Diagnostik, ein Kapitel zur Therapie und abschließend ein Autoren- und ein Stichwortverzeichnis. Die Kapitelzusammenfassungen geben einen detaillierten Einblick in den jeweiligen Inhalt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Bibliographie?
Die Bibliographie zielt darauf ab, einen aktuellen Überblick über die Forschung zur kindlichen Sprechapraxie zu geben und die Herausforderungen bei Diagnose und Therapie dieser Störung aufzuzeigen. Sie soll den aktuellen Forschungsstand zusammenfassen und Forschungslücken identifizieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Bibliographie?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kindliche Sprechapraxie, Differentialdiagnostik, Diagnostikverfahren, Therapiemethoden, evidenzbasierte Medizin, Sprachentwicklungsstörung, Artikulationsgesten, phonologische Störung, Einzelfallstudien, Reviews.
Was wird im Vorwort erläutert?
Das Vorwort beschreibt die Problematik der kindlichen Sprechapraxie, den Mangel an evidenzbasierten Therapien und standardisierten Diagnoseverfahren, die angewandte Forschungsmethode (Suchbegriffe und Datenbanken) und die Auswahl der 32 relevanten Artikel. Es betont die Notwendigkeit weiterer Forschung, insbesondere kontrollierter Studien zur Behandlungseffektivität.
Was wird im Kapitel zur Differentialdiagnostik behandelt?
Das Kapitel zur Differentialdiagnostik präsentiert Studien, die sich mit der Abgrenzung der kindlichen Sprechapraxie von ähnlichen Störungen, insbesondere schweren phonologischen Störungen, befassen. Es verdeutlicht die Komplexität der Diagnostik und den Bedarf an standardisierten Verfahren.
- Quote paper
- Sinikka Föllner (Author), 2002, Bibliographie: Kindliche Sprechapraxie - Abgrenzung, Diagnostik, Therapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/143727