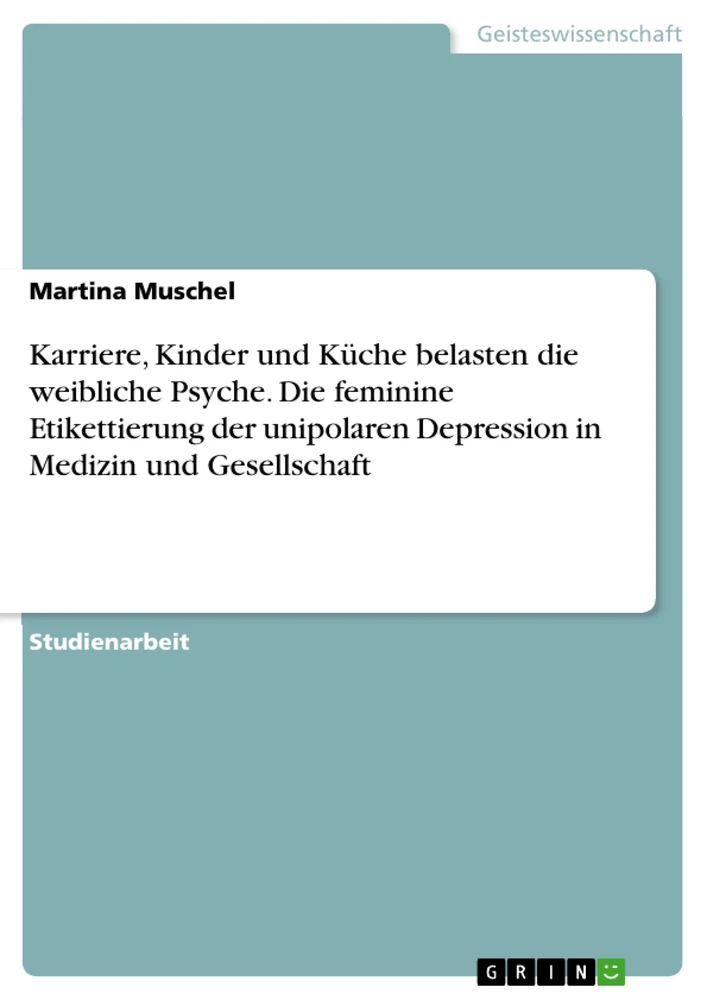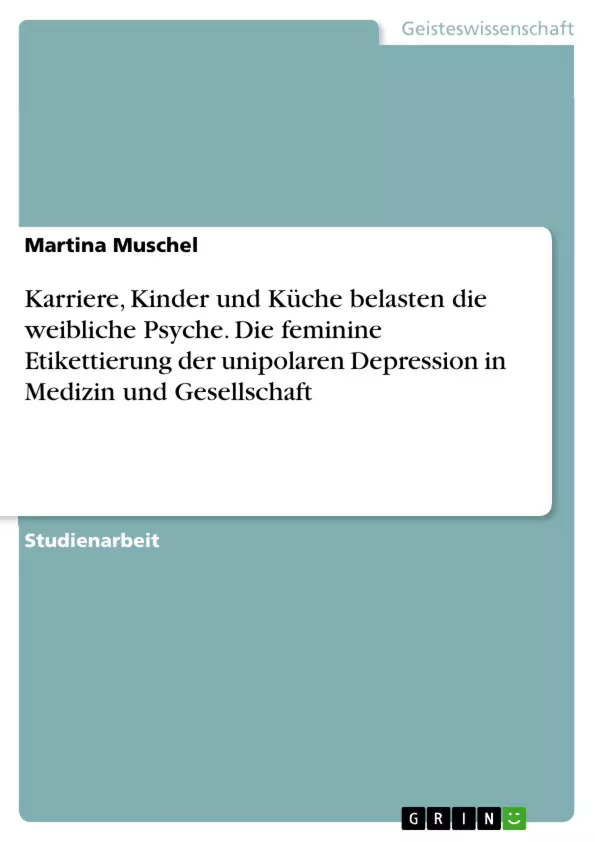Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es bietet einen Überblick über eine wissenschaftliche Arbeit zur unipolaren Depression unter Berücksichtigung von Geschlechteraspekten.