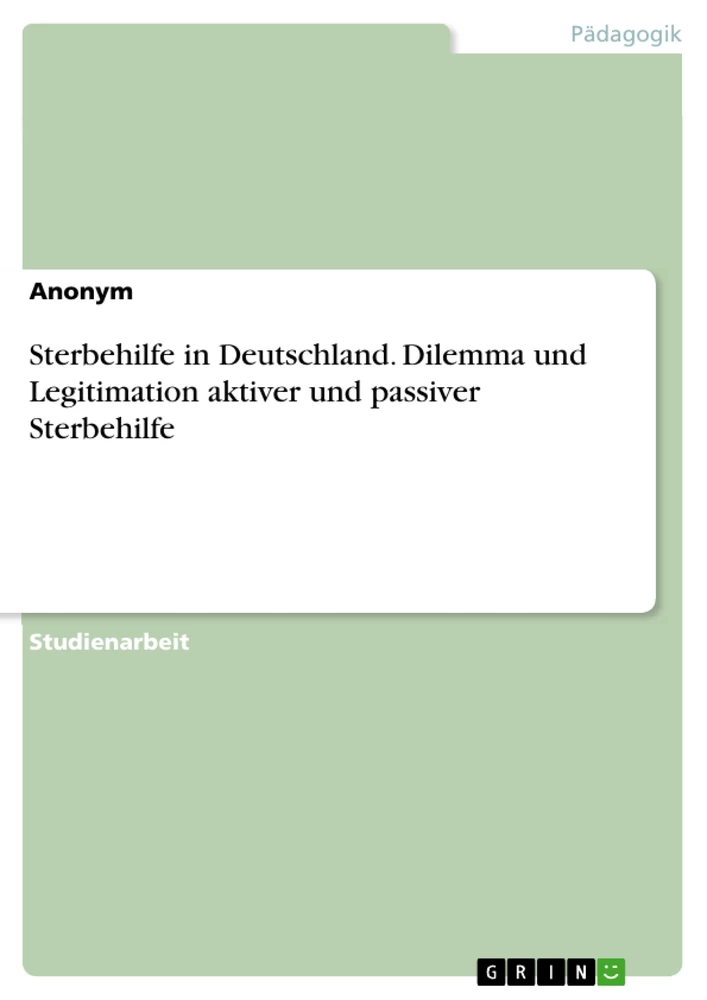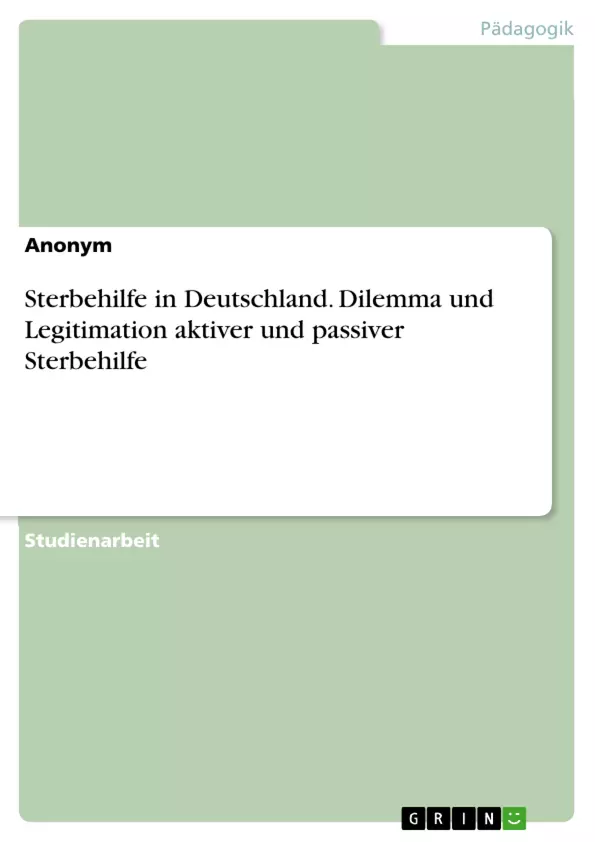Auf die Komplexität des Themas der Sterbehilfe, welche Probleme und Risiken dahinter stehen und ob es in der Praxis überhaupt so einfach umsetzbar ist, wie es sich von vielen gewünscht wird, wird in dieser Hausarbeit näher eingegangen.
Zunächst werden als Grundlage die Gesetze in Deutschland und die rechtlichen Hintergründe der Sterbehilfe erläutern. Danach folgt damit zusammenhängend alles rund um Patientenverfügungen und den mutmaßlichen Patentenwillen und die Dilemmata, die bei der Suche und Umsetzung dessen zustande kommen. Darauf folgt ein kurzer Überblick darüber, wie das Thema in der Praxis aussieht und im Anschluss werden die aktive und die passive Sterbehilfe auf Grundlage zweier Bücher von Singer und Kuhse, sowie von Dederich kritisch beleuchtet und auf ihre moralische Legitimation geprüft. Zum Abschluss wird ein kurzer Einblick in die theologische Sichtweise des Themas gegeben und anschließend ein Fazit aus dem vorherigen Text gezogen und ein weiterer Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Gesetzlicher Hintergrund der Sterbehilfe in Deutschland
- 2. Der mutmaßliche Patientenwille und seine Dilemmata
- 3. Diskussion über die moralische Legitimation aktiver und passiver Sterbehilfe
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexe Thematik der Sterbehilfe in Deutschland. Ziel ist es, den gesetzlichen Rahmen, die Herausforderungen beim Umgang mit dem mutmaßlichen Patientenwillen und die ethischen Fragen aktiver und passiver Sterbehilfe zu beleuchten.
- Gesetzliche Grundlagen der Sterbehilfe in Deutschland
- Der mutmaßliche Patientenwille und die Problematik von Patientenverfügungen
- Ethische Bewertung aktiver und passiver Sterbehilfe
- Praktische Umsetzung und Herausforderungen
- Theologische Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sterbehilfe ein und hebt die Bedeutung von Autonomie am Lebensende hervor. Sie skizziert die zentralen Fragen und den Aufbau der Arbeit, die sich mit den rechtlichen, ethischen und praktischen Aspekten der Sterbehilfe auseinandersetzt, insbesondere im Kontext der deutschen Gesetzgebung und der Umsetzung des mutmaßlichen Patientenwillens.
1. Gesetzlicher Hintergrund der Sterbehilfe in Deutschland: Dieses Kapitel differenziert zwischen Sterbebegleitung und Sterbehilfe und unterteilt letztere in aktive Sterbehilfe, Beihilfe zum Suizid, indirekte Sterbehilfe und passive Sterbehilfe. Es analysiert die strafrechtliche Relevanz jeder Form und beleuchtet die Stellungnahmen der Bundesärztekammer, insbesondere bezüglich des Unterlassens oder Beendens lebenserhaltender Maßnahmen im Einklang mit dem Patientenwillen. Die rechtliche Grauzone, besonders bei der passiven Sterbehilfe und der Berücksichtigung des mutmaßlichen Willens, wird hervorgehoben.
2. Der mutmaßliche Patientenwille und seine Dilemmata: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rekonstruktion des mutmaßlichen Patientenwillens, beginnend mit dem aktuell geäußerten Willen des Patienten und der Rolle von gesetzlichen Vertretern und Vorsorgevollmachten. Es analysiert die Bedeutung von Patientenverfügungen, deren Erstellung und rechtliche Gültigkeit. Das Kapitel beleuchtet die zentralen Dilemmata: die Schwierigkeit, den tatsächlichen Willen eines nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten zu ermitteln und die unterschiedlichen Interpretationen von "lebenswertem Leben", insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern. Die ethischen Fragen, die mit der Berücksichtigung der Motive des Patienten verbunden sind, werden kritisch diskutiert.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, Patientenverfügung, mutmaßlicher Patientenwille, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, gesetzliche Grundlagen, ethische Dilemmata, Deutschland, Selbstbestimmung, Lebensende.
FAQ: Sterbehilfe in Deutschland - Eine umfassende Übersicht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die komplexe Thematik der Sterbehilfe in Deutschland. Sie beleuchtet den gesetzlichen Rahmen, die Herausforderungen beim Umgang mit dem mutmaßlichen Patientenwillen und die ethischen Fragen der aktiven und passiven Sterbehilfe.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesetzlichen Grundlagen der Sterbehilfe in Deutschland, die Problematik des mutmaßlichen Patientenwillens und die Erstellung von Patientenverfügungen. Sie bewertet ethisch die aktive und passive Sterbehilfe, untersucht die praktische Umsetzung und Herausforderungen und berührt auch theologische Perspektiven.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Kapitel und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein. Kapitel 1 behandelt den gesetzlichen Hintergrund, Kapitel 2 den mutmaßlichen Patientenwillen und seine Dilemmata, und Kapitel 3 diskutiert die moralische Legitimation aktiver und passiver Sterbehilfe. Kapitel 4 bietet ein Fazit und Ausblick.
Was sind die zentralen Fragen der Arbeit?
Zentrale Fragen sind die rechtliche Einordnung verschiedener Formen der Sterbehilfe (aktive, passive, Beihilfe zum Suizid), die Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens, insbesondere bei nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten, und die ethische Bewertung der unterschiedlichen Vorgehensweisen im Kontext der deutschen Gesetzgebung.
Welche Arten von Sterbehilfe werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Sterbebegleitung und Sterbehilfe, letztere weiter unterteilt in aktive Sterbehilfe, Beihilfe zum Suizid, indirekte Sterbehilfe und passive Sterbehilfe. Die strafrechtliche Relevanz jeder Form wird analysiert.
Welche Rolle spielt der mutmaßliche Patientenwille?
Das Kapitel zum mutmaßlichen Patientenwillen untersucht die Rekonstruktion des Willens eines nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten anhand aktuell geäußerter Wünsche, gesetzlicher Vertreter und Vorsorgevollmachten. Es beleuchtet die Bedeutung und die rechtliche Gültigkeit von Patientenverfügungen und die damit verbundenen ethischen Dilemmata, insbesondere die Schwierigkeit der Willensfeststellung und die unterschiedlichen Interpretationen von "lebenswertem Leben".
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Sterbehilfe, Patientenverfügung, mutmaßlicher Patientenwille, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, gesetzliche Grundlagen, ethische Dilemmata, Deutschland, Selbstbestimmung, Lebensende.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird angeboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die Inhalte jedes Kapitels: Die Einleitung, der gesetzliche Hintergrund der Sterbehilfe in Deutschland, die Herausforderungen des mutmaßlichen Patientenwillens und die ethische Diskussion über aktive und passive Sterbehilfe.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit der Thematik der Sterbehilfe in Deutschland auseinandersetzen möchten, z.B. Studierende, Wissenschaftler und Fachleute im Gesundheitswesen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Sterbehilfe in Deutschland. Dilemma und Legitimation aktiver und passiver Sterbehilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1422920