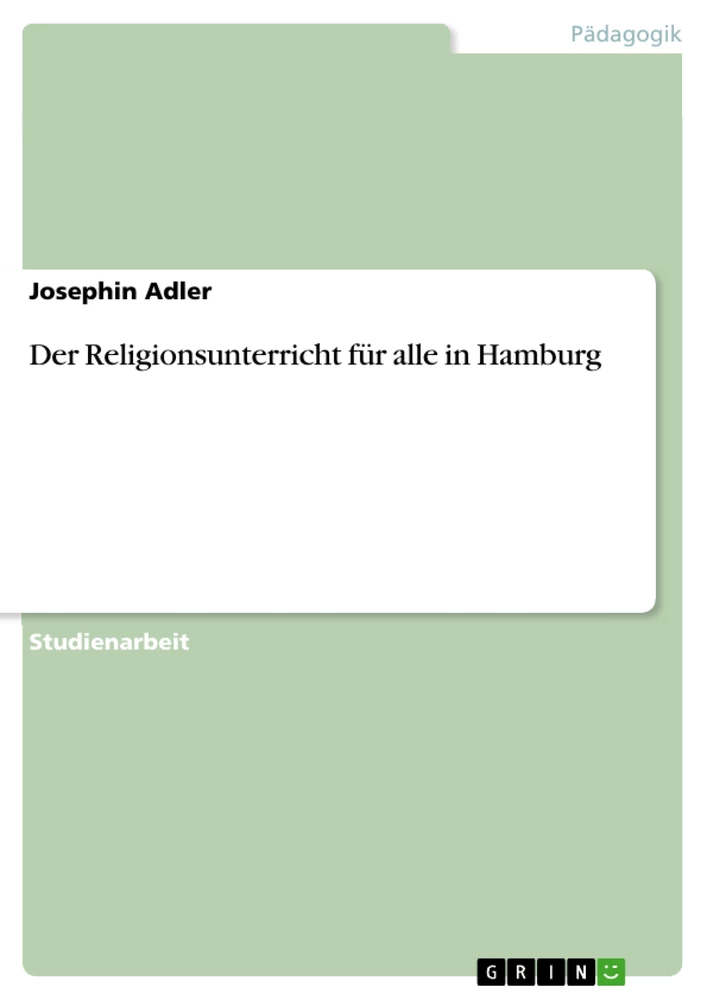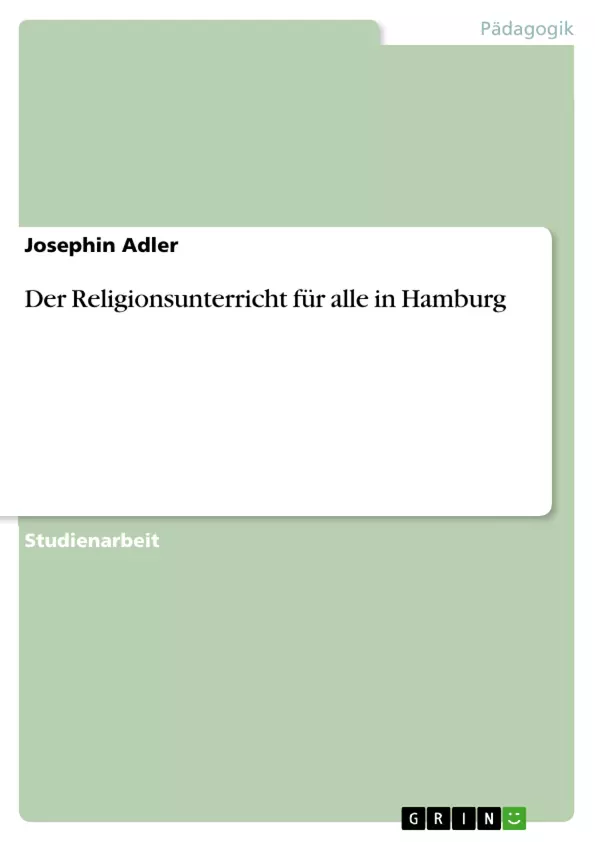In dieser Arbeit soll das Konzept des Dialogischen Religionsunterrichts anhand des Hamburger Modells „Religionsunterricht für alle“ näher beleuchtet und kritisch reflektiert werden. Welchen Beitrag kann dieses Konzept für die gegenwärtige und zukünftige schulische Bildung von Kindern in der Grundschule leisten, um in einer religiös pluralen und globalen Gesellschaft den Grundfragen des menschlichen Daseins und der Sinn- und Werteorientierung nachzukommen? Ebenso soll den Fragen nachgegangen werden, wie durch den „Religionsunterricht für alle“ das Konzept des Dialogischen Religionsunterrichts umgesetzt wird und welche Chancen und Grenzen dieses real umgesetzte Modell bietet sowie der daran anschließenden Frage, inwiefern eine Umsetzung für andere Bundesländer denkbar wäre und an welche Bedingungen dies geknüpft ist.
„Von einer misstrauisch beäugten Variante des Religionsunterrichts am äußersten Rande des verfassungsrechtlich Erlaubten ist er zu einer interessanten, akzeptierten und von vielen sogar geschätzten Alternative zwischen konfessionellem Religionsunterricht und Religionskunde geworden.“ Mit diesen Worten beschreibt Knauth den „Religionsunterricht für alle“ aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Er stellt die Wahrnehmungsentwicklung dieses in den 1990er Jahren entstanden Konzeptes für einen neu gedachten Religionsunterricht an Hamburgs öffentlichen Schulen dar und macht dabei deutlich, dass die anfängliche Polarisierung, die von nahezu jedem neuen Konzept ausgeht, welches traditionelles Denken übersteigt, in eine stabile und anerkannte pädagogische Neuorientierung überging.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der „Religionsunterricht für alle“ in Hamburg – Ein Konzept des Dialogischen Religionsunterrichts
- Standortbestimmungen für den „Religionsunterricht für alle“ in Hamburg
- Zum Begriff des Dialogischen Religionsunterrichts
- Zum Begriff des Interreligiösen Lernens
- Einordnung in die verfassungsrechtliche Situation
- Einordnung in die soziokulturelle Situation
- Historische Einordnung zur Entwicklung des „Religionsunterrichts für alle“
- Konzeptionelle Merkmale und religionspädagogisches Profil des Dialogischen Religionsunterrichts an Hamburger Grundschulen
- Ziele und Aufgaben
- Religionsdidaktische Grundsätze
- Rahmenthemen und Unterrichtsschwerpunkte
- Pädagogische Herausforderungen eines neugedachten Weges
- Pädagogische Chancen eines neugedachten Weges
- Fazit und Ausblick
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Konzept des Dialogischen Religionsunterrichts am Beispiel des Hamburger Modells „Religionsunterricht für alle“. Dabei soll der Mehrwert des Konzeptes für die gegenwärtige und zukünftige Grundschulbildung untersucht werden, insbesondere in Bezug auf die Bewältigung religiöser Pluralität und die Auseinandersetzung mit den Grundfragen des menschlichen Daseins und der Sinn- und Werteorientierung. Darüber hinaus werden die Umsetzung des Dialogischen Religionsunterrichts im Hamburger Modell, seine Chancen und Grenzen sowie die Übertragbarkeit auf andere Bundesländer betrachtet.
- Der „Religionsunterricht für alle“ als Konzept des Dialogischen Religionsunterrichts
- Die Verfassungsrechtliche und soziokulturelle Einordnung des Konzeptes in Hamburg
- Die historischen Entwicklungen und Konzeptionellen Merkmale des Hamburger Modells
- Die pädagogischen Chancen und Herausforderungen des „Religionsunterrichts für alle“
- Die Übertragbarkeit des Modells auf andere Bundesländer
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den „Religionsunterricht für alle“ in Hamburg als ein Konzept des Dialogischen Religionsunterrichts vor und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit.
- Der „Religionsunterricht für alle“ in Hamburg – Ein Konzept des Dialogischen Religionsunterrichts: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den grundlegenden Bestimmungen des „Religionsunterrichts für alle“ in Hamburg, indem es die Konzepte des Dialogischen Religionsunterrichts und des Interreligiösen Lernens erläutert, die verfassungsrechtliche Situation beleuchtet und die soziokulturellen Rahmenbedingungen in Hamburg skizziert.
- Standortbestimmungen für den „Religionsunterricht für alle“ in Hamburg: In diesem Abschnitt werden die Begriffe des Dialogischen Religionsunterrichts und des Interreligiösen Lernens näher definiert. Weiterhin wird die Einordnung des „Religionsunterrichts für alle“ in die verfassungsrechtliche und soziokulturelle Situation Hamburgs erläutert.
- Historische Einordnung zur Entwicklung des „Religionsunterrichts für alle“: Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung des „Religionsunterrichts für alle“ in Hamburg, um die Entstehung und Entwicklung dieses pädagogischen Konzepts nachzuvollziehen.
- Konzeptionelle Merkmale und religionspädagogisches Profil des Dialogischen Religionsunterrichts an Hamburger Grundschulen: Dieses Kapitel beleuchtet die Ziele, Aufgaben, religionsdidaktischen Grundsätze und Unterrichtsschwerpunkte des „Religionsunterrichts für alle“ an Hamburger Grundschulen. Es werden Literatur aus der Entstehungszeit, aktuelle Diskussionen und empirische Befunde berücksichtigt.
- Pädagogische Herausforderungen eines neugedachten Weges: In diesem Abschnitt werden die Herausforderungen aufgezeigt, die mit der Umsetzung des Dialogischen Religionsunterrichts im „Religionsunterricht für alle“ verbunden sind.
- Pädagogische Chancen eines neugedachten Weges: Dieses Kapitel beleuchtet die pädagogischen Chancen, die sich durch die Implementierung des „Religionsunterrichts für alle“ ergeben. Die Analyse bezieht sich auf die Literatur und berücksichtigt aktuelle Diskussionen und empirische Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Dialogischen Religionsunterrichts, insbesondere mit dem „Religionsunterricht für alle“ in Hamburg. Die Arbeit beleuchtet die verfassungsrechtlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen des Konzeptes, seine historischen Entwicklungen und die pädagogischen Chancen und Herausforderungen seiner Umsetzung. Die Arbeit setzt sich mit wichtigen Begriffen wie Dialogischem Religionsunterricht, Interreligiösem Lernen, Religionsdidaktik, Inklusion und Pluralität auseinander. Der Fokus liegt auf der Analyse des „Religionsunterrichts für alle“ als Modell für einen interreligiösen und dialogischen Unterricht in der Grundschule.
- Arbeit zitieren
- Josephin Adler (Autor:in), 2023, Der Religionsunterricht für alle in Hamburg, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1421687