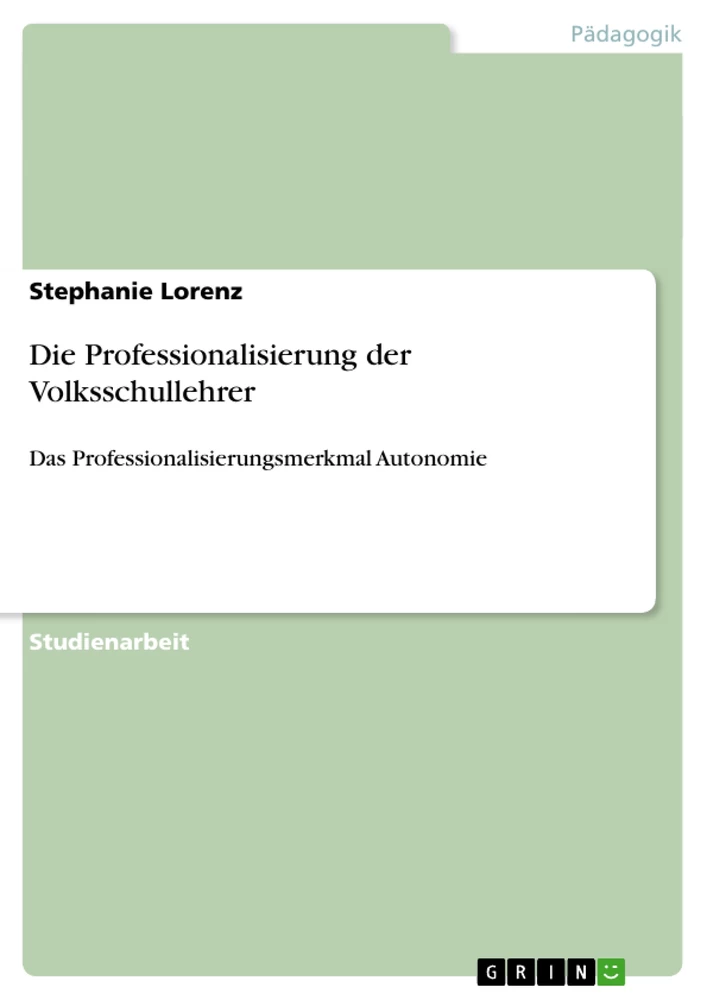Die Diskussionen zur Autonomie von Lehrern gestalten sich durchaus kontrovers. Es ist noch heute nicht eindeutig geklärt, ob Lehrer eine vollständig autonome Stellung einnehmen oder sich in einer Zwischenstellung befinden. Als eines der wichtigsten Merkmale der Professionalisierung gilt die Autonomie. Sie ist ein entscheidender Faktor bei der erfolgreichen Entstehung professioneller Berufe. Dabei muss die Differenzierung der Lehrertypen beachtet werden, denn die Befugnis zur selbständigen Regelung der eigenen rechtlichen und sozialen Verhältnisse blieb Volkschullehrern lange Zeit verwehrt. Gleichzeitig stellt sich überhaupt die Frage, ob einzelne Lehrerstände von heute autonome Felder verwalten. Daher bleibt es unabdingbar, die jeweiligen Professionalisierungen der Lehrertypen voneinander zu trennen. Vorausnehmend, dass Volksschullehrer als gänzlich unautonom galten, sind dennoch wichtige Emanzipationsbestrebungen im historischen Prozess zu verfolgen. Ohne Zweifel blicken Hauptschullehrer auf eine weitaus komplexere Berufsentwicklung zurück. Primär lagen die Gründe dafür in gesellschaftlichen und politischen Prozessen, die mehr oder minder Entwicklungen im Schulsystem bedingten, gegebenenfalls hemmten. Die Forschung setzt hierzu in den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts an. Nicht zuletzt durch starke Interessengruppen, die den Professionalisierungsprozess vorantrieben, gelang schließlich die Durchsetzung des pädagogischen Berufes - Volksschullehrer. Kaum eine Berufsgruppe war so vielfältig politisch und gesellschaftlich betroffen. Durch zahlreiche Einflüsse aus Politik und Ökonomie waren die deutschen Lehrer ständig gezwungen, ihre Stellung neu zu überprüfen oder gar zu korrigieren. Vor allem der schnelle soziale Wandel der Gesellschaft wurde prägend für die Professionalisierung der Volksschullehrer. Unter dem Druck des herrschaftlichen Staatsapparates und der daraus resultierenden Schulentwicklung agierten die Elementarlehrer als Menschen zweiter Klasse. Niederes Sozialprestige, schlechte Arbeitsbedingungen, fehlende Anerkennung in der Gesellschaft und soziale Notlagen beklagten nahezu alle deutschen Volkschullehrer. Jene Probleme beeinflussten zwangsläufig die Professionalisierung und brachten den einfachen Lehrer mitunter an den Rand der Gesellschaft. Schon von Anbeginn ihrer Ausbildung unterstanden sie fortwährend einer Obrigkeit. Ihre politische und soziale Unmündigkeit zeichnete den niederen Status ihresgleichen aus.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Der politische „Knigge“ für Volksschullehrer
- Das Kontrollorgan Geistlichkeit
- Verlust des Ichs durch Ausgrenzung
- Hemmfaktoren der Professionalisierung
- Emanzipationsbewegungen der Elementarlehrer
- Abriss zur Volksschullehrerbildung nach 1945
- Zur Frage der Autonomie
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Professionalisierung der Volksschullehrer im historischen Kontext, insbesondere mit der Frage der Autonomie. Sie analysiert die Entwicklung des Berufes im 19. Jahrhundert und die Faktoren, die die Professionalisierung beeinflussten.
- Der politische Einfluss auf die Volksschullehrer und ihre Ausbildung
- Die Rolle der Geistlichkeit als Kontrollorgan
- Die Herausforderungen und Hemmnisse für die Professionalisierung
- Emanzipationsbewegungen der Elementarlehrer
- Die Frage der Autonomie und ihre Auswirkungen auf den Berufsstand
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit, die Autonomie von Lehrern, vor und beleuchtet den historischen Kontext der Professionalisierung von Volksschullehrern. Sie führt in die Problematik ein, dass Volksschullehrer lange Zeit als unselbstständig und abhängig galten.
- Der politische „Knigge“ für Volksschullehrer: Dieses Kapitel analysiert die politische Steuerung der Volksschullehrer im 19. Jahrhundert. Es wird deutlich, wie der Staat die Rolle des Lehrers als erzieherische Instanz für eine gehorsame und disziplinierte Gesellschaft definierte. Das Kapitel verdeutlicht die stark eingeschränkte Autonomie des Lehrberufs und die Unterwerfung unter staatliche Kontrolle.
- Das Kontrollorgan Geistlichkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der zusätzlichen Kontrolle der Volksschullehrer durch die Kirche. Es zeigt die enge Verknüpfung von Religion und Erziehung im 19. Jahrhundert und die Einflussnahme der Geistlichkeit auf die Ausbildung und den Alltag der Lehrer.
- Verlust des Ichs durch Ausgrenzung: Dieses Kapitel analysiert die sozialen und gesellschaftlichen Folgen der mangelnden Autonomie für Volksschullehrer. Es geht um die schwierigen Arbeitsbedingungen, die geringe Wertschätzung des Berufs und die Ausgrenzung von den höheren Bildungsschichten.
- Hemmfaktoren der Professionalisierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Faktoren, die die Professionalisierung der Volksschullehrer im 19. Jahrhundert behinderten. Es geht um die fehlende Anerkennung, die schlechte Ausbildung und die geringen Aufstiegsmöglichkeiten.
- Emanzipationsbewegungen der Elementarlehrer: Dieses Kapitel schildert die Bemühungen der Volksschullehrer, ihre Position zu verbessern und eine größere Autonomie zu erlangen. Es befasst sich mit den ersten organisierten Initiativen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Wertschätzung des Berufs einsetzten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Professionalisierung des Lehrberufs, insbesondere der Volksschullehrer, mit einem Fokus auf den historischen Kontext des 19. Jahrhunderts. Zentrale Themen sind die Autonomie von Lehrern, die staatliche und kirchliche Kontrolle, die sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen sowie die Emanzipationsbestrebungen des Berufsstandes. Wichtige Schlüsselwörter sind: Volksschullehrer, Elementarlehrer, Autonomie, Professionalisierung, Staat, Kirche, Sozialgeschichte, Bildung, Erziehung, Arbeitsbedingungen, Emanzipation.
- Quote paper
- Stephanie Lorenz (Author), 2001, Die Professionalisierung der Volksschullehrer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/14189