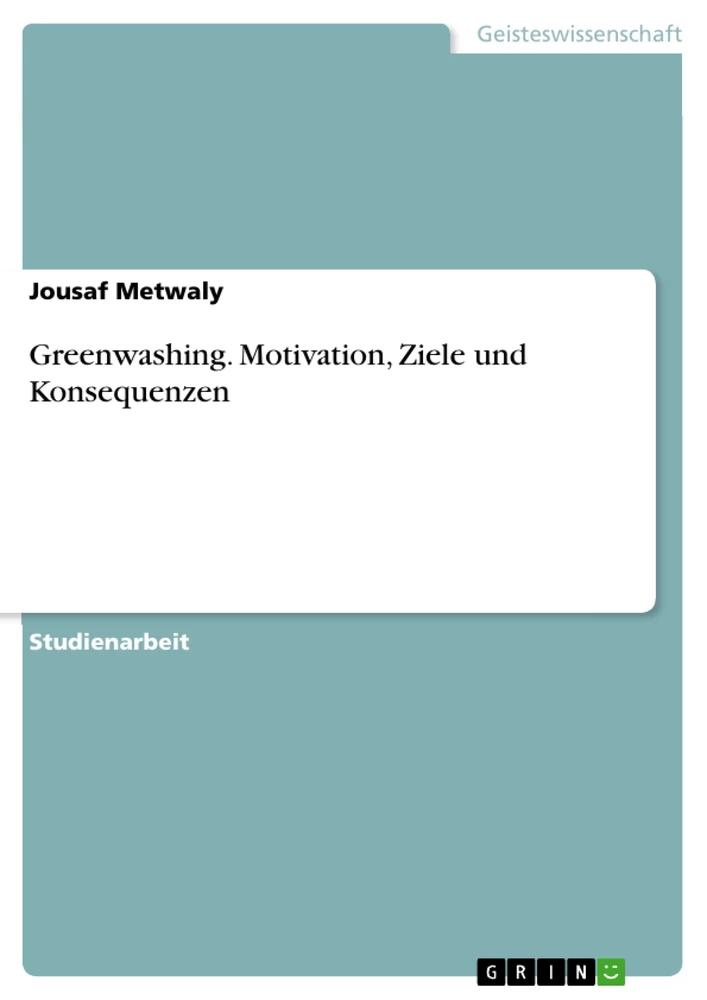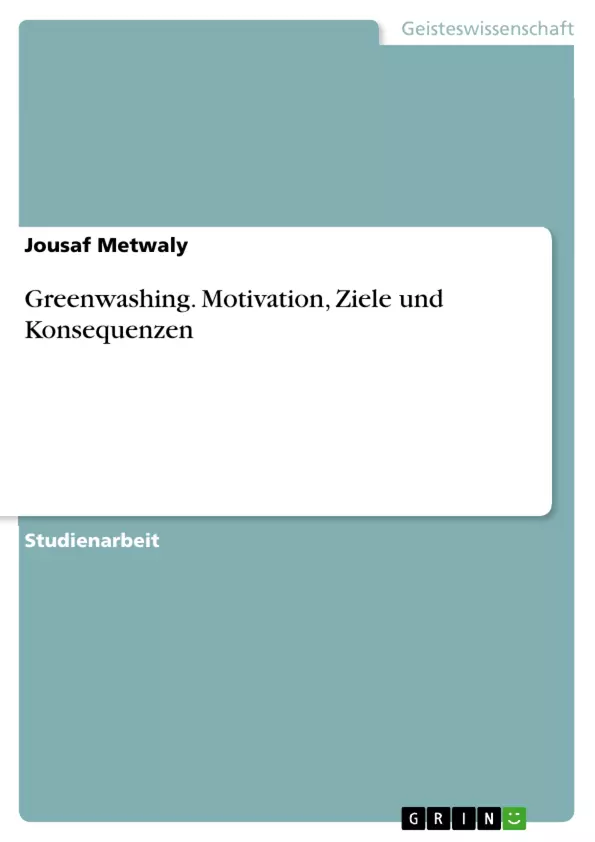Die vorliegende Hausarbeit unternimmt einerseits den Versuch, Beweggründe herauszuarbeiten, die Unternehmen dazu veranlassen, sich in Greenwashing-Aktivitäten zu engagieren und versucht andererseits Gründe zu finden, warum Verbraucher aus einer sozialpsychologischen Sicht anfällig für Greenwashing sind.
In einer Welt, die von zunehmendem Umweltbewusstsein und dem Bestreben nach nachhaltigem Konsum geprägt ist, gewinnt Corporate Social Responsibility (CSR) immer mehr an Bedeutung. Konkret beschreibt der Begriff ein Leitbild, bei dem Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung für das eigene unternehmerische Handeln übernehmen. Zusätzlich zu den rein ökonomischen Gesichtspunkten rücken soziale und ökologische Belange in den Vordergrund, die einen integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie bilden (sollten). Zahlreiche Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und agieren entsprechend, indem sie ihre Handlungen darauf ausrichten.
Andere Unternehmen hingegen entziehen sich der Verantwortung und versuchen durch kreative Marketingmaßnahmen und andere irreführende Praktiken in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image aufzubauen. In der Praxis ist dies unter dem Phänomen des Greenwashings (auf Deutsch „Grünwaschen“ oder „Grünfärben“) bekannt. Wird einem Unternehmen einmal Greenwashing nachgewiesen, können die Folgen irreversibel und schwerwiegend sein. Trotzdem lässt sich in der Praxis eine Vielzahl von Beispielen vorfinden, bei denen Unternehmen scheinbar unbeeindruckt von den potenziellen Auswirkungen ihres Handelns agieren.
Angesichts dieser Tatsache stellt sich die Frage, warum sich Unternehmen in Greenwashing-Aktivitäten engagieren. Was sind ihre Motive? Und warum scheint der Verbraucher trotz zahlreicher Informationsquellen wie dem Internet nicht in der Lage zu sein, Greenwashing-Aktivitäten als solche zu identifizieren?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Motivation
- 2 Greenwashing – Definition und Motive
- 2.1 Wörtliche Herkunft und Definition von Greenwashing
- 2.2 Motive und Treiber von Greenwashing
- 3 Greenwashing in der Praxis: Formen und Konsequenzen
- 3.1 Formen und Ausprägungen von Greenwashing
- 3.2 Tücken der Produktgestaltung: Wie Design den Eindruck von Nachhaltigkeit erweckt
- 3.2.1 Halo-Effekt und Greenwashing: Warum wir Menschen anfällig sind
- 3.2.2 Processing Fluency Theory als weiterer Erklärungsansatz
- 3.3 Folgen von Greenwashing-Aktivitäten
- 4 Maßnahmen zur Eindämmung von Greenwashing-Aktivitäten
- 4.1 Libertärer Paternalismus als Ansatz gegen Greenwashing-Unternehmen
- 4.2 EU-Maßnahmen zur Mitigation irreführender Umweltaussagen
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Phänomen des Greenwashing und erforscht die Beweggründe von Unternehmen, sich in Greenwashing-Aktivitäten zu engagieren. Sie beleuchtet auch die Gründe, warum Verbraucher anfällig für Greenwashing sind, insbesondere durch die Untersuchung der Rolle des Produktdesigns und psychologischer Mechanismen. Die Arbeit untersucht die möglichen Konsequenzen von Greenwashing-Aktivitäten für Unternehmen und die Gesellschaft. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Eindämmung von Greenwashing-Aktivitäten im Rahmen des libertären Paternalismus und der EU-Politik erörtert.
- Motivation von Unternehmen für Greenwashing-Aktivitäten
- Anfälligkeit von Verbrauchern für Greenwashing
- Konsequenzen von Greenwashing
- Maßnahmen zur Eindämmung von Greenwashing
- Rolle des Produktdesigns und psychologischer Mechanismen bei Greenwashing
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 erläutert die Motivation für die Untersuchung des Greenwashing-Phänomens im Kontext des wachsenden Umweltbewusstseins und der Bedeutung von Corporate Social Responsibility. Kapitel 2 definiert Greenwashing und untersucht die dahinterliegenden Motive, sowohl marktbezogene externe Faktoren wie die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten als auch interne Faktoren wie die Unternehmensstruktur. Kapitel 3 analysiert Formen und Ausprägungen von Greenwashing in der Praxis, insbesondere die Rolle des Produktdesigns und die dahinterstehenden psychologischen Mechanismen, die Verbraucher anfällig für Greenwashing machen. Kapitel 4 erörtert Maßnahmen zur Eindämmung von Greenwashing-Aktivitäten, wobei der libertäre Paternalismus und EU-Maßnahmen im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Greenwashing, Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility, Umweltleistung, Produktdesign, Halo-Effekt, Processing Fluency Theory, Libertärer Paternalismus, EU-Politik.
- Arbeit zitieren
- Jousaf Metwaly (Autor:in), 2023, Greenwashing. Motivation, Ziele und Konsequenzen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1408104