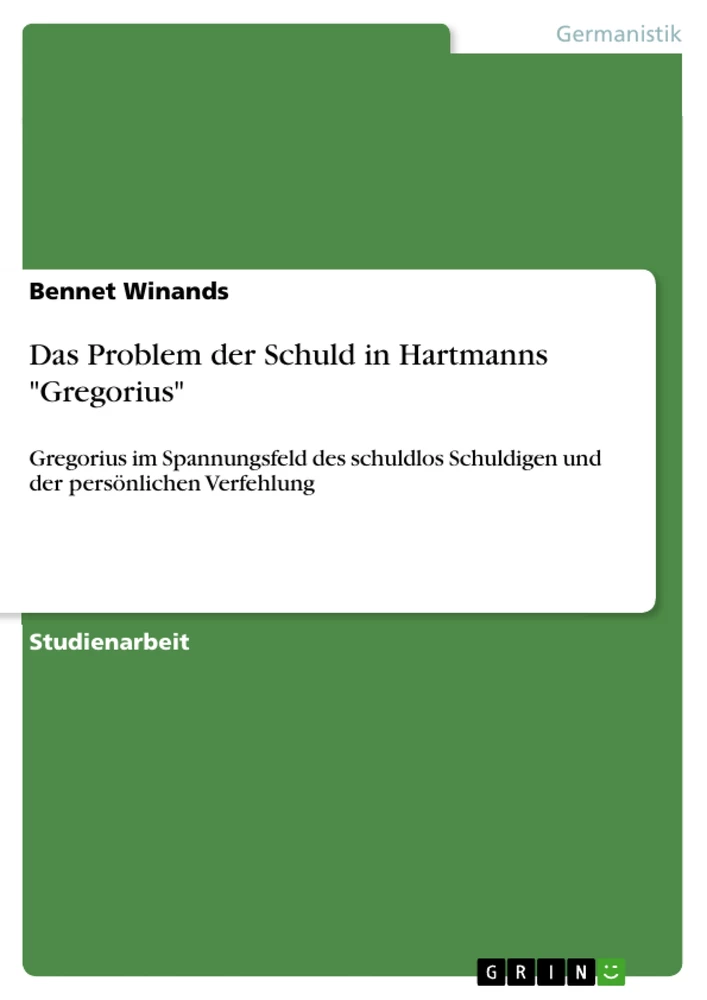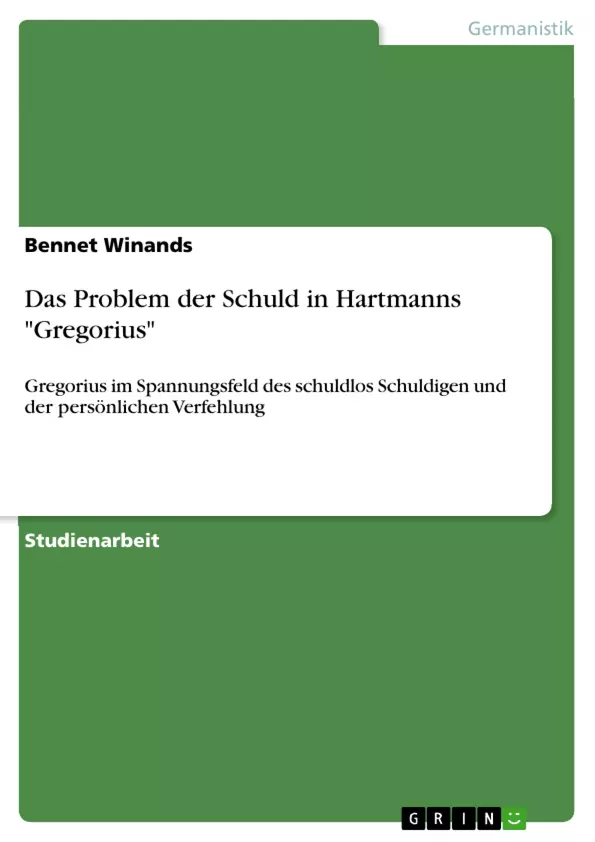Seit Erscheinen der ersten kritischen Ausgabe des Gregorius im Jahr 1838 durch Karl Lachmann unterlag dieses Werk Hartmanns von Aue zahlreichen Interpretationsansätzen der Forschung. Obwohl „die Buße im Zentrum der höfischen Legende steht“ und nicht die Schuld, liegt das Hauptaugenmerk zahlreicher Interpretationen dabei trotzdem auf der Frage nach der Schuld im Gregorius.
Für die Beantwortung dieser Frage bieten sich vermutlich ebenso viele Lösungen an, wie es Interpretationen gibt – und diese sind wiederum abhängig von den ihnen zugrundeliegenden Überlieferungen, deren Vielzahl und Unüberschaubarkeit schon Konrad Zwierzina wie folgt kommentierte: „,Über den ausgaben des Gregorius waltet ein besonderes misgeschick. alle werden sie nicht lange zeit nach ihrem erscheinen durch neue funde besserungsbedürftig.’“
Da sich Tomaseks und Gössmanns Einteilungen der Forschungsergebnisse in vielen Punkten decken, sollen im Folgenden die zwei Gruppierungen der literaturwissenschaftlichen Interpretation bzw. des Gregorius als schuldlos Schuldigen und der theologisierenden Interpretation bzw. Gregorius als Sünder mit persönlichen Verfehlungen vorgestellt und ihre Argumente genannt und gegenübergestellt werden. Von einer Klärung des Sachverhaltes des Schuldproblems im Gregorius soll hingegen abgesehen werden, da dies den Rahmen einer Seminararbeit schlicht überschreiten würde, jedoch wird sich im Fazit zeigen, dass manche Interpretationsansätze klar widerlegt wurden und manche Interpretationen schlüssiger argumentiert sind als andere.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gregorius als schuldlos Schuldiger – die literaturwissenschaftliche Interpretation
- Persönliche Verfehlungen des Gregorius - die theologisierende Interpretation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Problem der Schuld in Hartmanns von Aues Gregorius. Sie analysiert verschiedene literaturwissenschaftliche und theologische Interpretationsansätze, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob Gregorius als schuldlos Schuldiger oder als Sünder mit persönlichen Verfehlungen zu betrachten ist. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gegenüberstellung dieser beiden Hauptgruppen von Interpretationen, ohne jedoch eine definitive Klärung des Schuldproblems zu liefern.
- Die literaturwissenschaftliche Interpretation des Gregorius als schuldlos Schuldiger
- Die theologisierende Interpretation des Gregorius als Sünder mit persönlichen Verfehlungen
- Die unterschiedlichen Argumentationsweisen beider Interpretationsansätze
- Analyse der verwendeten Quellen und ihrer Interpretationen
- Bewertung der Schlüssigkeit verschiedener Interpretationsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die vielfältigen und sich widersprechenden Interpretationsansätze zum Schuldproblem in Hartmanns Gregorius seit der ersten kritischen Ausgabe von 1838. Sie führt die Debatte um Gregorius als schuldlos Schuldigen oder als Sünder mit persönlicher Schuld ein und verweist auf die unterschiedlichen Forschungspositionen von Tomasek und Gössmann, die in der Arbeit weiter untersucht werden. Die Einleitung skizziert den Fokus auf die literaturwissenschaftliche und theologisierende Interpretation und kündigt an, dass im Fazit die Schlüssigkeit der verschiedenen Ansätze bewertet werden soll.
2. Gregorius als schuldlos Schuldiger – die literaturwissenschaftliche Interpretation: Dieses Kapitel beleuchtet literaturwissenschaftliche Interpretationen, die eine persönliche Schuld Gregorius' ablehnen, da diese nicht explizit im Text belegt sei. Es wird die Argumentation von Günther Zuntz vorgestellt, der Hartmanns Darstellung des Inzests als humanistisch interpretiert und die Abwesenheit von Abscheu oder Grauen betont, um die These einer fehlenden persönlichen Schuld zu untermauern. Weitere Autoren wie K. C. King und Tonomura werden zitiert, die durch Textanalysen – z.B. die Interpretation der Tafelinschrift bei King – zu dem Schluss kommen, dass Gregorius keine persönliche Schuld trägt und Hartmann eher volkstümliche Meinungen als kirchliche Lehren vermittelt. Tomas Tomasek wird als Ausnahme erwähnt, da er, obwohl literaturwissenschaftlich argumentierend, zu einem anderen Ergebnis gelangt.
3. Persönliche Verfehlungen des Gregorius - die theologisierende Interpretation: Dieses Kapitel (wenngleich nicht explizit im gegebenen Text vollständig vorhanden) würde die theologischen Interpretationen vorstellen, die Gregorius eine persönliche Schuld vor dem Inzest zuschreiben. Die Argumentation dieser Interpretation würde vermutlich auf religiösen Texten und Konzepten basieren, um die vorangegangene Schuld Gregorius' zu belegen und diese als Ursache für den Inzest darzustellen. Es würden detailliert die theologischen Argumente und ihre Anwendung auf den Text präsentiert und die gegensätzlichen Standpunkte zur literaturwissenschaftlichen Interpretation herausgearbeitet werden. Die Bedeutung dieser theologischen Perspektive für das Verständnis des Werkes würde diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Hartmann von Aue, Gregorius, Schuldproblem, literaturwissenschaftliche Interpretation, theologisierende Interpretation, schuldlos Schuldiger, persönliche Verfehlung, Inzest, Buße, volkstümliche Meinung, kirchliche Lehre, Textanalyse, Interpretation.
Hartmann von Aues Gregorius: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Schuldproblem in Hartmanns von Aues Gregorius. Sie analysiert verschiedene literaturwissenschaftliche und theologische Interpretationsansätze, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob Gregorius als schuldlos Schuldiger oder als Sünder mit persönlichen Verfehlungen zu betrachten ist.
Welche Interpretationsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht hauptsächlich zwei Gruppen von Interpretationen: die literaturwissenschaftliche Interpretation, die Gregorius als schuldlos Schuldigen darstellt, und die theologisierende Interpretation, die ihm persönliche Verfehlungen vorwirft. Es wird die Argumentation beider Ansätze analysiert und deren Schlüssigkeit bewertet.
Wie wird der literaturwissenschaftliche Ansatz dargestellt?
Der literaturwissenschaftliche Ansatz argumentiert, dass Gregorius' Schuld nicht explizit im Text belegt ist. Autoren wie Zuntz, King und Tonomura werden zitiert, die durch Textanalysen zu dem Schluss kommen, dass Gregorius keine persönliche Schuld trägt und Hartmann eher volkstümliche Meinungen als kirchliche Lehren vermittelt. Tomasek wird als Ausnahme genannt, da er trotz literaturwissenschaftlicher Argumentation zu einem anderen Ergebnis gelangt.
Wie wird der theologisierende Ansatz dargestellt?
Der theologisierende Ansatz (obwohl im gegebenen Text nicht vollständig ausgeführt) würde argumentieren, dass Gregorius eine persönliche Schuld vor dem Inzest trägt. Diese Argumentation würde auf religiösen Texten und Konzepten basieren und die vorangegangene Schuld Gregorius' als Ursache für den Inzest darstellen. Die gegensätzlichen Standpunkte zur literaturwissenschaftlichen Interpretation würden herausgearbeitet werden.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über die literaturwissenschaftliche Interpretation von Gregorius als schuldlos Schuldigen, ein Kapitel über die theologisierende Interpretation, welche Gregorius persönliche Verfehlungen zuschreibt, und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die verschiedenen Interpretationsansätze und skizziert den Fokus der Arbeit.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit zitiert unter anderem Günther Zuntz, K. C. King, Tonomura und Tomasek. Die Zitate dienen dazu, die verschiedenen Interpretationsansätze zu belegen und zu veranschaulichen.
Welches ist das zentrale Problem der Arbeit?
Das zentrale Problem ist die Klärung der Frage nach Gregorius' Schuld. Die Arbeit zielt nicht darauf ab, eine definitive Antwort zu geben, sondern die verschiedenen Argumentationslinien und deren Schlüssigkeit zu analysieren und zu vergleichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Hartmann von Aue, Gregorius, Schuldproblem, literaturwissenschaftliche Interpretation, theologisierende Interpretation, schuldlos Schuldiger, persönliche Verfehlung, Inzest, Buße, volkstümliche Meinung, kirchliche Lehre, Textanalyse, Interpretation.
- Quote paper
- Bennet Winands (Author), 2018, Das Problem der Schuld in Hartmanns "Gregorius", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1406297