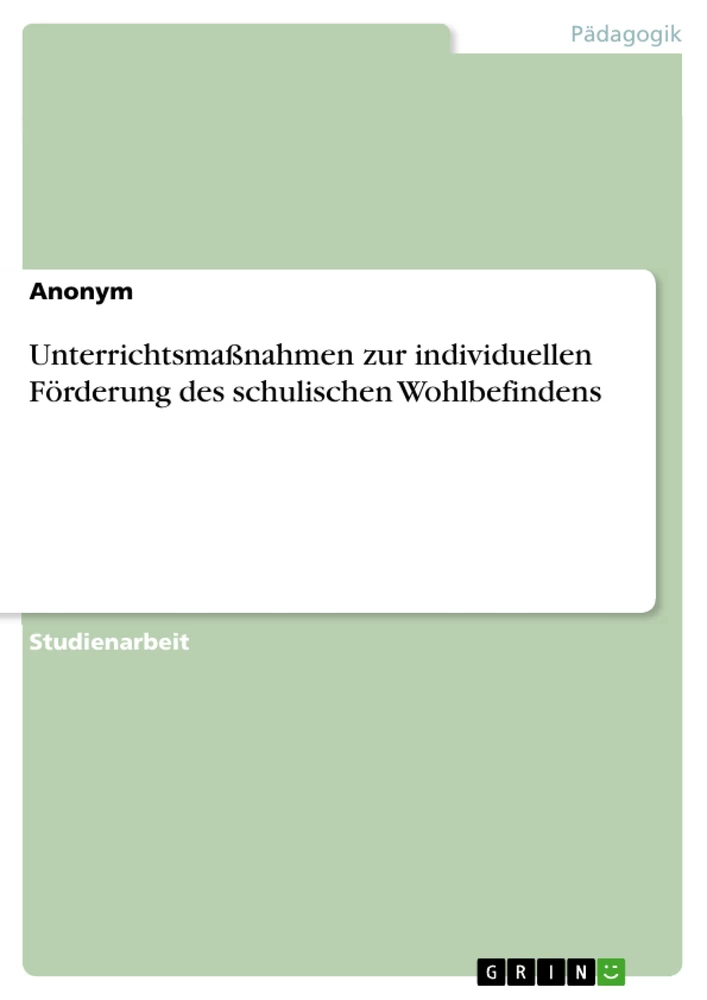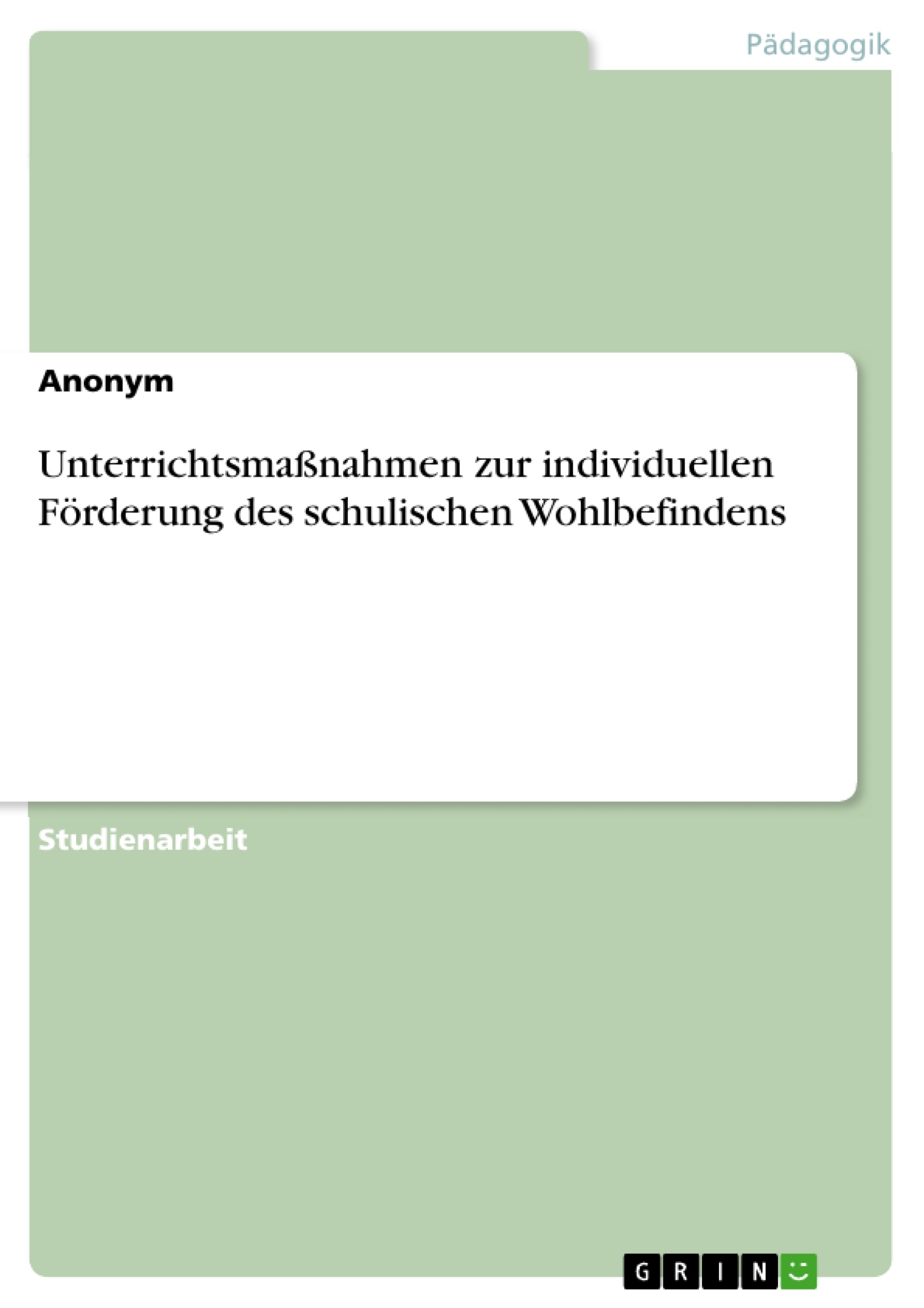Diese Arbeit stellt mögliche Ursachen im Rahmen der Unterrichtsgestaltung sowie schulexterner Prädiktoren für das Auftreten bestimmter Gemütszustände dar.
Bereits in der Grundschule sammeln Kinder soziale und emotionale Erfahrungen für ihren zukünftigen Bildungsweg. Sie lernen zum einen die Institution Schule mit deren Lern- bzw. Arbeitsformen kennen und entwickeln zum anderen eine grundlegende Arbeitsmoral, in der sich ihre jeweiligen Einstellungen gegenüber der Schule widerspiegeln. Jedes Kind hat eine
bestimmte Erwartungshaltung, geprägt von Hoffnungen und Pflichten, jedoch auch von Unsicherheiten hinsichtlich des Verständnisses von Schule. Resultierend bauen sich positive, aber auch negative Emotionen auf, welche das Lernverhalten bestimmen. In diesem Sinne stehen Lehrer_innen (LuL) pädagogisch-didaktisch vor der Herausforderung, die
Unterrichtsgestaltung zugunsten des Wohlbefindens der Schüler_innen (SuS) auszurichten.
Der World Vision Kinderstudie des Jahres 2013 sowie dem LBS Kinderbarometer aus 2020 ist zu entnehmen, dass Lernende ab der Grundschulzeit zunehmend ein negatives Wohlbefinden entwickeln. Aus eigener aktueller Erfahrung und Erlebnissen meiner Grundschulzeit, ist mir rückblickend bewusst geworden, von welcher Relevanz die Schulzufriedenheit und der damit
einhergehende Einbezug der Interessen eines jeden Kindes für erfolgreiches Lernen sind. Ich habe im Praxissemester beobachtet, dass insbesondere leistungsschwache Kinder zurückhaltend sind und sich aufgrund ihrer Defizite schämen, sodass ihr Gemütszustand ungewollt von den LuL nicht wahrgenommen wird. Diese Umstände weckten bei mir das
Interesse, auch vor dem Hintergrund von persönlichen Anforderungen an meine zukünftige berufliche Tätigkeit, anhand der Untersuchung des subjektiven schulischen Wohlbefindens von Grundschulkindern einer zweiten Klasse Maßnahmen zur individuellen Förderung zu eruieren. Hierzu gilt es, mithilfe der Auffassungen von Hascher (2018) zu bestimmen, unter
welchen Gesichtspunkten das schulische Wohlbefinden festzulegen ist und welche Faktoren dieses wechselseitig beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen der Fragestellung
- 2.1 Konzeptionen des schulischen Wohlbefindens
- 2.2 Prädiktoren
- 3. Forschungsstand
- 4. Forschungsmethodik
- 4.1 Forschungsdesign
- 4.2 Darstellung der Ergebnisse
- 4.3 Ergebnisinterpretation
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des subjektiven schulischen Wohlbefindens von Grundschulkindern einer zweiten Klasse. Im Fokus steht die Ermittlung von Maßnahmen zur individuellen Förderung, die dem angenehmen Lernen Rechnung tragen. Hierfür wird der theoretische Rahmen des schulischen Wohlbefindens nach Hascher (2018) herangezogen, um die Bedeutung des Wohlbefindens für die Unterrichtsgestaltung zu verdeutlichen.
- Konzeptionen des schulischen Wohlbefindens: Die Arbeit beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze zum schulischen Wohlbefinden und untersucht deren Relevanz für das Lernen und die pädagogische Praxis.
- Einflussfaktoren auf das schulische Wohlbefinden: Die Arbeit identifiziert und analysiert Prädiktoren des schulischen Wohlbefindens, sowohl interne Faktoren wie Unterrichtsgestaltung und Schulklima als auch externe Faktoren wie familiäre und gesellschaftliche Einflüsse.
- Individuelle Förderung: Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung individueller Förderung im Kontext des schulischen Wohlbefindens und untersucht, wie Unterrichtsmaßnahmen an die Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen der Kinder angepasst werden können.
- Empirische Untersuchung: Die Arbeit basiert auf einer eigenen Forschung zum schulischen Wohlbefinden, die Erkenntnisse aus einem Fragebogen und einer theoriebezogenen Auswertung liefert.
- Unterrichtspraktische Konsequenzen: Die Arbeit leitet aus den Forschungsergebnissen unterrichtspraktische Konsequenzen für die Förderung des schulischen Wohlbefindens ab.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird das Thema des subjektiven schulischen Wohlbefindens von Grundschulkindern eingeführt und die Relevanz des Themas für die Unterrichtsgestaltung dargelegt. Das zweite Kapitel beleuchtet den theoretischen Rahmen der Fragestellung. Hier werden verschiedene Konzeptionen des schulischen Wohlbefindens vorgestellt und deren Einflussfaktoren diskutiert. Die Forschungsmethodik wird im vierten Kapitel beschrieben, wobei der Fokus auf dem Forschungsdesign und der Analyse der Ergebnisse liegt. Schließlich werden im fünften Kapitel die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und unterrichtspraktische Konsequenzen für die Förderung des schulischen Wohlbefindens abgeleitet.
Schlüsselwörter
Schulische Wohlbefinden, subjektive Wahrnehmung, Grundschule, Unterrichtsgestaltung, individuelle Förderung, Prädiktoren, empirische Forschung, Theorie-Praxis-Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter schulischem Wohlbefinden?
Schulisches Wohlbefinden umfasst nach Hascher (2018) emotionale, soziale und kognitive Aspekte, die das subjektive Empfinden von Schülern in ihrer Lernumwelt bestimmen.
Warum sinkt das Wohlbefinden oft ab der Grundschulzeit?
Studien wie das LBS Kinderbarometer zeigen, dass steigender Leistungsdruck, soziale Vergleiche und unzureichende Berücksichtigung individueller Interessen zu negativen Emotionen führen können.
Welche Maßnahmen fördern das Wohlbefinden im Unterricht?
Individuelle Förderung, die Einbeziehung der Schülerinteressen, ein positives Schulklima und die Vermeidung von Beschämung bei Leistungsschwächen sind zentrale Maßnahmen.
Welche Rolle spielen Lehrer für das Gemüt der Kinder?
Lehrer stehen vor der Herausforderung, auch zurückhaltende oder leistungsschwache Kinder wahrzunehmen und den Unterricht pädagogisch-didaktisch so zu gestalten, dass Wohlbefinden möglich wird.
Was sind schulexterne Prädiktoren für das Wohlbefinden?
Dazu gehören das familiäre Umfeld, gesellschaftliche Erwartungen und die allgemeine Freizeitgestaltung außerhalb der Institution Schule.
Wie wurde das Wohlbefinden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung einer zweiten Grundschulklasse mittels Fragebögen und einer theoriebezogenen Auswertung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Unterrichtsmaßnahmen zur individuellen Förderung des schulischen Wohlbefindens, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1398728