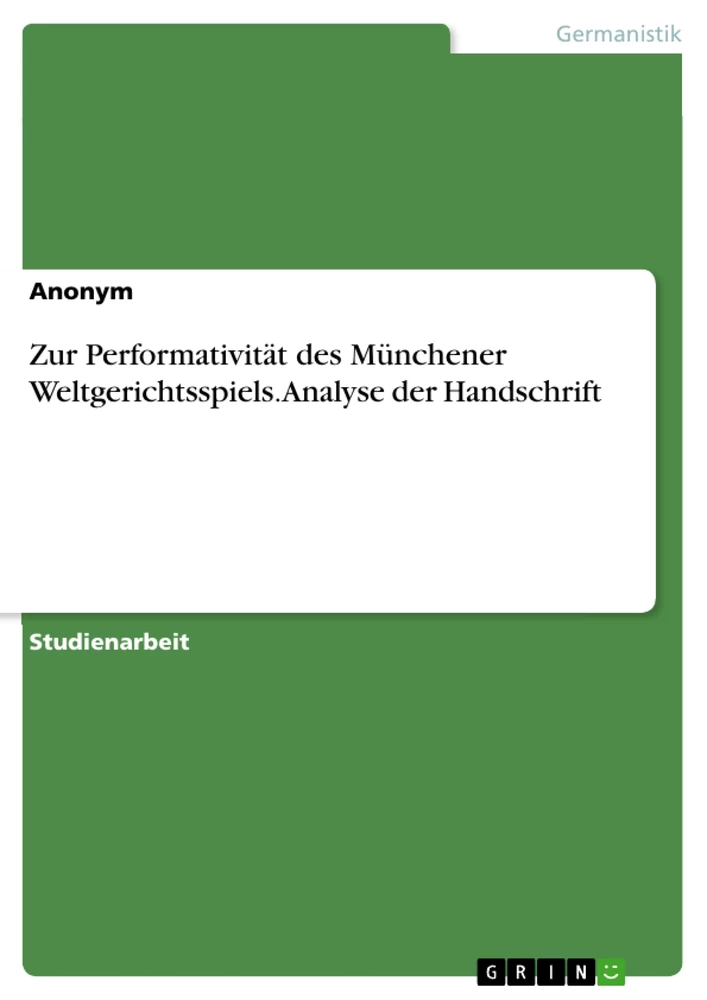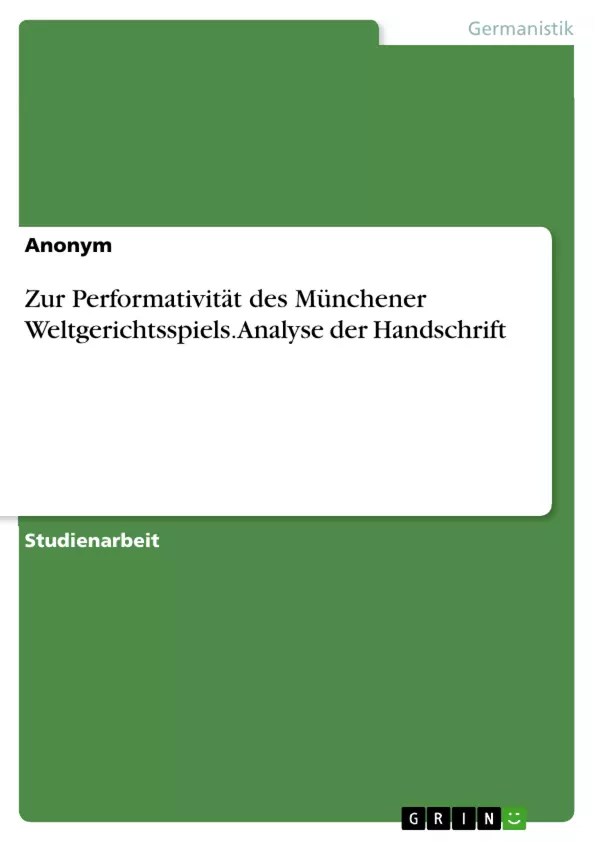In dieser Arbeit soll die Performativität des Münchener Weltgerichtsspiels näher analysiert werden. Bei der Handschrift des Münchener Weltgerichtsspiels handelt es sich um einen Sonderfall. Es ist zwar eine Lesehandschrift, trotzdem wurde das Spiel tatsächlich aufgeführt.
Der erste Teil widmet sich der terminologischen Klärung. Im Fokus des zweiten Kapitels steht die bereits vorhandene Forschung zum Münchener Weltgerichtsspiel. Schließlich wird eine eigene Analyse des Textes durchgeführt, in welcher die Gliederung des Spiels, die Figuren, deren Emotionalität und Dialogizität und die intendierte Wirkung nach außen untersucht werden. Ein Fazit beschließt die Arbeit.
Forschende streiten sich bei vielen Handschriften um die Funktion dieser. Handelt es sich um eine Dirigierrolle, welche benutzt wurde, um ein Spiel auf die Bühne zu bringen, oder handelt es sich vielmehr um eine Lesehandschrift? Das Münchener Weltgerichtsspiel ist eine Handschrift von 1510. Das durch Propheten angekündigte Jüngste Gericht wird in diesem Spiel dargestellt. Im Weltgerichtsspiel ist die Gerichtsszene viel ausgeschmückter, als in der ihm zugrunde liegenden Vorlage, der Johannisoffenbarung, während Vorlauf und Anzeichen des Weltenendes nur kurz zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Performativität – zu einem problematischen Begriff
- 2.1. Unterscheidung zwischen struktureller und funktionaler Performativität
- 2.2. Performativität in der Mediävistik
- 3. Forschung zu den Weltgerichtsspielen
- 3.1. Beschaffenheit der Aufführungen
- 4. Das Münchener Weltgerichtsspiel
- 4.1. Gliederung
- 4.2. Dialogizität
- 4.3. Angestrebte funktionale Performativität
- 4.3.1. Emotionalität
- 4.3.2. Die Precursoren / Proclamatoren
- 4.3.3. Die Angeklagten
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Performativität des Münchener Weltgerichtsspiels von 1510. Sie klärt zunächst den vielschichtigen Begriff der Performativität und beleuchtet den Forschungsstand zu Weltgerichtsspielen. Die Hauptanalyse untersucht dann das Münchener Weltgerichtsspiel selbst, fokussiert auf seine Struktur, die Figuren, deren Emotionalität und Dialogizität sowie die beabsichtigte Wirkung.
- Klärung des Begriffs Performativität und seiner Anwendung auf mittelalterliche Texte
- Analyse der Aufführungspraktiken von Weltgerichtsspielen
- Untersuchung der Struktur und der Figuren des Münchener Weltgerichtsspiels
- Analyse der Dialogizität und Emotionalität im Spiel
- Rekonstruktion der beabsichtigten Wirkung des Spiels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Performativität des Münchener Weltgerichtsspiels, einer Handschrift aus dem Jahr 1510, in den Mittelpunkt. Sie hebt den Sonderstatus dieser Handschrift hervor, da es sich zwar um eine Lesehandschrift handelt, das Spiel aber tatsächlich aufgeführt wurde. Die Arbeit gliedert sich in eine terminologische Klärung des Begriffs Performativität, eine Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand und eine eigene Textanalyse, die Struktur, Figuren, Emotionalität, Dialogizität und die beabsichtigte Wirkung untersucht.
2. Performativität - zu einem problematischen Begriff: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Verständnisse des Begriffs „Performativität“. Es differenziert zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven (Sprachphilosophie, Sozialwissenschaften, Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft), zeigt die Heterogenität des Begriffs auf und legt die für die Arbeit relevante Definition fest. Es wird auf die Unterscheidung zwischen Performanz und Performativität eingegangen und die verschiedenen Theorien und Ansätze von Austin, Butler, Fischer-Lichte und anderen diskutiert, um ein fundiertes Verständnis für die spätere Analyse zu schaffen. Die verschiedenen Perspektiven auf Performativität in der Literaturwissenschaft werden ebenso behandelt, sowohl die breite Perspektive auf Wirkung und Verwendung als auch die engere auf Textstrukturen und -elemente.
3. Forschung zu den Weltgerichtsspielen: Dieses Kapitel würde die existierende Forschung zu Weltgerichtsspielen zusammenfassen und analysieren. Es würde die verschiedenen Ansätze und Methoden der Forschung präsentieren, bestehende Interpretationen der Stücke und die zentralen Debatten innerhalb des Forschungsfeldes beleuchten. Die Kapitel würde einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung bieten und die eigene Arbeit in diesem Kontext einordnen.
4. Das Münchener Weltgerichtsspiel: Dieses Kapitel befasst sich mit der detaillierten Analyse des Münchener Weltgerichtsspiels. Es würde die Gliederung des Spiels untersuchen, die wichtigsten Figuren analysieren, deren Dialogizität und Emotionalität betrachten und die intendierte Wirkung des Stücks auf das Publikum rekonstruieren. Dabei wird die besondere Rolle des einleitenden Satzes ("Got zu lob, dem menschen zu pesserung...") berücksichtigt, welcher die Aufführungsintention des Spiels unterstreicht. Die Analyse wird verschiedene Aspekte des Dramas beleuchten, um ein vollständiges Bild des Stücks und seiner Performativität zu geben.
Schlüsselwörter
Performativität, Weltgerichtsspiel, München, Mittelalter, Theater, Dramaturgie, Dialogizität, Emotionalität, Handschrift, Johannesoenbarung, Aufführungspraktiken, mittelalterliches Theater, soziale Wirkung, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zum Münchener Weltgerichtsspiel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Performativität des Münchener Weltgerichtsspiels von 1510. Sie untersucht die Struktur, die Figuren, deren Emotionalität und Dialogizität sowie die beabsichtigte Wirkung des Spiels. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, wie der Text in seiner Aufführungspraktik wirkte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Klärung des Begriffs „Performativität“ und dessen Anwendung auf mittelalterliche Texte, Analyse der Aufführungspraktiken von Weltgerichtsspielen, Untersuchung der Struktur und der Figuren des Münchener Weltgerichtsspiels, Analyse der Dialogizität und Emotionalität im Spiel sowie Rekonstruktion der beabsichtigten Wirkung des Spiels. Es wird zwischen struktureller und funktionaler Performativität unterschieden.
Wie wird der Begriff „Performativität“ definiert und verwendet?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Verständnisse des Begriffs „Performativität“, unterscheidet zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven (Sprachphilosophie, Sozialwissenschaften, Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft) und diskutiert Theorien und Ansätze von Austin, Butler, Fischer-Lichte u.a.. Es wird eine für die Analyse relevante Definition festgelegt und die Unterscheidung zwischen Performanz und Performativität herausgearbeitet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Performativität – zu einem problematischen Begriff, Forschung zu den Weltgerichtsspielen, Das Münchener Weltgerichtsspiel und Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Kapitel 2 klärt den Begriff der Performativität. Kapitel 3 fasst den Forschungsstand zu Weltgerichtsspielen zusammen. Kapitel 4 analysiert detailliert das Münchener Weltgerichtsspiel (Struktur, Figuren, Dialogizität, Emotionalität, beabsichtigte Wirkung). Das Fazit rundet die Arbeit ab.
Was ist das Besondere am Münchener Weltgerichtsspiel?
Das Münchener Weltgerichtsspiel aus dem Jahr 1510 ist eine Lesehandschrift, die aber tatsächlich aufgeführt wurde. Dieser Sonderstatus macht sie für die Analyse der Performativität besonders interessant. Die Arbeit untersucht die Handschrift auf ihre Aufführungspraktiken und beabsichtigte Wirkung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus Literaturrecherche, Textanalyse und Interpretation. Der Fokus liegt auf der Analyse des Münchener Weltgerichtsspiels selbst, wobei Struktur, Figuren, Dialogizität und Emotionalität detailliert untersucht werden, um die beabsichtigte Wirkung zu rekonstruieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Performativität, Weltgerichtsspiel, München, Mittelalter, Theater, Dramaturgie, Dialogizität, Emotionalität, Handschrift, Johannesoenbarung, Aufführungspraktiken, mittelalterliches Theater, soziale Wirkung, Kommunikation.
Wo finde ich weitere Informationen zu Weltgerichtsspielen?
Kapitel 3 der Arbeit gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Weltgerichtsspielen und ordnet die eigene Arbeit in diesen Kontext ein. Weitere Informationen können durch gezielte Literaturrecherche zu diesem Thema gewonnen werden.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Zur Performativität des Münchener Weltgerichtsspiels. Analyse der Handschrift, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1398082