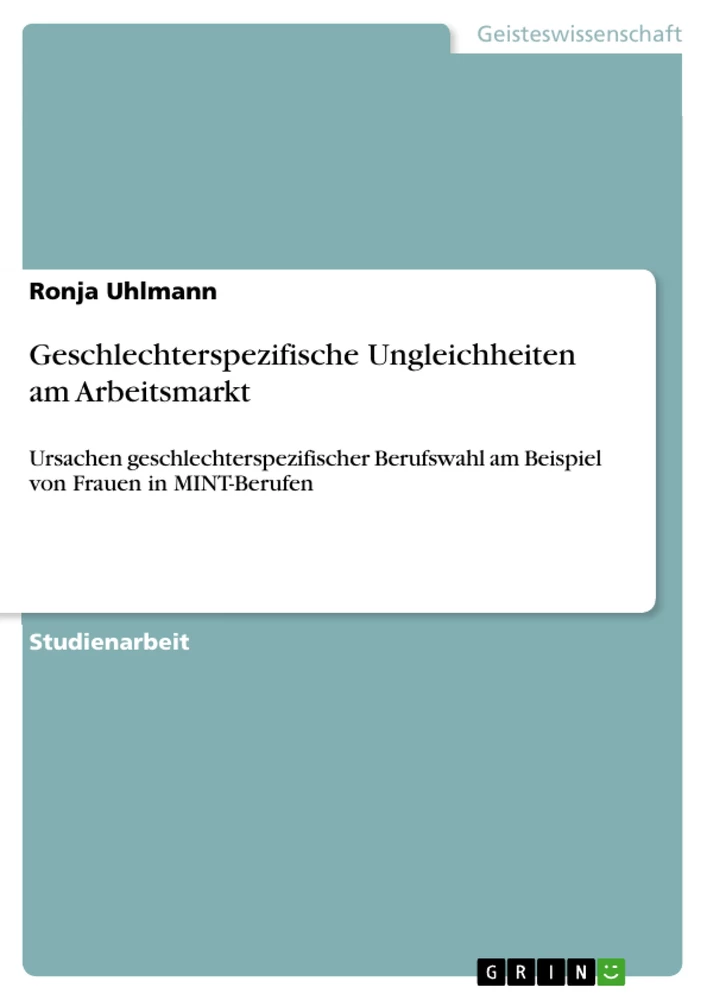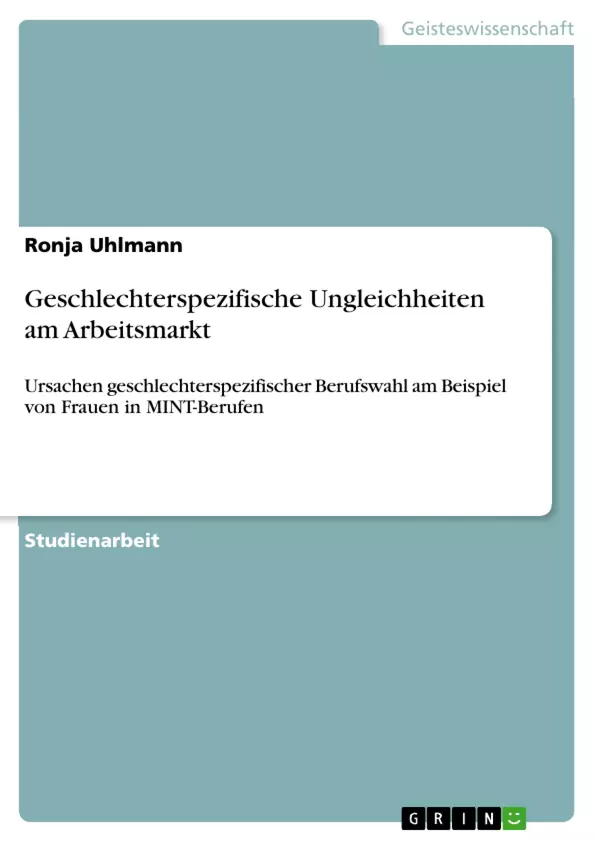Berufliche Segregation von Männern und Frauen ist ein bis heute anhaltendes Merkmal von westlich-europäischen Gesellschaften. Durch eine geschlechtsspezifische Berufswahl und -ausübung werden soziale Ungleichheiten weiter reproduziert, da Frauenberufe im Gegensatz zu Männerberufen häufig schlechter bezahlt sind und weniger Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Geschlechterspezifische Ungleichheiten können dabei anhand von zwei Achsen betrachtet werden: der horizontalen und der vertikalen. Horizontale Ungleichheit beschreibt, dass Männer und Frauen unterschiedliche Karrieren und Berufe wählen. Vertikale Ungleichheit besteht hingegen dann, wenn Männer und Frauen in denselben Berufen und Karrierezweigen unterschiedlich behandelt werden (z.B. in Hinblick auf Lohn oder Prestige). Um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, ist es also wichtig zu betrachten, wie diese beruflichen Geschlechterunterschiede zustande kommen.
In dieser Arbeit sollen daher die im Seminar besprochenen Theorien zu geschlechterspezifischen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt zusammengefasst und um Kritik und Alternativen ergänzt werden. Dabei steht immer die geschlechterspezifische Berufswahl – also die horizontale Ungleichheitsdimension –im Fokus. Es sollen die folgenden Fragen geklärt werden: Wie unterscheidet sich die Berufswahl je nach Geschlecht? Welche Ursachen hat die unterschiedliche Berufswahl von Männern und Frauen? Ein besonderer Fokus liegt dabei darauf, warum so wenig Frauen im MINT-Bereich beschäftigt sind. Im ersten Kapitel 2.1 wird daher die aktuelle berufliche Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt mit Fokus auf MINT-Berufe betrachtet. Anschließend in Kapitel 2.2 sollen die Ursachen der beruflichen Segregation nach Geschlecht anhand der im Seminar besprochenen Theorien (Humankapital, Sozialisations-, Präferenz- und Diskriminierungstheorie) beleuchtet werden. In Kapitel 2.3 wird nochmals besonders der MINT-Bereich in den Blick genommen und die zuvor besprochenen Theorien werden in diesem Kontext in Kapitel 2.4 angewendet sowie mit aktuellen Studien validiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschlechterspezifische Ungleichheiten am Arbeitsmarkt. Ursachen geschlechterspezifische Berufswahl am Beispiel von Frauen in MINT-Berufen.
- Aktuelle Situation am Arbeitsmarkt und berufliche Geschlechtersegregation.
- Überblick über Theorien zu geschlechterspezifischen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt.
- Angebotsseitige Theorien: Humankapital-, Sozialisations- & Präferenz-Theorie
- Nachfrageseitige Theorie: Diskriminierungstheorie
- Angewandte Theorie: Geschlechterspezifische Berufswahl am Beispiel von Frauen in MINT-Berufen.
- Angewandte Humankapitaltheorie
- Angewandte Sozialisationstheorie
- Angewandte Präferenztheorie
- Angewandte Diskriminierungstheorie
- Aktuelle Studien zu den Ursachen der beruflichen Geschlechtersegregation.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Ursachen der geschlechterspezifischen Berufswahl am Beispiel von Frauen in MINT-Berufen. Ziel ist es, die im Seminar besprochenen Theorien zu geschlechterspezifischen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt zusammenzufassen, zu kritisieren und um Alternativen zu erweitern. Dabei liegt der Fokus auf der horizontalen Ungleichheitsdimension - der unterschiedlichen Berufswahl von Männern und Frauen. Die Arbeit versucht zu klären, wie sich die Berufswahl je nach Geschlecht unterscheidet, welche Ursachen die unterschiedliche Berufswahl von Männern und Frauen hat und warum so wenige Frauen im MINT-Bereich beschäftigt sind.
- Berufliche Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt
- Theorien zu geschlechterspezifischen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt (Humankapital, Sozialisation, Präferenz, Diskriminierung)
- Anwendung der Theorien auf die geschlechterspezifische Berufswahl in MINT-Berufen
- Aktuelle Studien zur beruflichen Geschlechtersegregation in MINT-Berufen
- Ursachen für die geringe Zahl von Frauen in MINT-Berufen
Zusammenfassung der Kapitel
2. Geschlechterspezifische Ungleichheiten am Arbeitsmarkt. Ursachen geschlechterspezifische Berufswahl am Beispiel von Frauen in MINT-Berufen.
2.1 Aktuelle Situation am Arbeitsmarkt und berufliche Geschlechtersegregation
Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Situation der beruflichen Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt, insbesondere in Bezug auf MINT-Berufe. Es stellt fest, dass trotz der formalen Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die berufliche Segregation immer noch besteht. Typische weibliche Berufsfelder liegen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Dienstleistungssektor, während Männer überwiegend in der Industrie und im Bauwesen arbeiten. Die Grafik 1 zeigt die geschlechterspezifische Segregation des Arbeitsmarktes nach Branche und verdeutlicht den hohen Anteil von Frauen in Teilzeitberufen, insbesondere in typischen Frauenberufen.
2.2 Überblick über Theorien zu geschlechterspezifischen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt.
Dieses Kapitel stellt die im Seminar besprochenen Theorien zu geschlechterspezifischen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt vor. Es werden sowohl angebotsseitige Theorien (Humankapital, Sozialisation, Präferenz) als auch nachfrageseitige Theorien (Diskriminierung) behandelt. Die Theorien erklären die geschlechterspezifische Berufswahl anhand verschiedener Faktoren wie individuelles Humankapital, gesellschaftliche Sozialisation, persönliche Präferenzen und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt.
2.3 Angewandte Theorie: Geschlechterspezifische Berufswahl am Beispiel von Frauen in MINT-Berufen.
Dieses Kapitel wendet die zuvor besprochenen Theorien auf die geschlechterspezifische Berufswahl in MINT-Berufen an. Es untersucht, inwiefern Humankapital, Sozialisation, Präferenzen und Diskriminierung die geringe Zahl von Frauen in MINT-Berufen erklären können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themenbereiche geschlechterspezifische Ungleichheiten, berufliche Segregation, MINT-Berufe, Humankapitaltheorie, Sozialisationstheorie, Präferenztheorie, Diskriminierungstheorie und aktuelle Studien zur beruflichen Geschlechtersegregation.
- Arbeit zitieren
- Ronja Uhlmann (Autor:in), 2023, Geschlechterspezifische Ungleichheiten am Arbeitsmarkt, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1397086