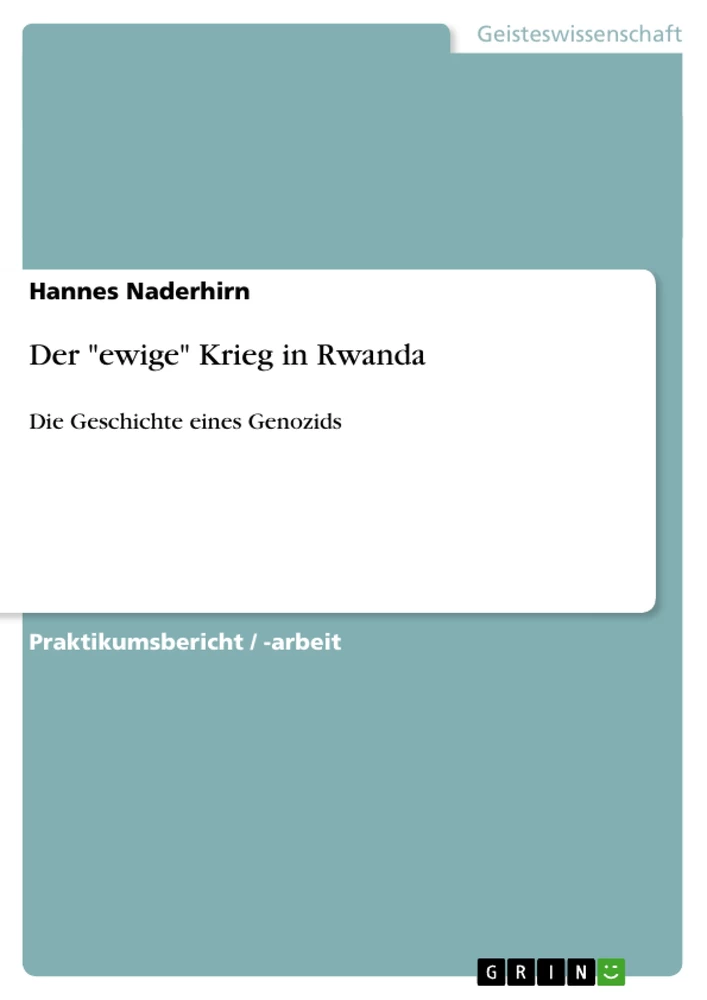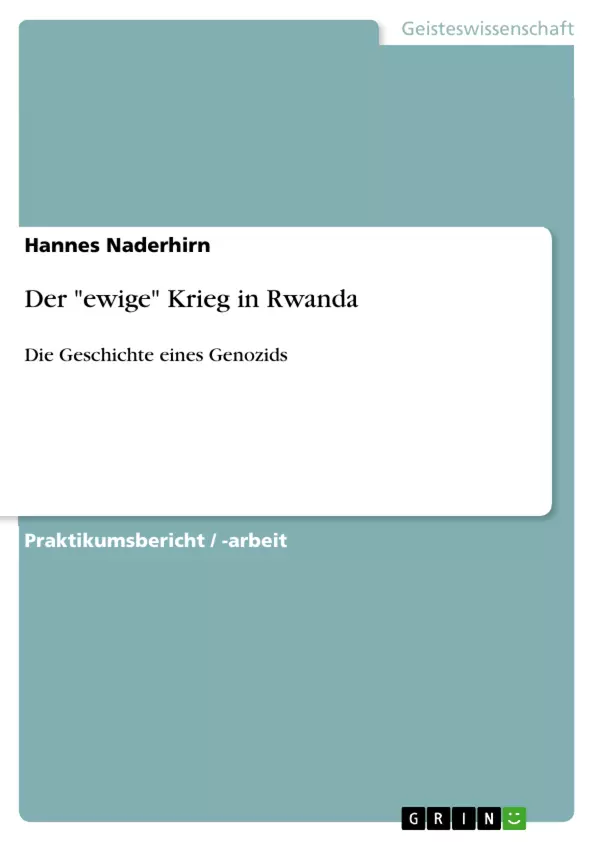Otto Bauer, der prägende Mann des Austromarxismus in der ersten Republik und Bruno Kreisky, der Jung-Sozialist der 1930-er Jahre und die prägende Gestalt der Sozialdemokratie der 2. Republik haben sich nur einmal getroffen, geistig und ideologisch wurde Kreisky durch Bauer geformt. Dies zeigt sich auch in vielen Reden
Bruno Kreisky, in denen er sich immer wieder auf Otto Bauer beruft, wie zum Beispiel am 11. Juni 1970 beim Parteitag der Sozialistischen Partei Österreichs, wie sie
damals noch hieß. Dort verwert sich Kreisky gegen die An- und Untergriffe der politischen Gegner, die die SPÖ mit dem Vorwurf des „Austromarxismus“ in die Nähe der kommunistischen Gesinnung rücken wollten. Gerade in heutigen Tagen einer gewissen Rehabilitierung der wirtschaftlichen Thesen von Karl Marx mag dies interessant klingen, hatte damals aber harten ideologischen Hintergrund. Kreisky argumentierte in der Rede, dass „der Austromarxismus nichts anderes war als der Versuch der sozialdemokratischen Interpretation der Lehren des Marxismus war“. Er führt dann Jean-Paul Sarte an, der „etwas länger gebraucht hat, aber ein Großer dieser Schule war“, und beruft sich dann explizit auf Otto Bauer und dessen Abgrenzung zum Bolschewismus: „Otto Bauer schreib schon 1920, dass die Herrschaftsorganisation der Sowjetbürokratie beginnt, sich vom proletarischen Mutterboden loszulösen, sich zu verselbstständigen. Sie droht zu einer selbstständigen, despotischen Macht zu werden, die über den Klassen zu stehen glaubt“. Und diese Abgrenzung zum Bolschewismus und Kommunismus russischer Prägung vereinten das Denken Bauers und Kreisky, wobei ersterer der Lehrmeister war. Wie noch gezeigt wird, war es ausschließlich die Stellung zu Deutschland, die einen geistigen Zwiespalt brachte.
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- 1. Die Differenzierung zu Beginn der Geschichte des Landes
- 2. Konfliktakteure
- 2.1. „Belgisch-Kongo“ und die Gründe des Rwanda-Konflikts, seine Problematik, Machtbalance
- 2.2. Die staatlich verordnete Ethnisierung während der Kolonialzeit
- 3. Die Zeit der Unabhängigkeit oder Die Schlacht beginnt
- 4. Resümée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Geschichte des Konflikts zwischen Hutus und Tutsis in Ruanda zu beleuchten, beginnend mit den frühen sozialen Differenzierungen bis hin zum Genozid von 1994 und den anhaltenden Folgen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der ethnischen Kategorien, dem Einfluss der Kolonialzeit und der Dynamik des Konflikts.
- Soziale Kategorien vor der Kolonialzeit
- Der Einfluss der belgischen Kolonialherrschaft
- Die Rolle von Macht und Ressourcen im Konflikt
- Die Entstehung und Verschärfung ethnischer Spannungen
- Der Genozid von 1994 und seine Langzeitfolgen
Zusammenfassung der Kapitel
Prolog: Der Prolog beschreibt die anfängliche Ignoranz der internationalen Gemeinschaft gegenüber den Geschehnissen in Ruanda 1994 und den mangelnden Kenntnisstand über die Geschichte und die ethnischen Gruppen des Landes. Er betont die späte Wahrnehmung des Ausmaßes der Gräueltaten und die Rolle von Hollywood-Filmen wie "Hotel Ruanda" bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Die Arbeit wird als Versuch vorgestellt, die Geschichte der Hutus und Tutsis und den andauernden Konflikt zu beleuchten.
1. Die Differenzierung zu Beginn der Geschichte des Landes: Dieses Kapitel analysiert die Begriffe "Hutu" und "Tutsi" in ihrer ursprünglichen Bedeutung als soziale Kategorien, die primär durch Reichtum und Viehbesitz definiert wurden, nicht durch Abstammung oder Ethnizität. Der soziale Aufstieg und Abstieg zwischen diesen Kategorien war fließend und wurde durch ökonomische Veränderungen beeinflusst. Die Kapitel zeigt, dass die Begriffe "Hutu" und "Tutsi" vor der Kolonialzeit nicht starre ethnische Identitäten darstellten, sondern flexible soziale Klassen, die durch wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg veränderbar waren. Die Begriffe „icyhure“ und „umuwore“ verdeutlichen den dynamischen Charakter dieser sozialen Mobilität.
2. Konfliktakteure: Dieses Kapitel stellt die Hauptakteure des Konflikts vor: Hutu, Tutsi und Twa. Es betont, dass der Konflikt zwischen Hutu und Tutsi ein langwieriger Prozess ist, der weit über die Ereignisse von 1994 hinausreicht. Die Analyse der Konfliktakteure im Kontext der heutigen Situation in Ruanda wird als Grundlage für eine umfassendere Konfliktanalyse angesehen. Die Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der komplexen Dynamiken, welche den Konflikt prägen, indem es die Hauptakteure in ihrem historischen und gegenwärtigen Kontext positioniert. Die Erwähnung der drei Nationalitäten – Hutu, Tutsi und Twa – unterstreicht die Vielschichtigkeit der ruandischen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Ruanda, Hutu, Tutsi, Twa, Genozid, Kolonialismus, Ethnizität, soziale Kategorien, Konflikt, Macht, Ressourcen, Belgien, 1994.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ruanda-Konflikt: Eine Analyse
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Konflikt zwischen Hutus und Tutsis in Ruanda. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Entwicklung ethnischer Kategorien, dem Einfluss der Kolonialzeit und der Dynamik des Konflikts, beginnend mit frühen sozialen Differenzierungen bis zum Genozid von 1994 und seinen Folgen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument beinhaltet folgende Kapitel: Prolog, 1. Die Differenzierung zu Beginn der Geschichte des Landes, 2. Konfliktakteure (mit Unterkapiteln 2.1 und 2.2), und 4. Resümée. Der Prolog behandelt die anfängliche internationale Ignoranz und die spätere Sensibilisierung durch Medien. Kapitel 1 analysiert die ursprünglichen Bedeutungen von "Hutu" und "Tutsi" als soziale Kategorien. Kapitel 2 beschreibt die Hauptakteure des Konflikts (Hutu, Tutsi, Twa) und den Konflikt im historischen und gegenwärtigen Kontext. Ein Resümée fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Arbeit beleuchtet die Geschichte des Konflikts zwischen Hutus und Tutsis in Ruanda, von den frühen sozialen Differenzierungen bis zum Genozid von 1994 und seinen anhaltenden Folgen. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung ethnischer Kategorien, dem Einfluss der Kolonialzeit und der Dynamik des Konflikts.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind: Soziale Kategorien vor der Kolonialzeit, der Einfluss der belgischen Kolonialherrschaft, die Rolle von Macht und Ressourcen im Konflikt, die Entstehung und Verschärfung ethnischer Spannungen, und der Genozid von 1994 und seine Langzeitfolgen.
Wie werden die Begriffe "Hutu" und "Tutsi" im Dokument dargestellt?
Das Dokument betont, dass "Hutu" und "Tutsi" vor der Kolonialzeit flexible soziale Kategorien waren, die primär durch Reichtum und Viehbesitz definiert wurden, nicht durch Abstammung oder Ethnizität. Der soziale Aufstieg und Abstieg war fließend und wurde durch ökonomische Veränderungen beeinflusst. Die Kolonialzeit führte zu einer Verfestigung dieser Kategorien als starre ethnische Identitäten.
Welche Rolle spielte die Kolonialzeit?
Die belgische Kolonialherrschaft spielte eine entscheidende Rolle bei der Verfestigung und Verschärfung der ethnischen Kategorien "Hutu" und "Tutsi". Das Dokument analysiert den Einfluss der Kolonialpolitik auf die Entwicklung des Konflikts.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Ruanda, Hutu, Tutsi, Twa, Genozid, Kolonialismus, Ethnizität, soziale Kategorien, Konflikt, Macht, Ressourcen, Belgien, 1994.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, das Dokument enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, welche die wichtigsten Punkte und Analysen jedes Kapitels kurz und prägnant wiedergeben.
- Quote paper
- Mag. Hannes Naderhirn (Author), 2009, Der "ewige" Krieg in Rwanda, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/138922