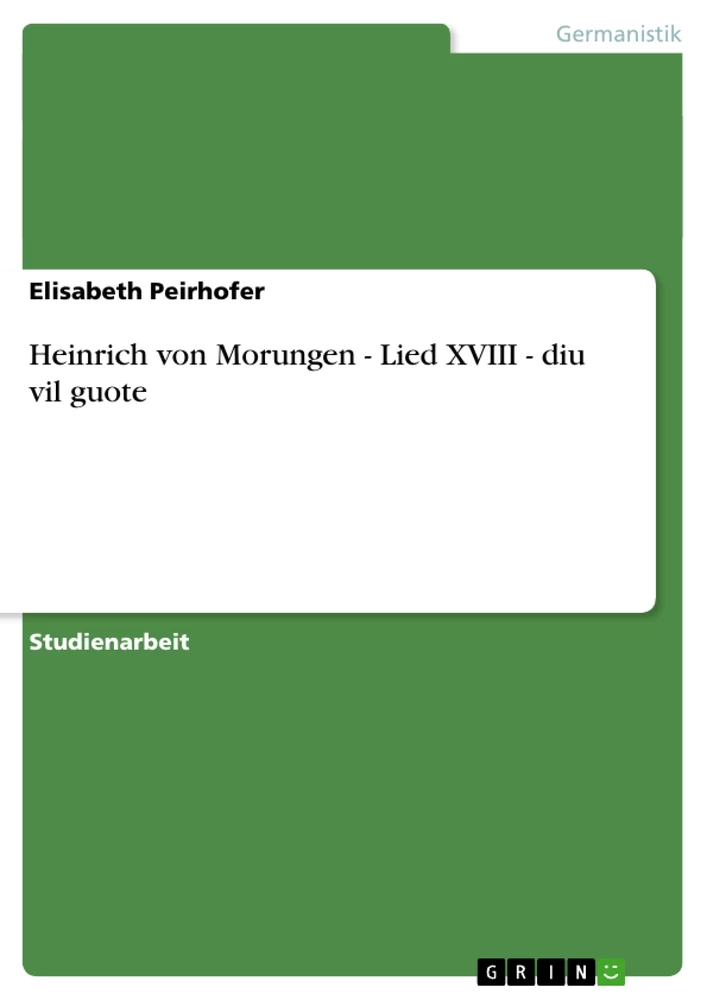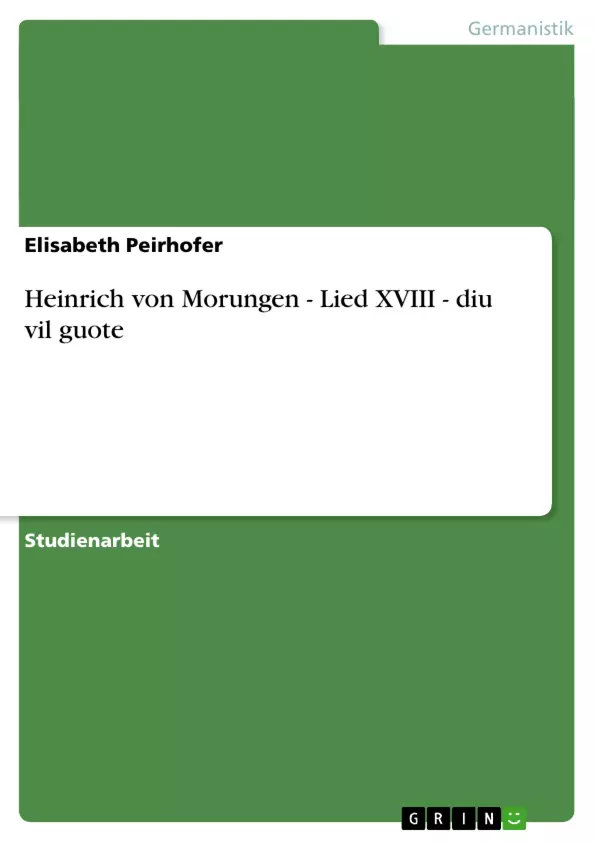Heinrich von Morungen war ein bedeutender Minnesänger und Dichter seiner Zeit und doch ist nur wenig über ihn bis heute bekannt.
Seine Dichtung stand unter dem Einfluss der provenzalischen Troubadourdichtung. Von seinem œuvre, das rein aus Lyrik besteht, sind rund 33 Lieder überliefert. Er zählt zu den wichtigsten Lyrikern des Mittelalters neben Walther und Reinmar.
Prägend für seine Lieder sind die Leidenschaft und Stärke der Bilder, wiederholt benutzte er Lichtmetaphorik. Minne war für ihn eine magische, zerstörerische Macht, man kann von einer Dämonie der Minne sprechen. Er beschränkte sich nicht nur auf Minnelieder, sondern reflektierte über den richtigen Begriff und Bedeutung von Minne, wie er seine Gefühle am besten zum Ausdruck bringen könnten und band sein Publikum immer wieder mit ein.
Außerdem kritisiert er in seinem hier vorliegenden Lied „diu vil guote“ die huote, eine Institution des höfischen Mittelalters, doch er tut dies nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern spricht seine Kritik offen aus.
Ich möchte nun in der vorliegenden Arbeit dieses Lied genauer untersuchen und werde versuchen, eine Interpretation aufzuzeigen.
INHALTSVERZEICHNIS
Originaltext (nach MF 136,25) & Eigene Übersetzung:
I. Einleitung
II. Aufbau und Reimschema
III. Handschriftensituation
IV. Textapparat
V. Interlinearversion
VI. Interpretation
VII. Abschließende Interpretation
Literaturverzeichnis
Originaltext (nach MF 136,25) & Eigene Übersetzung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
I. Einleitung
HeinriCh von Morungen war ein bedeutender Minnesänger und DiChter seiner Zeit und doCh ist nur wenig über ihn bis heute bekannt. Er lebte voraussiChtliCh von Ca. 1150 bis 1222, wurde auf Burg Morungen bei Sangershausen in Thüringen geboren und war ein Ministeriale des Markgrafen DietriCh von Meißen. DurCh eine Urkunde ist seine Anwesenheit 1213 in Leipzig bezeugt.
Seine DiChtung stand unter dem Einfluss der provenzalisChen TroubadourdiChtung. Von seinem œuvre, das rein aus Lyrik besteht, sind rund 33 Lieder überliefert. Er zählt zu den wiChtigsten Lyrikern des Mittelalters neben Walther und Reinmar.
Prägend für seine Lieder sind die LeidensChaft und Stärke der Bilder, wiederholt benutzte er LiChtmetaphorik. Minne war für ihn eine magisChe, zerstörerisChe MaCht, man kann von einer Dämonie der Minne spreChen. Er besChränkte siCh niCht nur auf Minnelieder, sondern reflektierte über den riChtigen Begriff und Bedeutung von Minne, wie er seine Gefühle am besten zum AusdruCk bringen könnten und band sein Publikum immer wieder mit ein.
Außerdem kritisiert er in seinem hier vorliegenden Lied „diu vil guote“ die huote, eine Institution des höfisChen Mittelalters, doCh er tut dies niCht hinter vorgehaltener Hand, sondern spriCht seine Kritik offen aus.
ICh möChte nun in der vorliegenden Arbeit dieses Lied genauer untersuChen und werde versuChen, eine Interpretation aufzuzeigen.
II. Aufbau und Reimschema
Das Lied XVIII ist in der hier vorliegenden Version (von MF 136,25 übernommen) in 5 Strophen überliefert worden.
Die Strophen sind als sechszeilige Stollenstrophen überliefert, eine sogenannte Kanzonenstrophe.
Das Reimschema lautet a b a b c c.
III. Handschriftensituation
Als Leithandschrift für die ersten drei Strophen von Lied XVIII gilt die Handschrift C (Große Heidelberger/ Manessische Liederhandschrift), darin findet sich die Reihenfolge 1; 3; 2. Die Strophen 4 und 5 fehlen hier.
Im Vergleich dazu finden sich in Handschrift A (Kleine Heidelberger Liederhandschrift) die Strophen 1-3 und 5 in dieser Reihenfolge, Strophe 4 fehlt auch hier.
Die Strophe 4 wird nur in der Sammelhandschrift der Burgerbibliothek Bern überliefert, dort finden sich die Strophen 1; 3; 4.
Die inhaltliche Reihung der Strophen 1-2-3 folgt nach A, da sich Strophe 2 besser an Strophe 1 anschließt als Strophe 3.
Die Echtheit der Strophen 3-5 (Sievers) beziehungsweise der Strophen 4-5 (Brinkmann, Frings/ Lea, Des Minnesangs Frühling) ist umstritten.
IV. Textapparat
Es gibt zwischen den Handschriften kleinere Unterschiede bzgl. der Schreibung, jedoch nichts Sinnänderndes. Der wesentliche Unterschied ist in Vers 3,4 statt der oben genannten Stelle: lies schówen lies sie werden.
V. Interlinearversion
I. Strophe:
Heinrich von Morungen eröffnet sein Lied mit einem Frauenpreis und wünscht der Dame, da sie so gut sei, sie möge glücklich sein. Bereits in Vers 3 jedoch verflucht er die huote, also die Wächter beziehungsweise die Sitte der Bewachung der Damen, da ihm und der Welt (gemeint ist wohl die höfische Gesellschaft rund um den Hof der Dame) durch jene huote der helle Schein der Dame, welchen er mit der Sonne vergleicht, genommen wird.
II. Strophe:
Das lyrische Ich leidet unter der Nacht und wartet auf den Sonnenuntergang, um zumindest dann einmal seine Dame sehen zu können. Wieder wird die Dame mit der
Sonne verglichen. Diesen Anblick könne ihm keine noch so trübe Wolke verderben.
III. Strophe:
Er kündigt den Wächtern einen Bann an: es sei gegen Gottes Ordnung gerichtet, die Frau vor dem Mann und der Welt zu verbergen, denn sie ist dafür geschaffen um allen durch ihren Schein und Glanz eine Freude zu sein. Sie soll aber nicht nur selbst strahlen, sondern ihre Funktion ist zugleich auch ein Spiegel der Freude der anderen. Er vergleicht sie weiters mit vergrabenem Gold, das nutzlos ist, wenn es keiner sehen kann.
IV. Strophe:
Das lyrische Ich verflucht die Wächter, die tadellose Frauen bewachen bzw. die Institution der huote, und bemängelt, dass man diese Bewachung über anständige Damen verhänge. Erst diese Bewachung mache treue Frauen wankelmütig, so seine Meinung, daher sollten sie ohne Aufsicht und Zwang bleiben. Außerdem reizen Verbote erst recht dazu, sie zu übertreten, was er mit dem Bild eines Kranken, den er verbotenes Wasser trinken gesehen hat, noch verstärkt.
[...]
- Quote paper
- Elisabeth Peirhofer (Author), 2009, Heinrich von Morungen - Lied XVIII - diu vil guote, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/138533