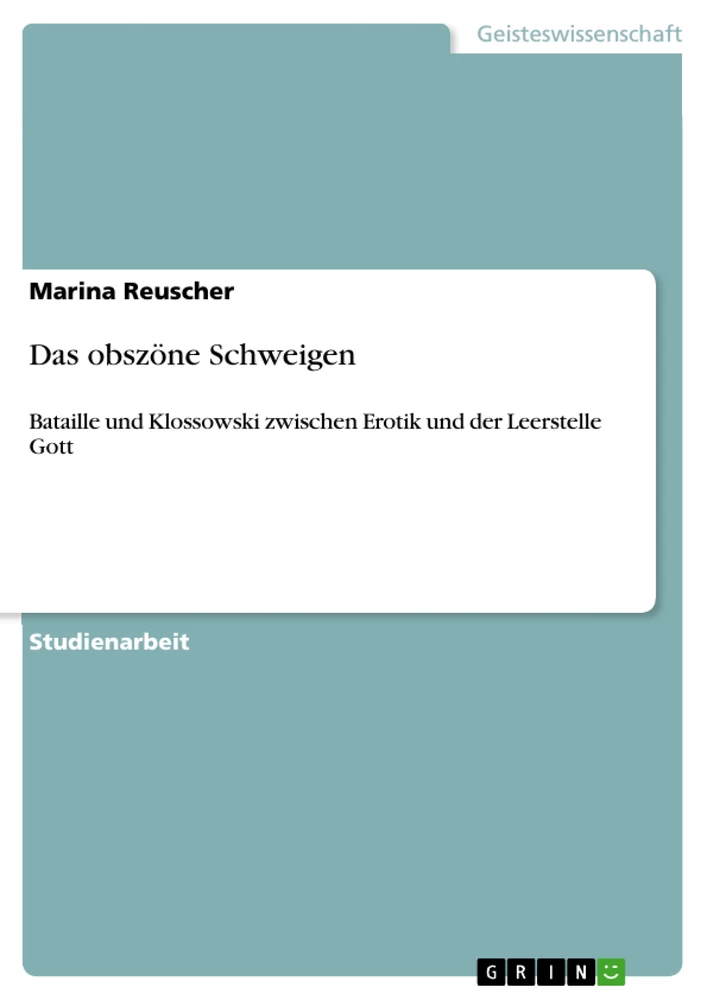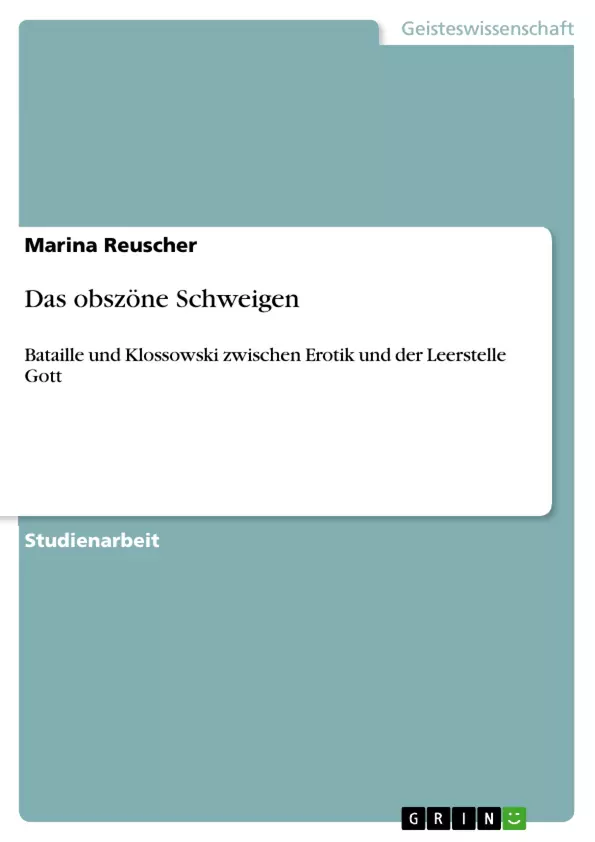Die Termini Sprechen, Sein und Sinn erfahren im 19.Jahrhundert im philosophischen und literarischen Diskurs einen fundamentalen Wandel, der auf akademischer wie auf innerlicher Ebene einen Zustand der Irritation evozierte, der auch im zeitgenössischen Denken fortwährt. Entscheidendes Objekt ist hierbei die Sprache. A priori als universell identitäts- und sinngenerierende Instanz positioniert , wird nun die Einheit zwischen Denken und dem Akt des Sprechens, eine zuvor unablässige Allianz für die Bildung eines kohärenten Selbst bzw. Selbstbewusstseins, radikal in Frage gestellt. Der moderne Mensch der abendländischen Gesellschaft, deren rational-wissenschaftliche Basis in der Sprache als Garant des Logos wurzelt, befindet sich folglich in einer prekären Lage. Sein modernes menschliches Dasein, generiert aus dem sprachlichen System, kann auch nur durch die Struktur der Begriffe fortbestehen- die Lebensbedingungen der neuzeitlichen Gesellschaft sind unwiederbringlich mit der Zeichenwelt der Sprache verwoben. Es stellt sich die Erkenntnis ein, dass „kein Erfahrungsgehalt sich ohne Begriffsgeleise mitteilen [kann], die der Code der alltäglichen Zeichen in den Geistern eingegraben hat; und [dass] andererseits der Code der Alltagszeichen jeden Erfahrungsgehalt zensiert“ . Das aufkeimende Misstrauen der diskursiven Sprache gegenüber schafft eine doppelte Entfremdung: Verlust einer konsistenten Identität des Ichs und eine zunehmend brüchige Wahrnehmung der Realität der Umwelt und des kulturellen Gefüges. Es stellen sich die Fragen: Was sind die Erfahrungen, die nicht von Sprache beherrscht und durch sie induziert sind? „Wie ist es möglich, die Emotion aus ihrer stereotypierten Mitteilung zu extrahieren?“ Existiert ein prä-verbales Begehren und Bedürfnis? Ergo: Wer bin ich, wenn mein Denken sich nicht in Begriffen artikuliert. Sprache transmutiert von (und changiert zwischen) Identitätsstiftend zu Identitätsdestruierend. Diese Erfahrung, wesentlich von Nietzsche, de Sade und auch Freud initiiert, kulminiert nun insbesondere im Frankreich um 1900, eine Zeit beispielloser gesellschaftlicher Umwälzung:
[...]
[...]
Folgend wird erörtert, wie Bataille und Klossowski jeweils Sexualität und Religion in Theorie und Prosa zusammenführen und auf welche Weise diese Symbiose dem ‚Unkommunizierbaren’ in der Moderne ein Wiederaufleben ermöglichen.
Gliederung:
1. Einführung
2. Das obszöne Schweigen: Bataille und Klossowski zwischen Erotik und der Leerstelle Gott
2.1 Die ekstatische Kommunikation Batailles Seite 5- 12
2.1.1 Restituierung archaischer Gewaltsamkeit
2.1.2 Die Erotik- Todessimulation als Chance
2.2 Die Geschichte des Auges
2.2.1 Gottes Abwesenheit
2.3 Die trügerischen Bilder Pierre Klossowskis
2.3.1 Coincidentia Oppositorum: Das Simulakrum zwischen Körper und Geist
2.4 Die Individualitäten der Roberte
2.4.1 Der Übergriff der reinen Geister
2.5 Das Phantasma und sein Double
3. Schlussbetrachtung
1. Einführung:
Die Termini Sprechen, Sein und Sinn erfahren im 19.Jahrhundert im philosophischen und literarischen Diskurs einen fundamentalen Wandel, der auf akademischer wie auf innerlicher Ebene einen Zustand der Irritation evozierte, der auch im zeitgenössischen Denken fortwährt. Entscheidendes Objekt ist hierbei die Sprache. A priori als universell identitäts- und sinn-generierende Instanz positioniert[1], wird nun die Einheit zwischen Denken und dem Akt des Sprechens, eine zuvor unablässige Allianz für die Bildung eines kohärenten Selbst bzw. Selbstbewusstseins, radikal in Frage gestellt. Der moderne Mensch der abendländischen Gesellschaft, deren rational-wissenschaftliche Basis in der Sprache als Garant des Logos wurzelt, befindet sich folglich in einer prekären Lage. Sein modernes menschliches Dasein, generiert aus dem sprachlichen System, kann auch nur durch die Struktur der Begriffe fortbestehen- die Lebensbedingungen der neuzeitlichen Gesellschaft sind unwiederbringlich mit der Zeichenwelt der Sprache verwoben. Es stellt sich die Erkenntnis ein, dass „kein Erfahrungsgehalt sich ohne Begriffsgeleise mitteilen [kann], die der Code der alltäglichen Zeichen in den Geistern eingegraben hat; und [dass] andererseits der Code der Alltagszeichen jeden Erfahrungsgehalt zensiert“[2]. Das aufkeimende Misstrauen der diskursiven Sprache gegenüber schafft eine doppelte Entfremdung: Verlust einer konsistenten Identität des Ichs und eine zunehmend brüchige Wahrnehmung der Realität der Umwelt und des kulturellen Gefüges. Es stellen sich die Fragen: Was sind die Erfahrungen, die nicht von Sprache beherrscht und durch sie induziert sind? „Wie ist es möglich, die Emotion aus ihrer stereotypierten Mitteilung zu extrahieren?“[3] Existiert ein prä-verbales Begehren und Bedürfnis?[4] Ergo: Wer bin ich, wenn mein Denken sich nicht in Begriffen artikuliert.
Sprache transmutiert von (und changiert zwischen) Identitäts-stiftend zu Identitäts-destruierend. Diese Erfahrung, wesentlich von Nietzsche, de Sade und auch Freud initiiert, kulminiert nun insbesondere im Frankreich um 1900, eine Zeit beispielloser gesellschaftlicher Umwälzung: eine post-nietzscheanische, gottlose, a-christliche Ära beginnt und eröffnet den Raum für eine neue dionysische Philosophie, welche „die Erfahrung des Göttlichen wieder ins Herz des Denkens versetzt“[5]. Als bedeutende literarisch-philosophische Protagonisten sind hier zu nennen: Maurice Blanchot, Antonin Artaud, George Bataille, Pierre Klossowski, die surrealistische Vereinigung um André Breton[6] und Jacques Lacan (als Initiator einer die Grenzen der Wissenschaft öffnenden Psychoanalyse).[7] Was sie eint, ist die Formulierung dieser existentiellen Erfahrung, welche die Ohmacht der diskursiven Sprache in sich trägt; und der Versuch einer Kommunikation des Unsagbaren ohne dessen Gehalt durch das Sprachgeflecht des Symbolischen zu schmälern. Die Wege, die diese französischen Autoren der Moderne beschritten haben, sind vielfältig, ihr Schnittpunkt aber liegt an der Grenze zum Wahnsinn, zum Dämonischen, zum Tod:
„In den Randbezirken, wo das Sprechen abdankt, beginnt die Domäne der Gewalt. [Sie herrscht dort schon], selbst ohne dass man sie provoziert.“[8]
Ein Raum wird eröffnet, der beherrscht ist von der radikalen positiven Bejahung der Destruktion: des Sprechens, des Seins, des Sinns, des Subjekts.
2. Das obszöne Schweigen: Bataille und Klossowski zwischen Erotik und der Leerstelle Gott
Eine derart operierende ‚wilde’ Philosophie, auf die Überschreitung des dialektischen Diskurses zielend, trägt notwendig den Umsturz der regulierenden Werte und Ordnungen der zivilisierten Gesellschaft in sich; die Frage von Moral und Recht erfährt nach dem von Nietzsche postulierten Tod Gottes (Zarathustra) und seiner Sprachkritik (Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne) eine neue Dimension.[9] Die christliche Glaubenslehre spielt dabei in vielfacher Hinsicht eine tragende Rolle: sie gebar das rationalistisch- sprachliche System, dem die abendländische Gesellschaft unterliegt[10], erschuf die streng dualistische moralische Kategorie von Gut und Böse. Sexualität (als eine rauschhafte erotische Erfahrung) – klassifiziert als unproduktive, verschwenderische Kraft, deren unmittelbares Erleben per se nicht verbal artikulierbar ist- wurde des religiösen Raumes verwiesen und in den Bereich des profanen Unreinen verschoben, den der Sünde, die das Böse par excellence ist.[11] Die ökonomisch organisierte Gesellschaft, sich fortschreitend unabhängig von den kirchlichen Dogmen entwickelnd, die ihr Fundament bildet, erlebt im industriellen Zeitalter ihre volle Blüte und wird gleichsam stark erschüttert. Das verstoßene Böse drängt zur obsessiven Wiederkehr: de Sade exerzierte als Erster in seinen Romanen das philosophische Zusammenspiel von Gottesverlust und Sexualität in Gestalt gewalttätiger monströser Perversität; der Widerhall auf die soziale Homogenisierung der Gesellschaft durch den Ausschluss irrationaler un-utilitaristischer, asozialer Kräfte. (A-)Theologie und Erotik, inspiriert von de Sade, wird zur essentiellen thematischen Konstante insbesondere im Werk George Batailles und Pierre Klossowskis.[12] Folgend wird erörtert, wie Bataille und Klossowski jeweils Sexualität und Religion in Theorie und Prosa zusammenführen und auf welche Weise diese Symbiose dem ‚Unkommunizierbaren’ in der Moderne ein Wiederaufleben ermöglichen. Die Erörterung steht dabei stets unter dem kontextuellen thematischen Leitmoment: Sprache- konstitutive kulturelle Erfahrung und Urheberin ursprünglicher Entfremdung zugleich.
2.1 Die ekstatische Kommunikation Batailles
„Also sprechen, denken, es sei denn scherzend oder…, heißt, die Existenz zum Verschwinden zu bringen: es heißt nicht, zu sterben, sondern tot zu sein.“[13]
Die elementare Inkongruenz von Erleben und Artikulieren prägt auch das Werk George Batailles – subsumiert in der exorbitanten Sehnsucht nach Autonomie der menschlichen Existenz, die stets flüchtig, nicht fassbar, aber dennoch möglich erscheint.[14] Die Chance des Subjekts[15] liegt in der Überschreitung; die Überwindung des diskursiven und individuellen Seins, das besteht in der absoluten Objektivierung der modernen Welt. Der Akt der Transgression manifestiert sich ausschließlich im affektiven Zustand des Exzesses, den zu erreichen sich dem Menschen zwei Perspektiven bieten: „ […] spielen heißt, die Grenze zu berühren, so weit wie möglich zu gehen und am Rand eines Abgrunds zu leben. Ein freier, frei sein wollender Geist wählt zwischen Askese und Spiel.“[16] Askese stellt sich für Bataille dar als die erhabenste und souveränste Form einer inneren Erfahrung, die, religiös-mystisch, nur der übersinnlichen Entrückung heiliger Märtyrer gleichkommt. Das Spiel hingegen beinhaltet verschiedene Modi: Trunkenheit, Lachen, Poesie, Absurdität, Zorn, Heroismus, Liebe und Erotik. Sie bilden Bande der ‚Immanenz’, die es vermögen, die Herrschaft der ‚Transzendenz’, das die Aktivität ist, temporär zu durchbrechen, doch „in ihren Grenzen [sind sie] minderjährige Souveräne, die das Reich der Aktivität nicht in Frage stellen können.“[17] Das Spiel ist Kommunikation, nonverbale, unmoralische Kommunikation mit den verfemten Elementen der menschlichen Gesellschaft, die auf die absolute Destruktion des Ichs (als Einheit des individuellen Subjekts) und des Bewusstseins zielt und durch ihre generöse Verschwendung ein ekstatisches, wahrhaftiges Sein zu generieren vermag. Die Kommunikation aber ist begrenzt auf einen Moment der Souveränität, der sinnlich und unmittelbar ist; es ist nicht möglich ihn zu erwerben - erreichbar ist er nur durch die totale Aufgabe jeglichen Handelns und die Bejahung des Nichtwissens, die ein Zerbersten des Bewusstseins provoziert. Somit steht der souveräne Augenblick dem definitorisch Guten diametral gegenüber, denn das Gute ist die produktive Sorge um den Erhalt des materiellen Seins, es ist die Bevorzugung der Zukunft vor der Gegenwart. Das Böse jedoch gibt sich der Gegenwart hin, begehrt sie unwissend, bedingungslos und gedankenlos. Was Batailles Besonderheit ausmacht, ist, diesem durch und durch nonverbalen Spiel des Bösen eine Sprache geben zu wollen, die, nicht poetisch, der diskursiven Sprache entstammt. Das macht Batailles Werk zu einer Philosophie der Überschreitung, die ein äußerst komplexes Begriffsinstrumentarium umfasst[18], welches deutlich macht, wie monströs das Unterfangen ist, sagen zu wollen, was im Kern unsagbar ist. Und wiederholt betont er: „Ich hätte gern dasselbe in wenigen Worten gesagt“[19]. Bataille konzipiert damit ein nonkonformistisches Denken der Subjektivität, das sich den strengen Maximen der Philosophie widersetzt und den Leser zu einer nicht-geistigen, affektiven Rezeption auffordert, die uneingeschränkte Leidenschaft von Körper und Geist einfordert.[20]
[...]
[1] Enorm vereinfacht: Ab dem 19.Jahrhundert wird Sprache wesentlicher thematischer Dreh- und Angelpunkt in der Philosophie und Wissenschaft, von Frege über Husserl, bis Heidegger, Searle, Luhmann und Derrida. Ab Mitte des 20.Jahrhunderts bekanntermaßen als linguistic turn (Höhepunkt des strukturalistischen Denkens) bezeichnet. ‚Sprache’ ersetzt begrifflich nun völlig ‚Bewusstsein’ im wissenschaftlichen Diskurs.
[2] Klossowski, Pierre: Die Ähnlichkeit (La ressemblance), Seite 17.
[3] Ebd., Seite 11.
[4] Viel diskutierte Thematik in der Psychoanalyse.
[5] Foucault, Michel: Schriften zur Literatur, in: Vorrede zur Überschreitung, Seite 71. (Foucault widmete sich der Thematik der französischen Bewegung um 1900 ausführlich; siehe: Schriften zur Literatur)
[6] Artaud, Klossowski und Bataille waren zwar zeitweilig Mitglieder der surrealistischen Vereinigung, aber verließen sie (unabhängig voneinander) aufgrund unvereinbarer Differenzen.
[7] Die genannten Personen kannten sich untereinander, freundschaftlich, verfeindet oder flüchtig und beeinflussten sich gegenseitig in ihrem Denken.
[8] Lacan, Jacques: Seminar 3, Seite 185.
[9] „Indem Nietzsche die Pflicht, das Gute aufhob, indem er die Nichtigkeit und die Lüge der Moral aufzeigte, ruinierte er die Wirkmacht der Sprache“. Bataille, Georges: Nietzsche Memorandum, Seite 11.
[10] Thema auch der aufkommenden Soziologie um 1900: Siehe beispielsweise Max Weber und Émile Durkheim. Klassifiziert man das Christentum als Wurzel des Rationalismus, der die okzidentale Welt prägt, so nimmt diese Bewegung ihren Anfang im Calvinismus, der ab dem 18.Jahrhundert maßgeblich Einfluss gewann (Weber).
[11] Eine rituell geregelte Zeit der ekstatischen Verausgabung wie in archaischen Gesellschaften üblich, ist nicht mehr existent. (Kollektive Efferveszenz Durkheims. In: Die elementaren Formen des religiösen Lebens)
[12] Sowohl Klossowski als auch Bataille setzten sich dezidiert mit Sade und Nietzsche auseinander.
[13] Bataille, Georges: Die innere Erfahrung, Seite 68.
[14] Batailles Auffassung von einer autonomen Existenz ist nicht gleichzusetzen mit der Idee des unabhängigen Subjekts der Moderne- die Überwindung dieser ‚wahnhaften’ Idee ist Basis für Erlangung wahrer Autonomie.
[15] „Chance“ wird von Bataille als philosophischer Terminus verwendet. Siehe: Die innere Erfahrung.
[16] Bataille, Georges: Nietzsche und der Wille zur Chance, Seite 120.
[17] Bataille, Georges: Die innere Erfahrung, Seite 261.
[18] Von Heterogenität/Homogenität über Transzendenz/Immanenz und Mögliches/Unmögliches, Kontinuität/Diskontinuität, Ich und Ipse, sakrale Kommunikation, Intimität, Wissen/Nichtwissen, Souveränität, Gipfelmoral, Chance bis Meditation, Marter, Nacht und Nichts.
[19] Ebd. Seite 271.
[20] Bataille richtet sich weder an Akademiker, noch möchte er sich der Form der Philosophie bedienen: 266: Die Philosophie geht nicht aus sich heraus, sie kann den Bereich der Sprache nicht verlassen. Sie gebraucht die Sprache so, dass darauf niemals das Schweigen folgt. [...] Die Überschreitung zur Grundlage der Philosophie machen (das ist das Unterfangen meines Denkens), heißt, die Sprache durch eine schweigende Kontemplation ersetzen. Und: „Ich habe nicht vermeiden können, mein Denken in philosophischer Form wiederzugeben. Doch wende ich mich nicht an Philosophen.“ In: Die innere Erfahrung, Seite 232.
- Quote paper
- Marina Reuscher (Author), 2009, Das obszöne Schweigen , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/138301