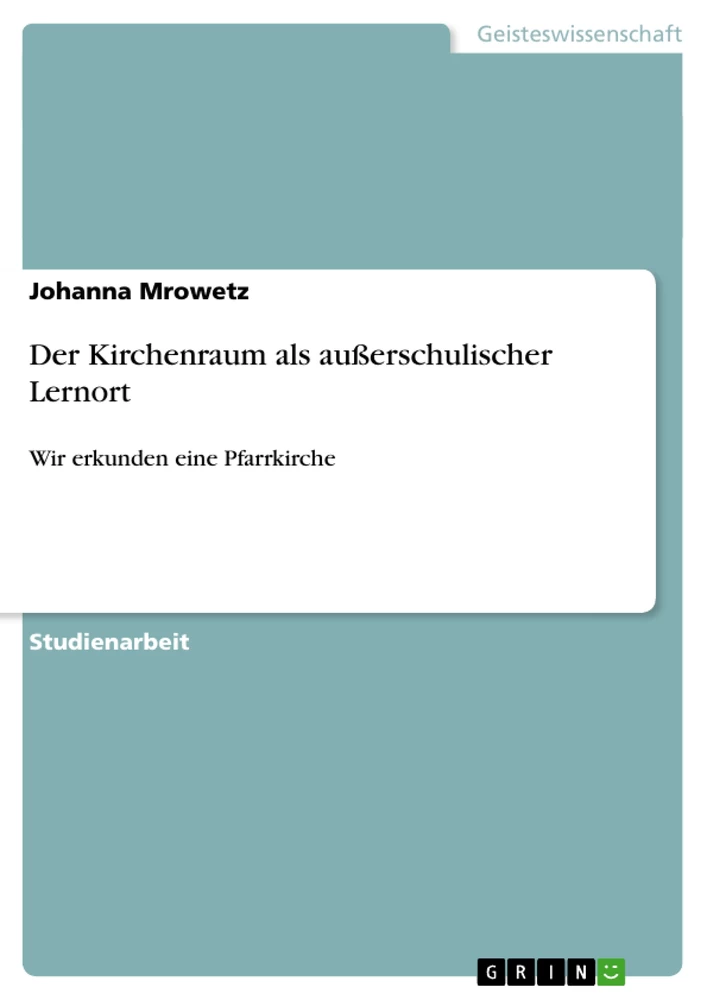Der „Lernortwechsel“ vom Klassenzimmer in die Pfarrkirche trägt dazu bei, dass schulisches Lernen sich öffnet für das Leben außerhalb des Schulgebäudes. So wird der Unterricht bereichert durch neue Lernimpulse und durch lebensweltliche Bezüge. Die vielen Möglichkeiten eines eigenaktiven und entdeckenden Lernens fördern die Fragehaltung und die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler, was den Unterricht im Klassenzimmer bereichern kann.
Der Wechsel des Unterrichts in den Kirchenraum bietet besonders wichtige Möglichkeiten für religiöses Lernen. Dabei verbinden sich ganzheitliche und sinnenreiche Wahrnehmung mit vielfältigen Handlungsmöglichkeiten.
Der Zusammenhang vom Lernen im Klassenraum und Erfahrungen, die sich bei Unterrichtsgängen ergeben, kommt zustande durch eine sorgfältige Planung von Vorbereitungs-, Durchführungs- und Auswertungsphase.
Inhaltsverzeichnis
1) Stundenkontext
a) Lehrplanbezug
b) Klassensituation
c) Stellung in der Unterrichtssequenz
2) Themenkonstitution
a) elementare Strukturen
b) elementare Zugänge
c) elementare Erfahrungen
d) elementare Wahrheiten
e) Grobziel und Feinziele
3) Artikulation
a) Lernschritte
b) Methoden
c) Medien
d) Artikulationsschema
4) Reflexion
5) Literaturangaben
6) Anhang
1) Stundenkontext
a) Lehrplanbezug
KR 5.2 Kirche am Ort: Leben in Pfarrei und Bistum
Die Schüler kommen aus verschiedenen Pfarrgemeinden; ihre Beziehung zur Kirche ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Durch Erkunden einer der Schule benachbarten Kirche (…) gewinnen die Schüler Einblick in lebendige Formen christlichen Lebens und Glaubens. Sie lernen das Kirchengebäude als sichtbaren Mittelpunkt der Gemeinde in seiner funktionalen und künstlerischen Gestalt wahrzunehmen und erfahren es als Sakralraum.
- ein nahe gelegenes Kirchengebäude erkunden, z. B. Bedeutung als Ort des Gebetes und Feierns, Ausstattung, Baustil, Kirchenpatron, Geschichte; wichtige liturgische Gegenstände und ihre Bedeutung; ein Gespür entwickeln für angemessene Verhaltensweisen und sie einüben.[1]
b) Klassensituation
Den Religionsunterricht besuchen in der Klasse 5b der Realschule Lindau (B) – Insel insgesamt 20 Schüler, von denen 12 Mädchen und 8 Jungen sind.
Die Kinder kommen weitgehend aus geregelten sozialen Verhältnissen und sind teils aktiv am Geschehen der Pfarrgemeinde integriert. Religion und Glaube spielen in den Familien einiger Schüler, nicht zuletzt durch das ehrenamtliche Engagement von Familienmitgliedern, eine große Rolle. Vor allem diese Schüler bereichern den Religionsunterricht häufig durch ihr fundiertes Wissen. Fast alle Kinder der Klasse zeigen große Offenheit und Neugier an religiösen Themen.
Aus zahlreichen Schülerberichten wird das Interesse an Kirchengebäuden und –räumen deutlich. Doch die Kenntnisse von liturgischen Gegenständen und dem Kircheninventar sind ihnen nur teils geläufig und ihre Erfahrungen aus der Zeit der Kommunionsvorbereitungen sind lückenhaft.
c) Stellung in der Unterrichtssequenz
1. UE: In der Gemeinde zusammen kommen
2. UE: Eine Kirche - viele Aufgaben
3. UE: Vorbereitung des Unterrichtsgangs: Erkundung einer Pfarrkirche
4. UE: Wir erkunden eine Pfarrkirche (Unterrichtsgang)
5. UE: Wir kennen uns in der Kirche aus (Nachbereitung des Unterrichtsgangs)
2) Themenkonstitution
a) elementare Strukturen
Der Kirchenraum als außerschulischer Lernort
Eine Begegnung mit Kirchenräumen ermöglicht eine Fülle von religiös relevanten Lernerfahrungen, auf die der Religionsunterricht nicht verzichten sollte. Begegnung meint in der vorliegenden Unterrichtseinheit die Begegnung mit der Kirche als sakralem Raum.
Kirchen unterscheiden sich von Räumen, in denen wir uns im Alltag aufhalten. Durch die Andersartigkeit ihrer Bauweise verweisen sie auf eine Welt jenseits des hektischen Alltags. Als Räume der Stille können sie auf das Bedürfnis nach Intensität, nach Tiefe und nach sinnerfüllter Zeit antworten.[2]
Kirchenräume mit Schülerinnen und Schülern zu erschließen ist daher letztlich von der Absicht getragen, ihnen den Sinngehalt des christlichen Glaubens zu eröffnen, der in Kirchengebäuden zu Stein geworden ist. Denn Kirchen sind als außerschulische Lernorte lesbare „Texte“ vergangenen Lebens und geronnene Formen von Glauben und Gottesdienst unterschiedlicher Zeit.[3]
In Kirchengebäuden werden Gotteserfahrungen öffentlich zum Ausdruck gebracht. Hier zeigt sich Religion durch die Architektur, das Baumaterial und nicht zuletzt durch die Bilder, Skulpturen und Symbole, die man hier entdecken kann.
So vermitteln Kirchenräume durch ihren Reichtum religiöser Ausdrucksgestalten ein symbolisches Wissen vom Glauben und die Erfahrungen vorangegangener Generationen.
Kirchen sind zwar Zeugnisse vergangener oder auch gegenwärtiger Kultur, jedoch unterscheiden sie sich von Museen. Denn sie sind Orte gelebter Religiosität, in denen gebetet, Gottesdienste gefeiert und bedeutende Lebensübergänge (Taufe, Kommunion, Heirat, Tod) rituell gestaltet werden.[4]
b) elementare Zugänge
Wahrnehmen – deuten – handeln
Hans-Georg Ziebertz betont drei religionsdidaktische Lerndimensionen, die bei einer Begegnung und Erkundung von Kirchenräumen beachtet werden sollten: wahrnehmen, deuten und handeln.[5]
Religionspädagogisch ist zu beachten, dass die Kinder ihre eigenen Verstehens- und Deutungsweisen sowie ihre eigenen Weltzugänge und Weltbilder mitbringen, denn so geraten sie als Individuen in ihrem Eigenrecht in den Mittelpunkt des Unterrichts.
Angesichts der Negativ-Besetzung von „Kirche“ ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ihre Gefühle wahrnehmen lernen, wie es ihnen in der Kirche geht und welche Stimmungen sie in der Kirche haben. Die Kinder sollten die Gelegenheit bekommen in der Kirche frei umherzugehen und den Raum auf sich wirken zu lassen, um zu erspüren, ob sie sich willkommen, geborgen oder fremd und ungebeten fühlen. Zur Wahrnehmung des Kirchenraumes mit seinen Einrichtungen und Gegenständen sollten alle Sinne angesprochen werden, das Hören, Tasten, Bewegen, Riechen und Sehen.
In Kirchenräumen können die Schülerinnen und Schüler danach suchen, was diese von anderen Räumen unterscheidet. Sie können ihre Eindrücke deuten lernen, indem sie zum Beispiel erarbeiten, was die vielen Gegenstände in der Kirche bedeuten bzw. welche Funktion sie für den Gottesdienst haben.
Schließlich soll der Aspekt des Handelns direkt in den Blick genommen werden. Wahrnehmungen werden vertieft durch Handlungsmöglichkeiten bei der Kirchenraumerkundung, um die Dimensionen des „heiligen Raums Kirche“ leibhaftig zu erfahren.
Kirchenpädagogik in sakralen Räumen eröffnet die Möglichkeit, Religion in Gebrauch zu nehmen. Die Kinder nehmen den Kirchenraum als Raum der Stille für sich selbst wahr, aber auch als Raum der weltumspannenden Gemeinschaft der Christen. Sie können lernen, die Symbole des Kirchenraumes als „Zeichen der Nähe Gottes“ zu entdecken.[6]
c) elementare Erfahrungen
Anknüpfung an die Erfahrungen der Kinder
In einem erfahrungsorientierten Unterricht geht es darum, an die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen. Die Erschließung des Kirchenraumes soll ein Anstoß für die Kinder sein, Ähnlichkeiten zwischen überlieferten und eigenen Erfahrungen zu entdecken sowie eine Anregung, neue Erfahrungen zu machen.
Heutige Schülerinnen und Schüler suchen nach für sie lebensbedeutsamen Erfahrungen, die sie betreffen. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie nur das einleuchtend finden, was im Horizont ihrer eigenen Lebens- und Erfahrungswelt Sinn macht.[7]
Bereits in der Grundschule haben die Schülerinnen und Schüler im Lernbereich Ausdrucksformen des Glaubens und kirchliches Leben im Rahmen der Vorbereitungszeit auf das Fest der Erstkommunion ihre Pfarrgemeinde sowie den Kirchenraum mit seinen liturgischen Gegenständen näher kennen gelernt. Sie sind darauf aufmerksam geworden, dass Christen im Gottesdienst zusammen kommen, um miteinander im Glauben an Jesus Christus zu leben. An die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen soll hier angeknüpft werden. Dabei kann es im Religionsunterricht nicht darum gehen, quantitativ aufzählend Einzelelemente zu sammeln und diese „Listen“ als Unterrichtsergebnisse zu sichern.
[...]
[1] Lehrplan für die Realschulen in Bayern, 2000
[2] vgl. Liebau 1998, S. 243
[3] vgl. Degen 1998, S. 7
[4] vgl. Hilger 2006, S. 377
[5] vgl. Ziebertz 2003, S. 243 f
[6] vgl. Ziebertz 2005, S. 243f
[7] vgl. Schweitzer 2003, S. 19
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bietet der Kirchenraum als außerschulischer Lernort?
Er ermöglicht ein ganzheitliches, sinnenreiches Lernen durch die Begegnung mit sakraler Architektur, Kunst und Symbolik, was die Lernmotivation und Fragehaltung der Schüler fördert.
Welche drei religionsdidaktischen Dimensionen werden bei der Erkundung beachtet?
Nach Hans-Georg Ziebertz sind dies: Wahrnehmen (Sinneseindrücke), Deuten (Bedeutung der Symbole verstehen) und Handeln (aktive Erkundung und Einüben von Verhaltensweisen).
Wie unterscheidet sich eine Kirche von einem Museum für Schüler?
Im Gegensatz zum Museum ist die Kirche ein Ort gelebter Religiosität, an dem Riten wie Taufe oder Gebet stattfinden, was den Raum zu einem "lebendigen Text" des Glaubens macht.
Warum ist Stille ein wichtiger Aspekt beim Lernen im Kirchenraum?
Kirchen bieten als Räume der Stille einen Kontrast zum hektischen Alltag und ermöglichen Schülern, ein Gespür für Tiefe und sakrale Atmosphäre zu entwickeln.
Wie wird ein solcher Unterrichtsgang vorbereitet?
Die Vorbereitung umfasst die Klärung des Vorwissens, die Erarbeitung von Verhaltensregeln und die Einstimmung auf die Besonderheiten des Sakralraums, um eine gezielte Erkundung zu ermöglichen.
- Quote paper
- Johanna Mrowetz (Author), 2009, Der Kirchenraum als außerschulischer Lernort, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/138072