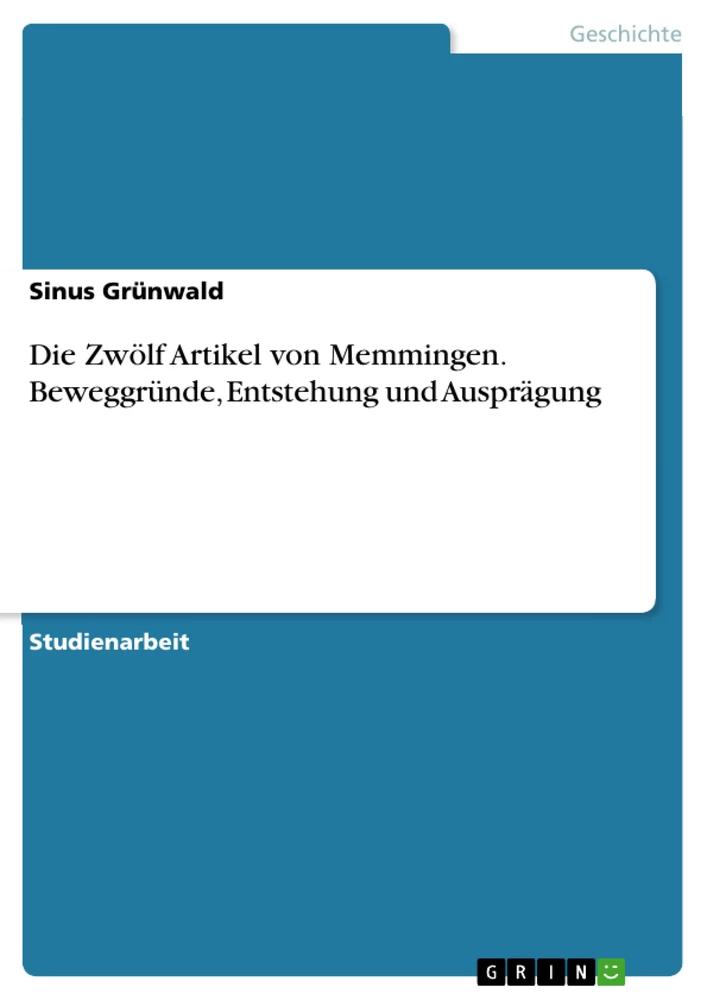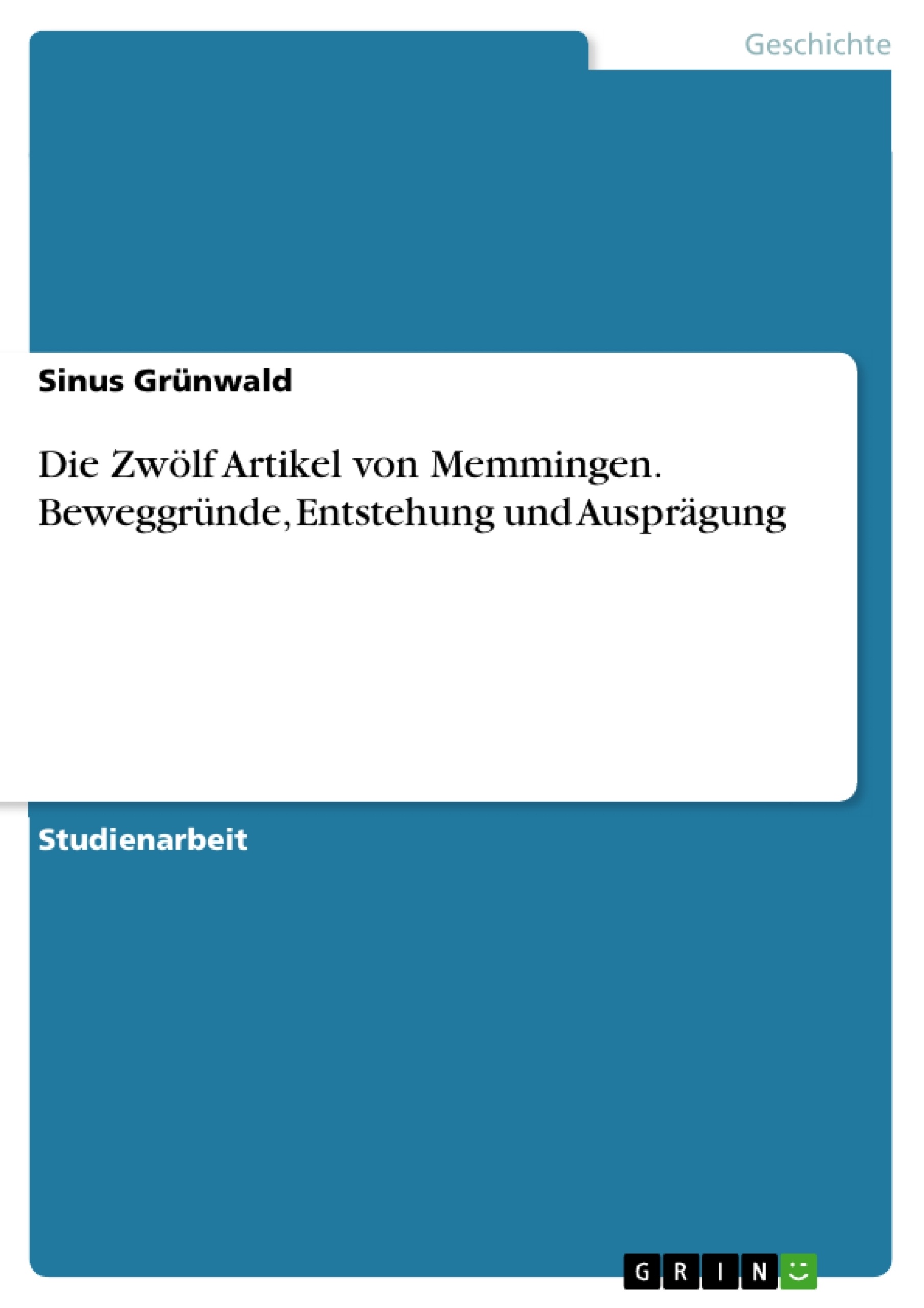Das Augenmerk in dieser Hausarbeit soll vor allem der Frage gelten, ob die Zwölf Artikel von Memmingen wirklich auf eine bäuerliche Erhebung im politischen Sinne abzielten oder ob sie nicht doch eher auf religiösen beziehungsweise auf rein sozioökonomischen Motiven fußten.
Der Anlass für solche Überlegungen ergibt sich aus diversen langfristigen Strukturveränderungen, wie gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und religiöser Art, die die Bauern betrafen und die indirekt in den Bauernkrieg mündeten, wie auch aus dem Inhalt der Zwölf Artikel selbst: Man bedenke nur den Einfluss der Verfasser des Manifests, Christoph Schappeler und Sebastian Lotzer, Prediger bzw. Anhänger der in dieser Zeit populären reformatorischen und antiklerikalen Bewegung. Auf Basis dieser beiden oben genannten Themenfelder soll die Dimension der Zwölf Artikel erörtert werden.
Mit dieser Problematik geht auch die Frage einher, welches Maß politischer Motivation sie beinhalten, d. h. ob der gemeine Mann zu Land und zu Stadt mit den Zwölf Artikeln, wie von Peter Blickle vorgeschlagen, u. a. auch revolutionäre Ziele verfolgte. Hierfür wird zuerst auf eine allgemeingültige Definition von „Revolution“ sowie auf für dieses Thema erwähnenswerte historiographische Deutungen einzugehen sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen und Hintergründe
- Demographische Entwicklung und Veränderung der gesellschaftlichen Struktur
- Die sozioökonomische Situation auf dem Land
- Die Entstehung des frühneuzeitlichen Territorialstaates
- Die antiklerikale Bewegung
- Die Zwölf Artikel
- Ihre Verfasser
- Analyse der Zwölf Artikel bzgl. ihres religiösen, sozioökonomischen und politischen Gehalts
- Ergebnisse
- Die Zwölf Artikel als revolutionäres Manifest?
- Zum Revolutionsbegriff
- Analyse der Zwölf Artikel bzgl. ihres revolutionären Gehalts
- Historiographische Deutungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Analyse der Zwölf Artikel von Memmingen im Kontext des deutschen Bauernkriegs 1524-1526. Dabei sollen die Beweggründe, Entstehung und Ausprägung des Manifests beleuchtet werden. Insbesondere soll untersucht werden, ob die Zwölf Artikel tatsächlich auf eine bäuerliche Erhebung im politischen Sinne zielten oder ob sie primär auf religiösen und/oder sozioökonomischen Motiven fußten.
- Sozioökonomische Hintergründe des Bauernkriegs, insbesondere die demographische Entwicklung und die Veränderung der gesellschaftlichen Struktur
- Die wirtschaftliche Situation der Bauern und die ökonomischen Belastungen durch die Lehensherren
- Der Einfluss der reformatorischen und antiklerikalen Bewegung auf die Entstehung der Zwölf Artikel
- Die religiösen, sozioökonomischen und politischen Inhalte der Zwölf Artikel
- Die Frage nach dem revolutionären Gehalt der Zwölf Artikel und die Diskussion um den Revolutionsbegriff
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die These von Peter Blickle zur „Revolution des Gemeinen Mannes“ vor und führt in die Problematik der Zwölf Artikel als Manifest ein. Die Arbeit soll die Dimension des Manifests und seine Beziehung zu religiösen und sozioökonomischen Motiven untersuchen.
- Ursachen und Hintergründe: Dieses Kapitel beleuchtet die demographische Entwicklung und die Veränderung der gesellschaftlichen Struktur im 14. und 15. Jahrhundert. Es untersucht die Auswirkungen des „Schwarzen Todes“ und den darauffolgenden wirtschaftlichen Aufschwung, die zu einer Verschärfung der Leibeigenschaft führten. Außerdem wird die sozioökonomische Situation der Bauern und die ökonomischen Belastungen durch die Lehensherren näher beleuchtet.
- Die Zwölf Artikel: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Verfassern der Zwölf Artikel, Christoph Schappeler und Sebastian Lotzer, und deren Bezug zur reformatorischen und antiklerikalen Bewegung. Es analysiert die Zwölf Artikel in Bezug auf ihren religiösen, sozioökonomischen und politischen Gehalt.
- Die Zwölf Artikel als revolutionäres Manifest?: Dieses Kapitel definiert den Revolutionsbegriff und untersucht die Zwölf Artikel in Bezug auf ihren revolutionären Gehalt. Es beleuchtet die historische Forschung zu den Zwölf Artikeln und den Bauernkrieg, insbesondere die Ansichten von Peter Blickle, Günther Franz und Rudolf Endres.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Bauernkrieg, Zwölf Artikel, Memmingen, Leibeigenschaft, Reformation, antiklerikale Bewegung, Sozioökonomie, Revolution, Historiographie, Peter Blickle, Günther Franz, Rudolf Endres.
- Arbeit zitieren
- Sinus Grünwald (Autor:in), 2014, Die Zwölf Artikel von Memmingen. Beweggründe, Entstehung und Ausprägung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1375931