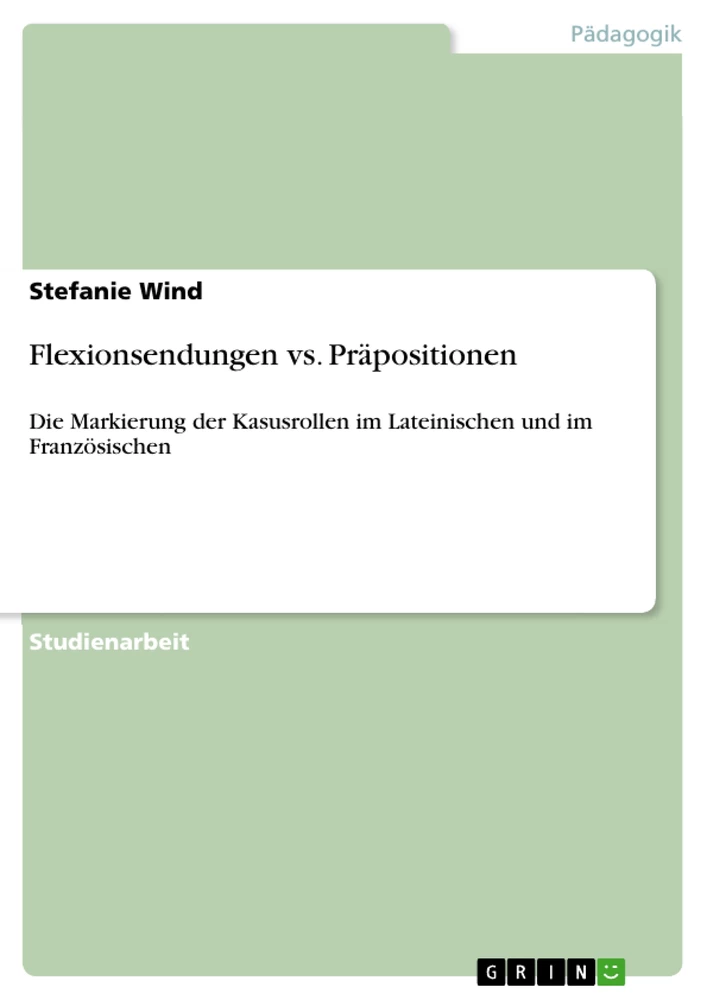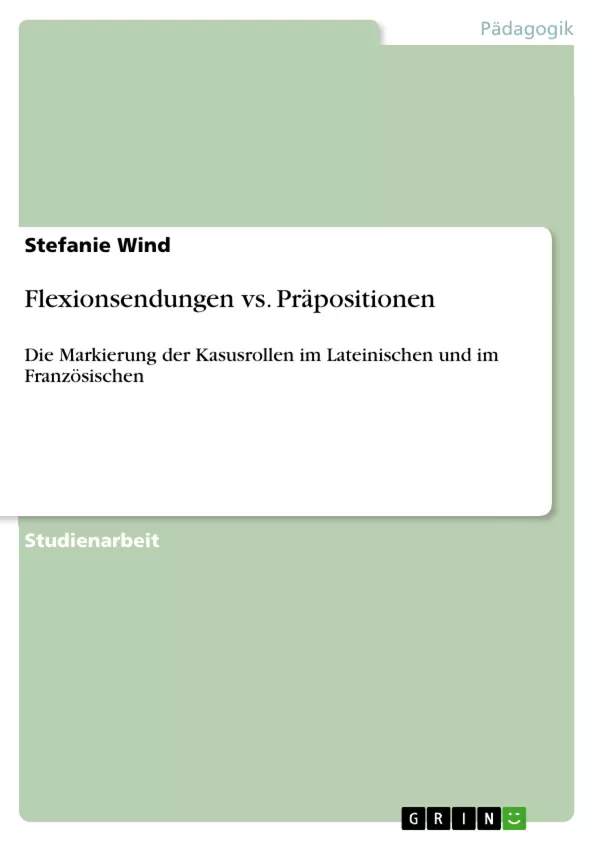Obwohl die romanischen Sprachen alle aus dem Lateinischen hervorgegangen sind und daraus zahlreiche sprachliche Erscheinungen übernommen haben, weisen sie gegenüber der gemeinsamen Ursprungssprache einen deutlichen Unterschied in einem zentralen Teil der Syntax auf: Das lateinische Kasussystem baute sich im Laufe der Sprachentwicklung radikal ab und formte sich um in ein sprachliches System, in dem die Mehrzahl der syntaktischen Relationen durch Präpositionen markiert werden. Die Menge dieser kleinen, für die Herstellung syntaktischer Zusammenhänge aber enorm wichtigen Wörter fand bereits würdiges Interesse in der Sprachwissenschaft. Besonders in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfuhr die Forschung um die französischen Präpositionen neuen Aufwind unter verschiedenen Aspekten. Zumeist handelt es sich in den einschlägigen Arbeiten jedoch um synchronische Betrachtungen. Diachronische Untersuchungen liegen weiter zurück. Wie und warum sich im Französischen und in den romanischen Sprachen überhaupt die Präpositionen in solchem Maß, wie Textuntersuchungen es beweisen, durchgesetzt haben, ist bisher nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Auch in den Monographien, die ausdrücklich den Übergang vom Lateinischen zum Romanischen oder auch konkret zum Französischen untersuchen, wird zwar stets auf den Verlust der lateinischen Kasus hingewiesen, aber die Frage, durch welche Mittel die im Lateinischen durch Kasusendungen ausgedrückten Satzfunktionen in den modernen romanischen Sprachen markiert werden, wurde noch nicht systematisch aufgearbeitet. Die vorliegende Arbeit soll zumindest einen Schritt in diese Richtung machen. Nach einer knappen Darstellung der Problematiken bei der Markierung von Satzgliedern durch Kasusendungen im Lateinischen soll die Häufigkeit von Präpositionen, die bereits in den frühesten lateinischen Sprachstufung eine Alternative oder Ergänzung zum kasuellen System bildeten, in verschiedenen Epochen und Sprachstufen des Lateinischen untersucht werden. Ein starker Fokus wird dabei auf das Vulgärlateinische als Scharnierstelle zwischen klassischem Latein und romanischen Entwicklungen geworfen. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit wird die Situation im Altfranzösischen nur in knappen Grundzügen einbezogen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hinführung
- 2. Die Syntax des klassischen Latein – Regeln und Ausnahmen
- 2.1 Das Grundprinzip der Flexion und seine Schwachstellen
- 2.2 Der Gebrauch von Präpositionen
- 2.3 Das Inventar der lateinischen Präpositionen
- 2.4 Auswertung vorklassischer und klassisch-lateinischer Texte
- 2.4.1 Vorgehen bei der Auswertung
- 2.4.2 Zur Textauswahl
- 2.4.3 Statistische Auswertung der Texte im Vergleich
- 2.4.4 Besondere Feststellungen zur Auswertung des Präpositionsgebrauchs
- 3. Die Entwicklung der lateinischen Syntax auf dem Weg zu den modernen romanischen Sprachen
- 3.1 Entwicklungstendenzen im gesprochenen Latein und im Protoromanischen
- 3.2 Verdeutlichungsprozesse und Umstrukturierung des Systems
- 3.2.1 Abbau der Kasusflexion
- 3.2.2 Folge: Zunahme im Gebrauch von Präpositionen?
- 3.2.3 Die vulgärlateinischen Präpositionen
- 3.3 Auswertung vulgär- und spätlateinischer Texte
- 3.3.1 Zur Textauswahl
- 3.3.2 Statische Auswertung hinsichtlich des Präpositionsgebrauchs
- 3.3.3 Einzelauswertung von den Freigelassenengesprächen in Petrons Satyricon
- 3.3.3.1 Allgemeine Erkenntnisse
- 3.3.3.2 Präposition in Verbindung mit einem falschen Kasus
- 3.3.3.3 Unübliche Verwendung von Präpositionen
- 3.3.4 Einzelauswertung des Reiseberichts der Nonne Egeria
- 3.3.4.1 Allgemeine Erkenntnisse
- 3.3.4.2 Präpositionen in Verbindung mit einem falschen Kasus
- 3.3.4.3 Präpositionen in Verbindung mit einem indeklinablen Eigennamen
- 3.3.4.4 Unübliche Verwendung von Präpositionen
- 3.3.4.5 Präpositionalkonstruktion als Kasusersatz
- 3.3.4.6 Präposition + Präposition / Adverb
- 3.3.5 Fazit
- 4. Die romanischen Präpositionen
- 4.1 Allgemeine Entwicklungen
- 4.2 Beispiel: Altfranzösisch
- 5. Kasusmarkierung im modernen Französisch
- 5.1 Allgemeine Tendenzen
- 5.2 Inventar der französischen Präpositionen
- 5.3 Auswertung französischer Texte
- 6. Gegenüberstellung lateinischer Kasus und französischer Präpositionalphrasen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Kasusmarkierung vom klassischen Latein zu den modernen romanischen Sprachen, insbesondere Französisch. Sie analysiert den Abbau des lateinischen Kasussystems und die zunehmende Verwendung von Präpositionen als Kompensationsmechanismus. Der Fokus liegt auf der diachronischen Entwicklung und dem Vergleich verschiedener Sprachstufen.
- Abbau der Kasusflexion im Lateinischen
- Zunehmende Bedeutung von Präpositionen in der romanischen Sprachentwicklung
- Vergleich der Kasusmarkierung im Lateinischen und im Französischen
- Analyse von Textkorpora aus verschiedenen Epochen des Lateinischen und des Französischen
- Die Rolle des Vulgärlateins als Bindeglied zwischen klassischem Latein und den romanischen Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hinführung: Diese Einleitung beschreibt die Forschungslücke bezüglich des Übergangs vom lateinischen Kasussystem zum präpositionsbasierten System der romanischen Sprachen. Sie hebt die Notwendigkeit einer diachronischen Untersuchung hervor und skizziert den Aufbau der vorliegenden Arbeit, die einen Beitrag zur Klärung dieses Übergangs leisten soll. Die Autorin betont den Mangel an umfassenden diachronischen Studien, im Gegensatz zu den zahlreichen synchronischen Arbeiten.
2. Die Syntax des klassischen Latein – Regeln und Ausnahmen: Dieses Kapitel untersucht die Syntax des klassischen Latein, insbesondere das Prinzip der Flexion und dessen Schwächen. Es werden Beispiele gegeben, die die Stellungsfreiheit der Satzglieder aufgrund der eindeutigen Kasusmarkierung durch Flexionsendungen verdeutlichen. Die Ambiguität einiger Endungen wird als Schwachstelle des Systems hervorgehoben, was den späteren Wandel hin zu präpositionalen Konstruktionen vorbereitet.
3. Die Entwicklung der lateinischen Syntax auf dem Weg zu den modernen romanischen Sprachen: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklungstendenzen in der lateinischen Syntax, insbesondere den Abbau der Kasusflexion und die zunehmende Verwendung von Präpositionen. Es analysiert verschiedene Sprachstufen des Lateinischen, vom gesprochenen Latein über das Vulgärlatein bis hin zu spätlateinischen Texten. Die Analyse konzentriert sich auf die Veränderungen im Präpositionsgebrauch und wie diese den Verlust der Kasus kompensieren. Die detaillierte Auswertung von Textbeispielen wie den Freigelassenengesprächen aus Petrons Satyricon und dem Reisebericht der Nonne Egeria liefert konkrete Belege für diese Entwicklungen.
4. Die romanischen Präpositionen: Dieses Kapitel befasst sich mit der allgemeinen Entwicklung der Präpositionen in den romanischen Sprachen und gibt ein Beispiel anhand des Altfranzösischen. Es stellt einen Übergang zu den folgenden Kapiteln dar, welche den Präpositionsgebrauch im modernen Französisch näher beleuchten.
5. Kasusmarkierung im modernen Französisch: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Kasusmarkierung im modernen Französisch. Es analysiert die allgemeinen Tendenzen des Präpositionsgebrauchs, untersucht das Inventar der französischen Präpositionen und wertet französische Texte aus, um die Verwendung der Präpositionen im modernen Französisch zu belegen.
6. Gegenüberstellung lateinischer Kasus und französischer Präpositionalphrasen: Dieses Kapitel stellt eine umfassende Gegenüberstellung der lateinischen Kasus und der entsprechenden französischen Präpositionalphrasen dar, womit die zentrale These der Arbeit – den Wandel in der Markierung von syntaktischen Funktionen – final untermauert wird.
Schlüsselwörter
Lateinische Syntax, Kasusflexion, Präpositionen, Vulgärlatein, Protoromanisch, Altfranzösisch, Modernes Französisch, Diachronie, Sprachwandel, syntaktische Funktionen, Textanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Wandel der Kasusmarkierung vom Klassischen Latein zu den modernen romanischen Sprachen"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Wandel der Kasusmarkierung vom klassischen Latein zu den modernen romanischen Sprachen, insbesondere Französisch. Der Fokus liegt auf dem Abbau des lateinischen Kasussystems und der zunehmenden Verwendung von Präpositionen als Kompensationsmechanismus. Die Studie verfolgt einen diachronischen Ansatz und vergleicht verschiedene Sprachstufen.
Welche Sprachstufen werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Sprachstufen des Lateinischen, beginnend mit dem klassischen Latein, über das gesprochene Latein und das Vulgärlatein bis hin zu spätlateinischen Texten. Zusätzlich wird das Altfranzösisch und das moderne Französisch untersucht, um den diachronen Wandel zu verdeutlichen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine diachrone Analyse, die verschiedene Sprachstufen vergleicht. Ein wichtiger Bestandteil der Methode ist die statistische Auswertung von Textkorpora aus unterschiedlichen Epochen. Es werden sowohl klassische lateinische Texte als auch vulgärlateinische und spätlateinische Texte (z.B. Freigelassenengespräche aus Petrons Satyricon und der Reisebericht der Nonne Egeria) sowie altund modernfranzösische Texte analysiert. Die Auswertung konzentriert sich auf den Gebrauch von Präpositionen und deren Funktion im Kontext des Kasusverlustes.
Welche konkreten Texte werden ausgewertet?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Freigelassenengespräche aus Petrons Satyricon und den Reisebericht der Nonne Egeria als Beispiele für vulgär- und spätlateinische Texte. Zusätzlich werden klassisch-lateinische Texte und moderne französische Texte ausgewertet, um den Wandel im Präpositionsgebrauch zu dokumentieren.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen umfassen den Abbau der Kasusflexion im Lateinischen, die zunehmende Bedeutung von Präpositionen in der romanischen Sprachentwicklung, den Vergleich der Kasusmarkierung im Lateinischen und Französischen, die Analyse von Textkorpora aus verschiedenen Epochen und die Rolle des Vulgärlateins als Bindeglied zwischen klassischem Latein und den romanischen Sprachen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Hinführung, ein Kapitel zur Syntax des klassischen Latein, ein Kapitel zur Entwicklung der lateinischen Syntax hin zu den romanischen Sprachen, ein Kapitel zu den romanischen Präpositionen, ein Kapitel zur Kasusmarkierung im modernen Französisch und abschließend ein Kapitel zur Gegenüberstellung lateinischer Kasus und französischer Präpositionalphrasen.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These der Arbeit ist die Darstellung des Wandels in der Markierung syntaktischer Funktionen vom kasusbasierten System des klassischen Latein zum präpositionsbasierten System der romanischen Sprachen, insbesondere des Französischen. Der Verlust der Kasusflexion wird als Motor für die zunehmende Verwendung von Präpositionen als Kompensationsmechanismus identifiziert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lateinische Syntax, Kasusflexion, Präpositionen, Vulgärlatein, Protoromanisch, Altfranzösisch, Modernes Französisch, Diachronie, Sprachwandel, syntaktische Funktionen, Textanalyse.
- Quote paper
- Stefanie Wind (Author), 2009, Flexionsendungen vs. Präpositionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/137224