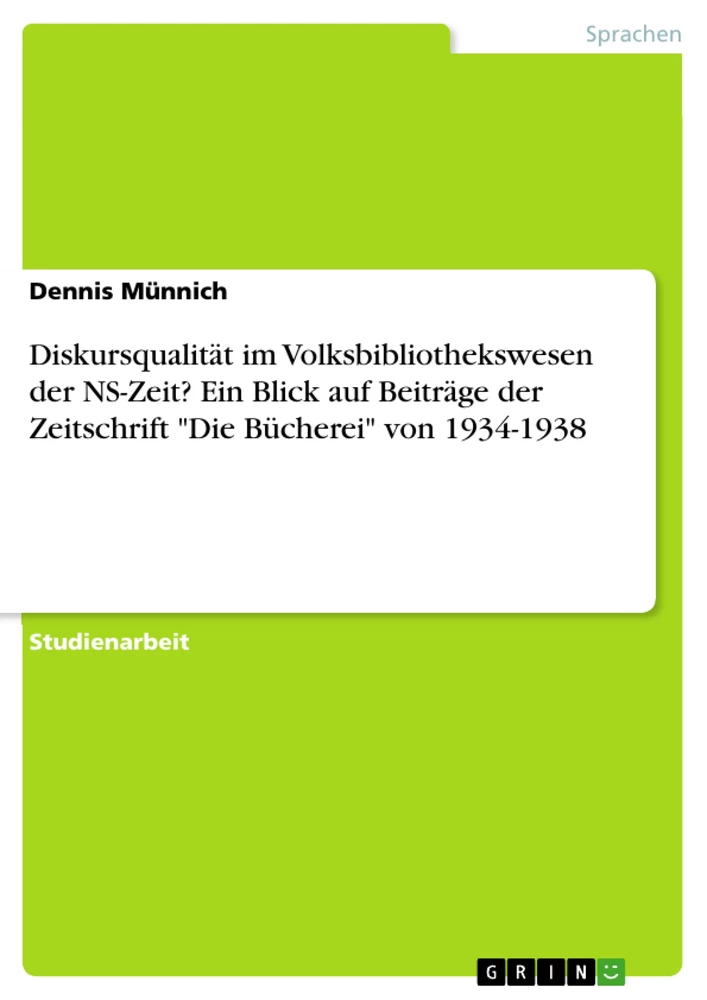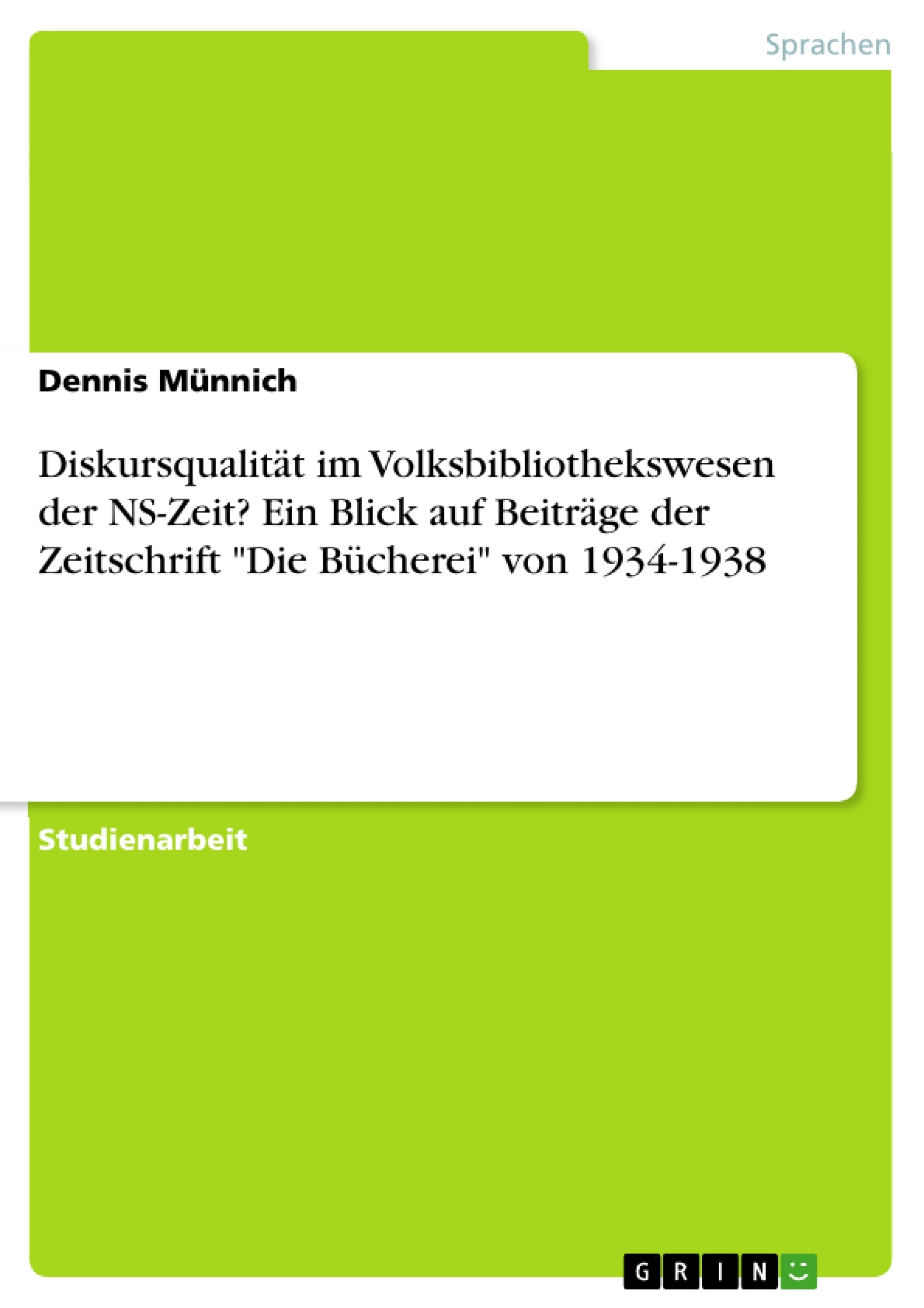Das Volksbüchereiwesen war während der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland ein bedeutendes Instrument der ideologischen Beeinflussung und Kontrolle der Bevölkerung. Die Bibliotheken wurden einer strengen Überwachung und Lenkung durch die Regierung unterworfen und sollten dazu dienen, das nationalsozialistische Gedankengut zu verbreiten und die Menschen entsprechend zu erziehen. Die Aufarbeitung von Biografien der einzelnen Bibliothekare gestaltet sich dabei als schwierig, da die Vergangenheitsbewältigung der NS-Zeit in Deutschland generell bis in die 80er tabuisiert war, wovon letztlich auch das Bibliothekswesen betroffen war. Mittlerweile gibt es zu diesem Thema umfangreiche Literatur, die sich einer gesamtheitlichen oder speziellen Analyse verschiedener Teilbereiche des Bibliothekswesens zur NS-Zeit angenommen hat.
Hinsichtlich der Einordnung des Verhaltens von Volksbibliothekaren gibt es dennoch Lücken in der Forschungsliteratur, bspw. wenn es um die Frage der Diskursqualität innerhalb dieses Berufsstands geht und im Speziellen die der Verbandszeitschrift ‚Die Bücherei‘. Betrachtet man sie als Sprachrohr für Volksbibliothekare, kann untersucht werden, welche Tonalität in der Zeitschrift vorgeherrscht hat und ob sich Beiträge im Sinne des NS-Regimes als angemessen, zurückhaltend oder übertrieben einordnen lassen. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bildungsanspruch der Volksbibliothekare, welcher als Ergebnis des sogenannten Richtungsstreits entstanden ist. Zudem soll die Sprache in Beiträgen ranghoher Volksbibliothekare analysiert werden, um Einblicke in die diskursive Praxis zu gewinnen. Ein weiterer Fokus der Arbeit liegt auf der Diskursqualität ausgewählter Themenschwerpunkte: Parteibibliotheken, Ausleihsystem, Prachtwerke und die Neuordnung der Ausbildung zum Volksbibliothekar. Die Hausarbeit soll im Großen und Ganzen dazu dienen, anhand der Gestaltung der Verbandszeitschrift „Die Bücherei“ eine Perspektive auf die Diskursqualität im Volksbüchereiwesen zu erhalten.
Indem mit Blick auf den Richtungsstreit zum Thema herangeführt werden soll, findet eine Quellenanalyse statt, die das Wirken (ranghoher) Volksbibliothekare in Bezug auf die vorherrschende Diskursqualität darstellen soll. Dabei werden ausgewählte Aufsätze der Zeitschrift der Jahrgänge 1934-1938 betrachtet und die Forschungsliteratur wird unterstützend herangezogen.
Inhalt
1. Einleitung
1.1 Fragestellung, Zielsetzung und Methode
1.2 Forschungsbericht
1.3 Quellenbericht
2. Der volksbibliothekarische Bildungsanspruch als Ergebnis des Richtungsstreits
3. Sprache in Beiträgen ranghoher Volksbibliothekare
3.1 Wilhelm Schuster
3.2 Franz Schriewer
4. Diskursqualität anhand ausgewählter Themenschwerpunkte
4.1 Überblick über die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten von Diskurs
4.2 Notwendigkeit von Parteibibliotheken
4.3 Debatte um das Ausleihsystem
4.4 Kampf gegen Prachtwerke
4.5 Abbildung der Neuordnung der Ausbildung zum Volksbibliothekar
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
6.1 Quellen
6.2 Forschungsliteratur
1. Einleitung
1.1 Fragestellung, Zielsetzung und Methode
Das Volksbüchereiwesen war während der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland ein bedeutendes Instrument der ideologischen Beeinflussung und Kontrolle der Bevölkerung. Die Bibliotheken wurden einer strengen Überwachung und Lenkung durch die Regierung unterworfen und sollten dazu dienen, das nationalsozialistische Gedankengut zu verbreiten und die Menschen entsprechend zu erziehen. Die Aufarbeitung von Biografien der einzelnen Bibliothekare gestaltet sich dabei als schwierig, da die Vergangenheitsbewältigung der NS-Zeit in Deutschland generell bis in die 80er tabuisiert war, wovon letztlich auch das Bibliothekswesen betroffen war. Mittlerweile gibt es zu diesem Thema umfangreiche Literatur, die sich einer gesamtheitlichen oder speziellen Analyse verschiedener Teilbereiche des Bibliothekswesens zur NS-Zeit angenommen hat.
Hinsichtlich der Einordnung des Verhaltens von Volksbibliothekaren gibt es dennoch Lücken in der Forschungsliteratur, bspw. wenn es um die Frage der Diskursqualität innerhalb dieses Berufsstands geht und im Speziellen die der Verbandszeitschrift ‚Die Bücherei‘. Betrachtet man sie als Sprachrohr für Volksbibliothekare, kann untersucht werden, welche Tonalität in der Zeitschrift vorgeherrscht hat und ob sich Beiträge im Sinne des NS-Regimes als angemessen, zurückhaltend oder übertrieben einordnen lassen. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bildungsanspruch der Volksbibliothekare, welcher als Ergebnis des sogenannten Richtungsstreits entstanden ist. Zudem soll die Sprache in Beiträgen ranghoher Volksbibliothekare analysiert werden, um Einblicke in die diskursive Praxis zu gewinnen. Ein weiterer Fokus der Arbeit liegt auf der Diskursqualität ausgewählter Themenschwerpunkte: Parteibibliotheken, Ausleihsystem, Prachtwerke und die Neuordnung der Ausbildung zum Volksbibliothekar. Die Hausarbeit soll im Großen und Ganzen dazu dienen, anhand der Gestaltung der Verbandszeitschrift „Die Bücherei“ eine Perspektive auf die Diskursqualität im Volksbüchereiwesen zu erhalten.
Indem mit Blick auf den Richtungsstreit zum Thema herangeführt werden soll, findet eine Quellenanalyse statt, die das Wirken (ranghoher) Volksbibliothekare in Bezug auf die vorherrschende Diskursqualität darstellen soll. Dabei werden ausgewählte Aufsätze der Zeitschrift der Jahrgänge 1934-1938 betrachtet und die Forschungsliteratur wird unterstützend herangezogen.
1.2 Forschungsbericht
Wie bereits erwähnt, war die Auseinandersetzung mit Volksbibliothekaren erst nach den 80ern Gegenstand der Forschung aber kam seitdem zu relativ einheitlichen Erkenntnissen. Die meisten Publikationen attestieren dem Volksbibliothekswesen Angepasstheit und Naivität. Ausschläge Richtung Widerstand blieben selten und fanden vor allem im Hintergrund statt, während Tendenzen zur ideologischen Radikalisierung durchaus vorhanden seien, da sie gerne gesehen und wohl auch förderlich für die berufliche Karriere waren. Das zentrale Werk für die Aufarbeitung der NS-Geschichte des Volksbibliothekswesens stellt Kuttners und Vodoseks Publikation dar, in der mithilfe umfangreicher Beiträge des Wolfenbütteler Arbeitskreises verschiedene Biografien von Volksbibliothekaren in den Fokus gerückt werden. Die Ergebnisse wurden in der Nachbetrachtung zu einer vielzitierten und vor allem vielresümierten Schriftenreihe, da sie in einem schwierig zu durchdringenden Forschungsfeld Licht ins Dunkel brachten; u.a. Babendreier widmete sich in einem solchen Aufsatz diesem Thema.1 Vodosek beschäftigte sich auch mit der historischen Ausbildung zum Volksbibliothekar.2 Auch Barbians umfassende Darstellung der Literaturpolitik im Dritten Reich3 wurde für die Erarbeitung des Themas herangezogen.
1.3 Quellenbericht
Im Rahmen der vorliegenden Quellenanalyse erfolgt eine umfangreiche Durchsicht einer Vielzahl von Beiträgen der Verbandszeitschrift "Die Bücherei" aus den Jahrgängen von 1934 bis 1938. Hierbei werden spezifische Texte aus den Kategorien "Aufsätze", "Erlasse und Verfügungen", "Aus der Fachschaft - für die Fachschaft. Nachrichten", sowie den "Thematischen Sammelbesprechungen" und "Einzelbesprechungen" der "Bücherschau" in Betracht gezogen, welche von der Fachzeitschrift selbst definiert wurden. Der Selektionsprozess der Texte ist dabei von subjektiver Natur und orientiert sich im Wesentlichen an der Erwartungshaltung, relevante Erkenntnisse für die Argumentation zu gewinnen. Es sei angemerkt, dass aufgrund der verstärkten Kontrolle durch das NS-Regime die Verbandszeitschrift des VDV immer abhängiger von staatlicher Kontrolle wurde. In diesem Sinne erweisen sich vor allem die Beiträge aus den frühen Jahrgängen von besonderem Interesse.
2. Der volksbibliothekarische Bildungsanspruch als Ergebnis des Richtungsstreits
Das Volksbüchereiwesen in Deutschland wurde vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten von verschiedenen Strömungen und Richtungsstreitigkeiten geprägt. Einer der wichtigsten dieser Streitpunkte war der Bildungsanspruch der Volksbüchereien. Eine Gruppe von Bildungsbürgern und Intellektuellen betonte den Bildungsanspruch der Volksbüchereien. Sie forderten, dass die Bibliotheken nicht nur Unterhaltungsliteratur, sondern auch klassische Werke, wissenschaftliche Literatur und geistige Strömungen zugänglich machen sollten. Für sie stand die Förderung der Allgemeinbildung und die Unterstützung der Lesekultur im Vordergrund. Auf der anderen Seite standen Verwaltungsexperten und Kommunalpolitiker, die sich für eine effiziente Organisation der Volksbüchereien einsetzten. Sie betonten, dass die Bibliotheken vor allem Unterhaltungsliteratur anbieten sollten, um möglichst vielen Menschen den Zugang zur Lesekultur zu ermöglichen. Dieser Richtungsstreit wurde durch den Ersten Weltkrieg und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Zwischenkriegszeit verstärkt. Die Vertreter der Verwaltungsrichtung argumentierten, dass angesichts knapper finanzieller Ressourcen die Bibliotheken vor allem als Verwaltungseinrichtungen zu betrachten seien. Die Vertreter der Bildungsrichtung hielten dagegen, dass gerade in Krisenzeiten der Bildungsanspruch der Bibliotheken umso wichtiger sei, um den Menschen Orientierung und Halt zu geben. Der Streit war auch zur Zeit der Machtergreifung nicht endgültig entschieden aber die eindringliche Auseinandersetzung mit dem Thema führte dazu, dass sich erstmals Volksbibliothekare mit ihrem eigenen Bildungsanspruch auseinandersetzten. Dadurch gab es durchaus einen Nährboden für die Idee, den Leser durch Bibliotheksarbeit nachhaltig zu beeinflussen. Ohne diesen Richtungsstreit wären mit dem Verwaltungsinstitut der Bibliothek und der Propagandamaschine NSDAP zwei grundsätzlich unterschiedliche Mentalitäten aufeinandergetroffen. Obwohl es dem NS-Regime aufgrund seiner Machtstellung und ideologischen Ausrichtung zuzutrauen gewesen wäre, dieses Problem im Keim zu ersticken, ist es dennoch spannend zu hinterfragen, ob dies eine unterschiedliche Herangehensweise erfordert hätte.
3. Sprache in Beiträgen ranghoher Volksbibliothekare
Bevor sich auf spezifische Themenschwerpunkte konzentriert wird, ist es angebracht, einen Blick auf das Wirken der zwei einflussreichsten Volksbibliothekare zu werfen. Schuster und Schriewer waren nicht nur an verschiedenen Themenbereichen beteiligt, sondern gleichzeitig die am häufigsten publizierenden Autoren. Es kann davon ausgegangen werden, dass ihr Einfluss auf die Inhaltslinie der Bibliothek durch ihr kontinuierliches Mitwirken prägend war.
3.1 Wilhelm Schuster
Spricht man vom deutschen Volksbibliothekswesen zur NS-Zeit gibt es einige Namen, die zwangsläufig genannt werden müssen; der erste ist der von Wilhelm Schuster. Er war als Leiter des VDV hauptverantwortlich für die Inhaltslinie der Verbandszeitschrift und soll daher in dieser Ausarbeitung besonders große Beachtung finden. Der Verband entschied sich, die erste Ausgabe mit Schusters Ansprache zur Jahresversammlung des VDB vom September 1933 einzuweihen, in der er feierlich verkündete: „Wer ein Deutscher ist, der folgt dem Ruf.“4 Der erste Beitrag kann als richtungsweisend bezeichnet werden und wird daher einer längeren Betrachtung unterzogen werden. Schuster berichtet von der Machtergreifung im Sinne eines vollumfassenden Neuanfangs, als „Anbruch des großen Befreiungskampfes, den zum siegreichen Ende zu führen unsere Aufgabe […] sein wird.“5 Wenn er – als ehemaliger Soldat – in martialischer Sprache davon spricht, die deutsche Volksbücherei zu mobilisieren für den „Kampf um die Seele“6, wird er nicht müde zu betonen, dass es sich dabei um „unsere Bewegung“7 handelt. Schuster war früh bestrebt, möglichst klarzumachen, wie das Aufgabenprofil der Volksbibliothek und insbesondere das der Volksbibliothekare auszusehen hat: „Sie, meine Berufsgenossen […] Bildner am Volke und […] Erzieher zum Volke“.8 Ihm gehe es um eine neue Idee der deutschen Bildung und ihrer Methoden. Ihm sollte dafür später eine „vorauseilende Überangepasstheit“9 attestiert werden. Dabei schreckt er nicht davor zurück, offen anzusprechen, dass die Erziehung Rassenkunde und Genetik in den Mittelpunkt der Büchereiarbeit rücken soll und der Bibliothekar als Volksbildner die Pflicht habe, „diese innerste Zelle des neuen Bildungsideals rein zu halten“.10 Er macht an dieser Stelle seine Einstellung zur Rassenlehre mehr als deutlich. Er spricht stets von der Erziehungsbewegung, für die es auch entscheidend sei, nicht nur die Jugend zum Nationalsozialismus zu erziehen und er sei sich sicher, „daß unter Ihnen […] niemand sein kann, der nicht mit uns aus der Idee dieser neuen nationalsozialistischen Bildung […] ehrlich und begeistert zu arbeiten bereit ist“11. Gleiches gab er für das Volksbüchereiwesen aus: „als solche wird sie ein Teil der großen Erziehungsbewegung aus nationalsozialistischem Geiste und zum Nationalsozialismus sein, oder sie wird nicht sein.“12 An dieser Stelle wird deutlich, dass Schuster an der Notwendigkeit der vollständigen Ideologisierung seines Berufsstandes keinen Zweifel lässt. Die Zeitschrift erachtet diese Textstelle als so bedeutend, dass sie diese durch Leerzeichen nach jedem Buchstaben hervorhebt, was die gängige Methode der Zeitschrift darstellt. Wilhelm Schuster kann man im Verlauf seiner Rede weitere Eigenschaften zuschreiben; bspw. agiert er opportunistisch, wenn er Schund- und Schmutzliteratur im Leihbibliothekensystem kurzfristig duldet, wenngleich er sie als „volkszersetzendes Gift“13 bezeichnet, das für die Volksbibliotheken klein gehalten werden solle. Seine Rede schließt er mit einem Hitler-Zitat, das die ideologische Bestandsausrichtung legitimieren soll: „wer die Kultur nach der Seite ihres materiellen Gewinns einschätzen will […] hat keine Ahnung ihres Wesens und ihrer Aufgaben.“14
[...]
1 Babendreier, Jürgen. Volksbibliothekare in der Waffenkammer. Bericht über die Jahrestagung 2015 des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte. AKMB-News: Informationen Zu Kunst, Museum Und Bibliothek 22(1), 2016.
2 Vodosek, Peter. Die bibliothekarische Ausbildung in Deutschland von ihren Anfängen bis 1970. In: Lifelong education and libraries, 2. Department of Lifelong Education and Libraries, Graduate School of Education, Kyoto University, 2002.
3 Barbian, Jan-Pieter: Literaturpolitik im Dritten Reich. Institutionen, Kompetenzen, Betätigungsfelder. Frankfurt am Main: Buchhändler-Vereinigung GmbH, 1993.
4 Schuster, Wilhelm: Bücherei und Nationalsozialismus. Ansprache zur Jahresversammlung des VDV. In: Die Bücherei 1 (1934), H.1, S.1-9, hier S. 2.
5 ebd., S. 1.
6 ebd., S. 2.
7 ebd.
8 ebd., S. 1.
9 Babendreier: Volksbibliothekare in der Waffenkammer (2017), S. 45.
10 Schuster: Bücherei und Nationalsozialismus (1934), S. 4.
11 ebd., S. 2.
12 ebd., S. 3.
13 ebd., S. 7.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Einleitung?
Die Einleitung umreißt die Fragestellung, Zielsetzung und Methode der Analyse des Volksbüchereiwesens während der Zeit des Nationalsozialismus. Sie betont, dass die Bibliotheken ein Instrument zur ideologischen Beeinflussung waren und die Aufarbeitung der Biografien der Bibliothekare schwierig ist. Die Forschungsliteratur zu diesem Thema wird erwähnt, sowie die Lücken bezüglich der Diskursqualität innerhalb des Berufsstands, insbesondere in der Verbandszeitschrift ‚Die Bücherei‘. Der Bildungsanspruch der Volksbibliothekare, der Richtungsstreit, und die Sprache in Beiträgen ranghoher Volksbibliothekare sind weitere Schwerpunkte. Die Analyse von Themenschwerpunkten wie Parteibibliotheken, Ausleihsystem, Prachtwerke und die Neuordnung der Ausbildung wird ebenfalls erwähnt. Die Methode besteht aus einer Quellenanalyse der Zeitschrift ‚Die Bücherei‘ und der Heranziehung von Forschungsliteratur.
Welche Themen werden im Abschnitt "Diskursqualität anhand ausgewählter Themenschwerpunkte" behandelt?
Dieser Abschnitt widmet sich der Analyse der Diskursqualität anhand ausgewählter Themenschwerpunkte im Volksbüchereiwesen. Dazu gehören Parteibibliotheken, das Ausleihsystem, der Kampf gegen Prachtwerke und die Neuordnung der Ausbildung zum Volksbibliothekar. Der Abschnitt untersucht die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten von Diskurs in diesem Kontext.
Wer waren Wilhelm Schuster und Franz Schriewer und welche Rolle spielten sie?
Wilhelm Schuster und Franz Schriewer waren ranghohe Volksbibliothekare und einflussreiche Figuren im deutschen Volksbüchereiwesen während der NS-Zeit. Schuster war Leiter des VDV und maßgeblich für die Inhaltslinie der Verbandszeitschrift ‚Die Bücherei‘ verantwortlich. Seine Ansprache zur Jahresversammlung des VDB im Jahr 1933 wird als richtungsweisend betrachtet. Schriewer war ebenfalls ein häufig publizierender Autor und trug zur Gestaltung der Inhaltslinie der Bibliothek bei. Beide waren beteiligt an verschiedenen Themenbereichen und prägten die diskursive Praxis.
Was ist der Richtungsstreit und welche Bedeutung hatte er für den Bildungsanspruch der Volksbibliothekare?
Der Richtungsstreit war eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Strömungen innerhalb des Volksbüchereiwesens vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Im Kern ging es um den Bildungsanspruch der Volksbüchereien. Einige betonten die Notwendigkeit, klassische Werke und wissenschaftliche Literatur anzubieten, während andere den Fokus auf Unterhaltungsliteratur legten, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Dieser Streit führte dazu, dass sich Volksbibliothekare erstmals mit ihrem eigenen Bildungsanspruch auseinandersetzten und legte einen Nährboden für die Idee, Leser durch Bibliotheksarbeit nachhaltig zu beeinflussen.
Welche Quellen werden in der Analyse verwendet?
Die Quellenanalyse basiert auf Beiträgen der Verbandszeitschrift "Die Bücherei" aus den Jahrgängen von 1934 bis 1938. Hierbei werden spezifische Texte aus den Kategorien "Aufsätze", "Erlasse und Verfügungen", "Aus der Fachschaft - für die Fachschaft. Nachrichten", sowie den "Thematischen Sammelbesprechungen" und "Einzelbesprechungen" der "Bücherschau" in Betracht gezogen. Ergänzend wird Forschungsliteratur herangezogen.
Welche Kritik wird an Wilhelm Schuster geübt?
Wilhelm Schuster wird in seiner Rolle als Leiter des VDV für seine "vorauseilende Überangepasstheit" kritisiert. Er wird zitiert, wie er die Erziehung zu Rassenkunde und Genetik in den Mittelpunkt der Büchereiarbeit rücken will und dass er die Volksbibliotheken als Teil der Erziehungsbewegung im nationalsozialistischen Geiste sieht. Seine opportunistische Haltung gegenüber Schund- und Schmutzliteratur wird ebenfalls erwähnt.
- Quote paper
- Dennis Münnich (Author), 2023, Diskursqualität im Volksbibliothekswesen der NS-Zeit? Ein Blick auf Beiträge der Zeitschrift "Die Bücherei" von 1934-1938, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1370323