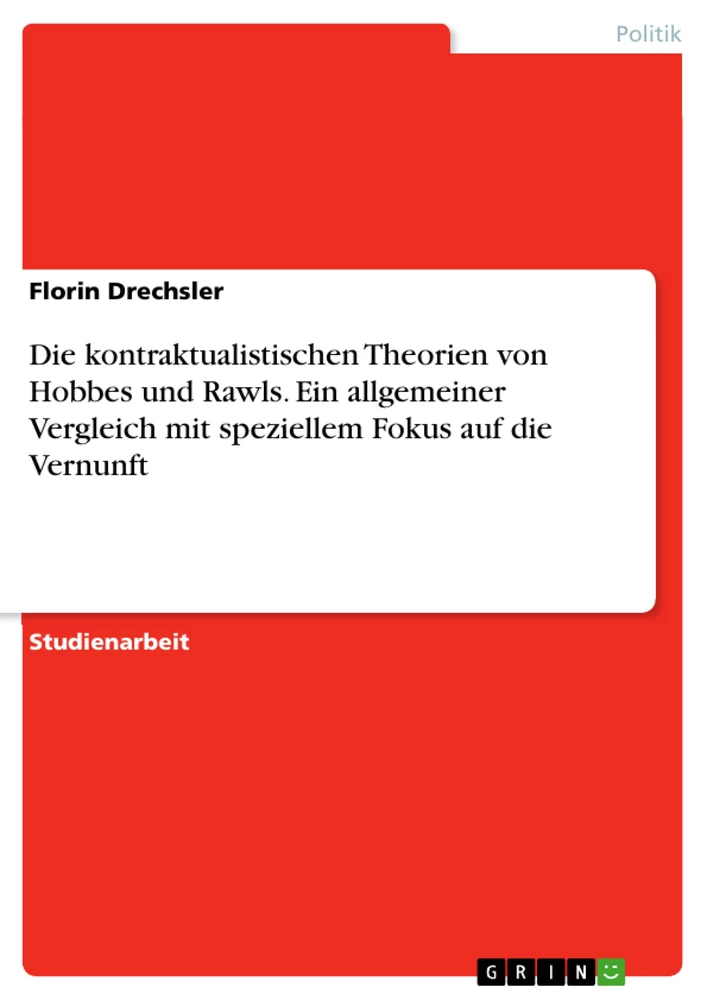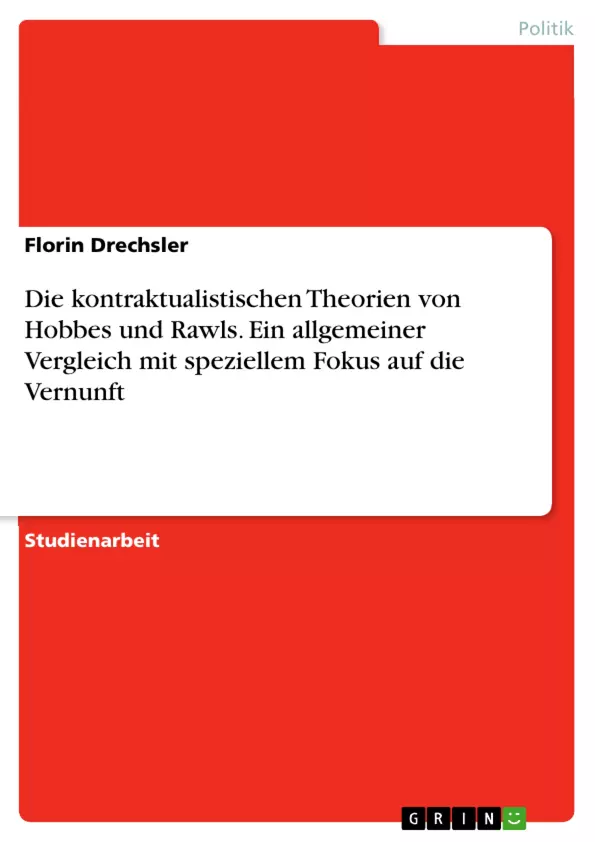Was ist der Kontraktualismus (Vertragstheorie)?
Der Kontraktualismus, auch Vertragstheorie genannt, ist ein Ansatz, der die Legitimität von moralischen Prinzipien, institutionellen Ordnungen oder politischer Herrschaft durch einen Vertrag zwischen freien und gleichen Individuen in einem wohldefinierten Ausgangszustand begründet.