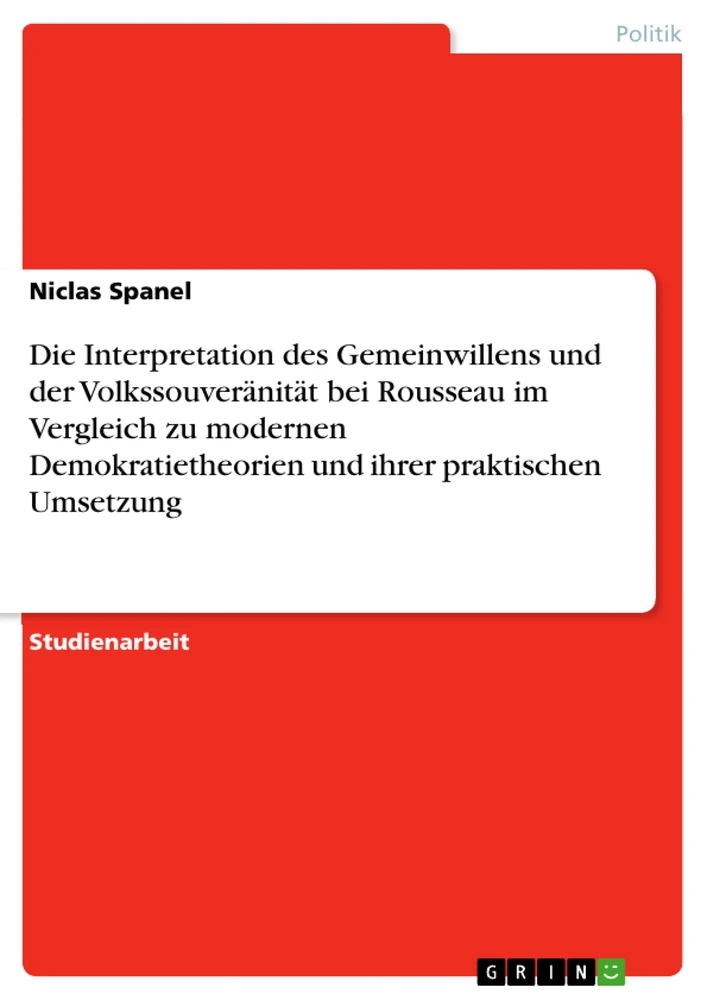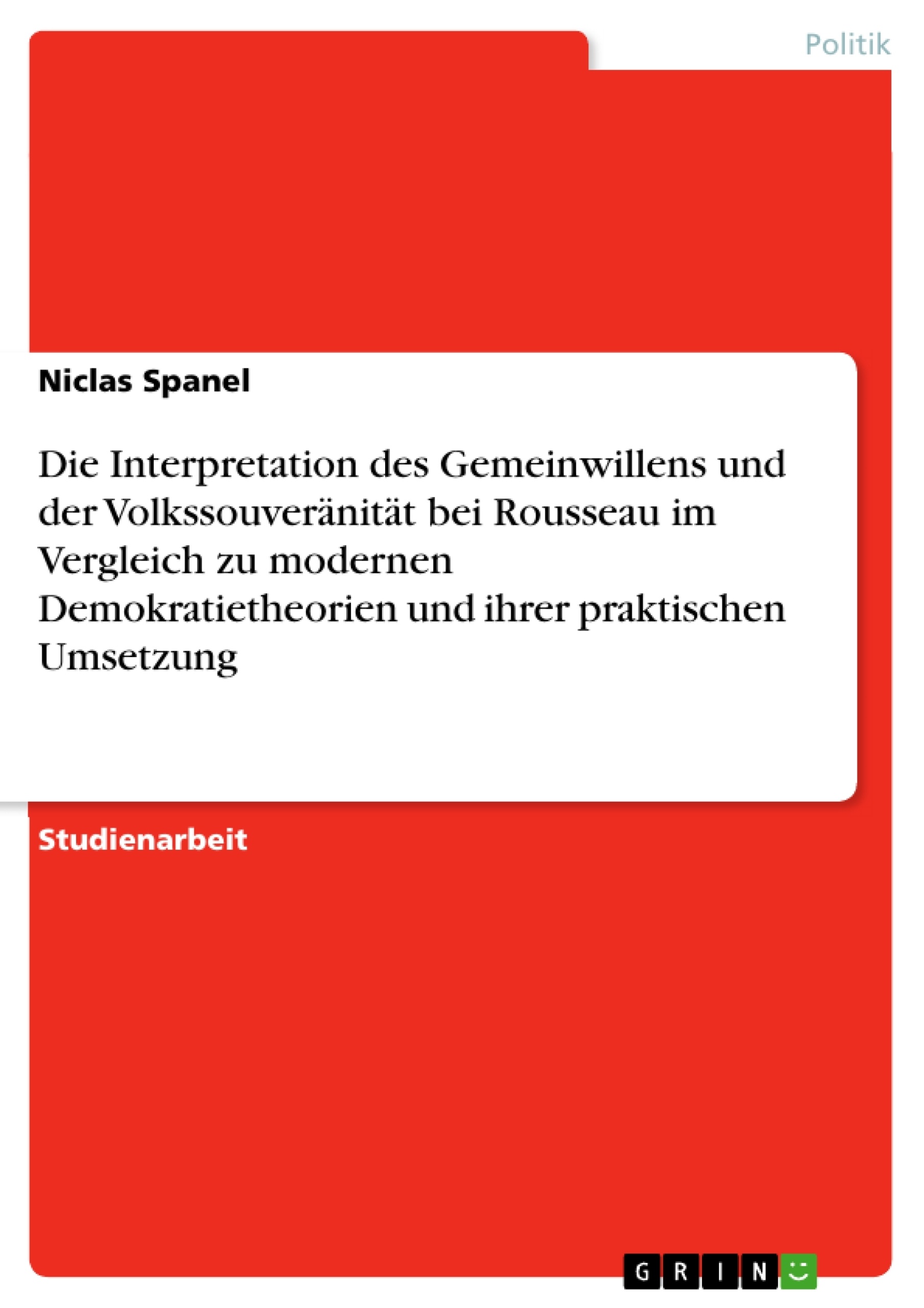Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Konzepten des Gemeinwillens und der Volkssouveränität im Rahmen der politischen Philosophie von Jean-Jacques Rousseau und deren Vergleich mit modernen Demokratietheorien sowie ihrer praktischen Umsetzung. Rousseaus Ideen waren zur Zeit der Aufklärung revolutionär und legten den Grundstein für die Errungenschaften der Bürgerrechte und der demokratischen Teilhabe. Trotz des Fortschritts in Richtung repräsentativer Demokratie gibt es jedoch immer noch Kritik am gegenwärtigen politischen System, was die Forderung nach mehr direkter Demokratie in einigen Kreisen erklärt. In diesem Zusammenhang wird die Schweiz oft als Beispiel für direkte Demokratie herangezogen.
Diese Arbeit untersucht, inwiefern Rousseaus Gedanken in der schweizerischen Praxis reflektiert werden und wie sich dies von unserem repräsentativen Demokratiesystem unterscheidet. Um dies zu erreichen, wird zunächst die Identitätstheorie Rousseaus vorgestellt, die durch das Modell des Gesellschaftsvertrags die grundlegende Bedeutung des Gemeinwillens betont. Die Frage, ob in einer pluralistischen Gesellschaft ein einheitlicher Gemeinwille existieren kann und ob er für unsere Demokratie erstrebenswert ist, wird im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls erörtert. Hierbei werden verschiedene moderne Demokratietheorien, wie beispielsweise die Konkurrenztheorie, die von einer Konkurrenz unterschiedlicher Sonderinteressen ausgeht, in Bezug auf Volkssouveränität und Gemeinwohl abgewogen. Darüber hinaus wird diskutiert, ob das Gemeinwohl im Voraus feststellbar ist oder ob es das Ergebnis eines politischen Entscheidungsprozesses ist. Die Arbeit untersucht, welche Lehren wir aus Rousseaus Theorie für die Gestaltung moderner politischer Systeme ziehen können und welche Aspekte seiner Theorie potenziell Gefahren für die Demokratie bergen können.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Die Identitätstheorie im Vergleich zu modernen Demokratietheorien und deren Praxis
- 1. Ursprung und Theorie Rousseaus Gesellschaftsvertrags
- 2. Unterscheidung von Identitätstheorie und Konkurrenztheorie in Bezug auf Einzelwillen und Gemeinwillen
- 2.1. Die Bedeutsamkeit des Gemeinwillens in der Identitätstheorie
- 2.2. Die Bedeutsamkeit von Einzelwillen in der Konkurrenztheorie
- 3. Identitätstheorie und Konkurrenztheorie in politischer Praxis
- 3.1 Chancen und Risiken direkter Demokratie
- 3.2. Chancen und Risiken der repräsentativen Demokratie
- 4. Demokratie ohne Gewaltenteilung und Grundrechte möglich?
- C Was können wir heute von Rousseau lernen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Identitätstheorie von Jean-Jacques Rousseau und setzt diese in Beziehung zu modernen Demokratietheorien und deren Praxis. Ziel ist es, die Grundintention Rousseaus, eine Identität von Regierenden und Regierten und die damit verbundene Bedeutung eines Gemeinwillens, zu beleuchten.
- Rousseaus Gesellschaftsvertragstheorie und deren Grundprinzipien
- Der Gegensatz zwischen Identitätstheorie und Konkurrenztheorie hinsichtlich Einzelwillen und Gemeinwillen
- Die Relevanz des Gemeinwillens und der Volkssouveränität in verschiedenen Demokratietheorien
- Chancen und Risiken direkter und repräsentativer Demokratie in der Praxis
- Die Bedeutung von Rousseaus Gedanken für die Gestaltung moderner politischer Systeme
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitung
Die Einleitung stellt Rousseaus zentrale These vom Gesellschaftsvertrag vor und beleuchtet die Bedeutung seines Werkes im Kontext der Aufklärung. Sie hebt die Kritik am Absolutismus und die Forderung nach Selbstregierung der Bevölkerung hervor.
B Die Identitätstheorie im Vergleich zu modernen Demokratietheorien und deren Praxis
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Rousseaus Identitätstheorie im Kontext des Gesellschaftsvertrags und vergleicht diese mit modernen Demokratietheorien. Es analysiert die Bedeutung des Gemeinwillens, die Unterscheidung zwischen Identitätstheorie und Konkurrenztheorie sowie die Chancen und Risiken direkter und repräsentativer Demokratie.
1. Ursprung und Theorie Rousseaus Gesellschaftsvertrags
Dieser Abschnitt beleuchtet die Hintergründe und die Entwicklung von Rousseaus Gesellschaftsvertragstheorie. Er stellt Rousseaus kritische Sicht auf den Konkurrenzkampf in der Gesellschaft und die Notwendigkeit einer neuen politischen Ordnung dar.
2. Unterscheidung von Identitätstheorie und Konkurrenztheorie in Bezug auf Einzelwillen und Gemeinwillen
Dieser Abschnitt setzt sich mit der Unterscheidung zwischen Identitätstheorie und Konkurrenztheorie auseinander. Er analysiert die Bedeutung des Gemeinwillens in der Identitätstheorie und die Bedeutung von Einzelwillen in der Konkurrenztheorie.
3. Identitätstheorie und Konkurrenztheorie in politischer Praxis
Dieser Abschnitt untersucht die Anwendung von Identitätstheorie und Konkurrenztheorie in der politischen Praxis. Er befasst sich mit den Chancen und Risiken direkter und repräsentativer Demokratie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Konzepten wie Gesellschaftsvertrag, Identitätstheorie, Konkurrenztheorie, Gemeinwille, Volkssouveränität, direkte Demokratie, repräsentative Demokratie und die Relevanz von Rousseau's Gedankengut für die heutige Zeit.
- Arbeit zitieren
- Niclas Spanel (Autor:in), 2023, Die Interpretation des Gemeinwillens und der Volkssouveränität bei Rousseau im Vergleich zu modernen Demokratietheorien und ihrer praktischen Umsetzung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1357287