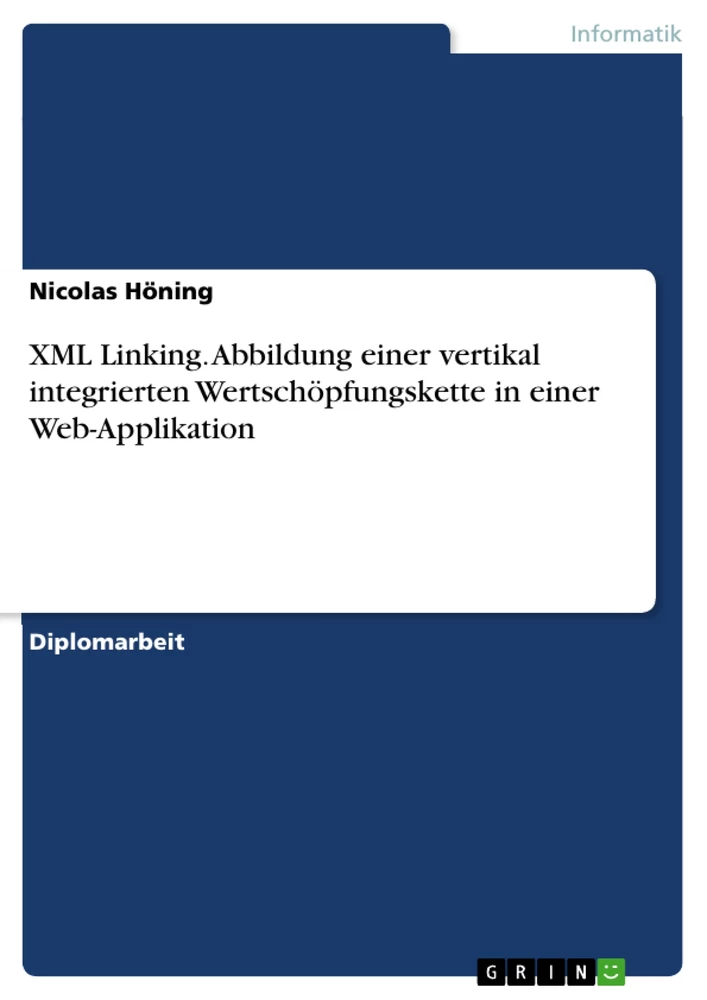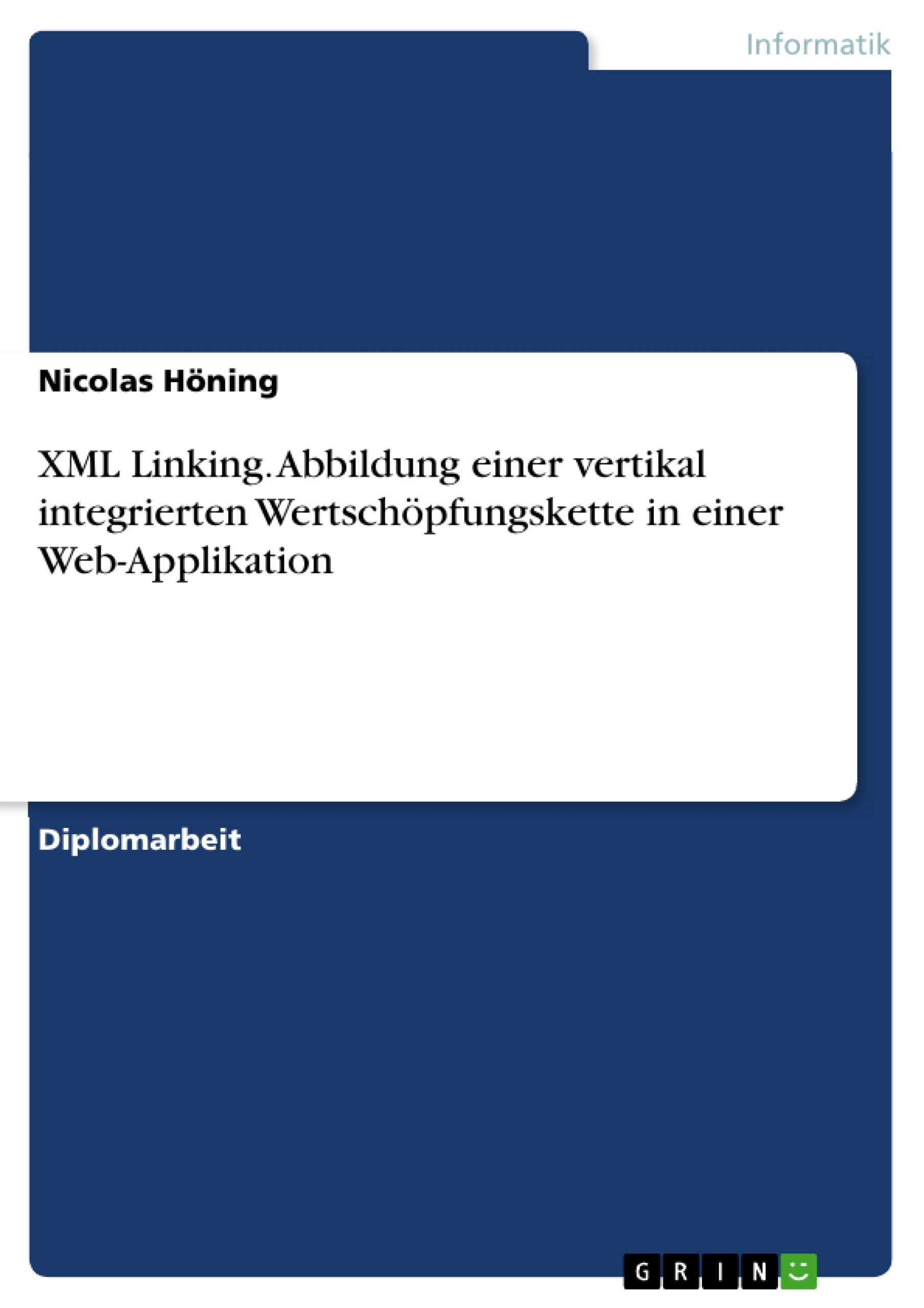Der Boom des Internet Nach der Entwicklung der Auszeichnungssprache HTML (Hypertext Markup Language) von Tim Berners-Lee 1991 am Genfer Hochenergieforschungszentrum CERN und des ersten weit verbreiteten Browsers namens „Mosaic“ durch Marc Andreessen erlebte das Internet einen unvorhersehbaren Boom. Zwar hatte schon so mancher Vordenker eine gemeinsame Nutzung von Ideen und Texten der Menschheit durch das Netz propagiert, doch nur wenige hatten geahnt, dass das vormals nur von Wissenschaftlern und Militärs genutzte Internet im Lauf der 90er Jahre von Millionen von Nutzern geprägt werden würde.
Entscheidenden Anteil daran hatte auch das W3-Konsortium (W3C). Nachdem die Wirtschaft die Potentiale des Internets erkannt hatte, die jedoch abhängig von seiner Verbreitung und der Akzeptanz in der Bevölkerung sind, wurde die Standardisierung des Internets von dem damit überlasteten CERN an das neu gegründete Konsortium W3C übergeben, welches maßgeblich aus Mitgliedern der am Internet beteiligten Unternehmen besteht. Hier wurde HTML standardisiert, so dass jedermann daran teilhaben konnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problemstellung
- 2.1. Warum XML Linking?
- 2.1.1. Neue Möglichkeiten nutzen…
- 2.1.2. Anwendungen verbessern…
- 2.2. Die Applikation
- 2.2.1. Anwendungsfälle
- 2.2.2. Das System
- 3. Die Urheber: Das W3-Konsortium
- 4. Die Grundlage: XML
- 4.1. Woher es kommt und wie es aussieht
- 4.2. Aufbau eines XML-Dokuments
- 4.3. Namensräume
- 4.4. wohlgeformte Dokumente
- 4.5. Gültigkeit
- 4.6.1. DTD
- 4.6.2. XML Schema
- 4.6.3. Relax NG
- 5. XML als Baumstruktur
- 5.1. Parsing
- 5.1.1. DOM
- 5.1.2. SAX
- 5.1.3. Fazit
- 5.2. Adressierung: XPath
- 5.2.1. Modell und Syntax
- 5.2.2. Definition logischer Ausdrücke
- 5.2.3. Funktionen
- 5.3. Konfliktlösung: Das XML Infoset
- 6. XML Linking
- 6.1. Exkurs: URI/URL
- 6.2. XInclude
- 6.3. XBase
- 6.4. XPointer
- 6.4.1. Technik und Möglichkeiten
- 6.4.2. Umsetzung und Probleme
- 6.5. XLink
- 6.5.1. Technik und Möglichkeiten
- 6.5.2. Umsetzung und Probleme
- 6.5.3. XLink versus HLink
- 6.6. XML Linking versus Xanadu
- 7. XML Metadaten und das semantische Web
- 7.1. Wofür brauchen wir Metadaten?
- 7.2. Einige Grundthesen über Metadaten
- 7.3. XLinks als Metadaten
- 7.4. Gültigkeitsdefinitionen als Metadaten
- 7.5. Meta-Metadaten am Beispiel RDDL
- 7.6. Topic Maps
- 7.7. Resource Description Framework (RDF)
- 8. Weiterverarbeitung und Anzeige von XML durch Stylesheets: XSL(T)
- 8.1. Woher es kommt und was es kann
- 8.2. XSL als funktionale Programmiersprache
- 8.2.1. Installation
- 8.2.2. Das Stylesheet dataCollector.xsl
- 9. Zusammenfassung und Ausblick
- 10. Anhang
- 10.1. Benutzerbeschreibung
- 10.1.1. Zweck des Programms
- 10.1.2. Nutzung
- 10.1.3. Screenshot der Einstiegsseite
- 10.1.4. Screenshot der Applikation
- 10.2. Detaildokumentation
- 10.2.1. Dateien/Klassen
- 10.2.2. Arbeitsumgebung
- 10.2.3. Programmcode
- 10.2.3.1. index.html (Einstiegsseite)
- 10.2.3.2. vendors.xml
- 10.2.3.3. vendors.dtd
- 10.2.3.4. linkbase 1.xml
- 10.2.3.5. linkbase.rng
- 10.2.3.6. index.html (RDDL)
- 10.2.3.7. format.css
- 10.2.3.8. dataCollector.xsl
- 10.2.3.9. Transformer.jsp
- 10.2.3.10. NodeSetGrapper.jsp
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Abschlussarbeit befasst sich mit der Verknüpfung von XML-Dokumenten, dem sogenannten XML Linking. Sie analysiert die Möglichkeiten, die XML für die Abbildung einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette in einer Web-Applikation bietet.
- XML Linking als Mittel zur Integration von Daten und zur Verknüpfung von Ressourcen in einer Web-Applikation
- Die Rolle des W3-Konsortiums bei der Standardisierung von XML und die Bedeutung der Erweiterungsmöglichkeiten von XML
- Die Verwendung von XML-Metadaten im semantischen Web und die Anwendung von RDF und RDDL zur Beschreibung von Ressourcen
- Die Vorteile von Stylesheets (XSL) zur Weiterverarbeitung und Anzeige von XML-Dokumenten
- Praktische Anwendung des XML Linkings anhand einer konkreten Web-Applikation
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Themenstellung ein und beschreibt den Boom des Internets, sowie die Bedeutung von HTML und das W3-Konsortium. Kapitel 2 erläutert die Problemstellung, die durch den Bedarf nach einer effizienten Integration von Daten und Ressourcen in Web-Applikationen entsteht. Es werden die Vorteile von XML Linking vorgestellt. Kapitel 3 befasst sich mit dem W3-Konsortium, das für die Standardisierung von XML verantwortlich ist.
Kapitel 4 definiert die Grundlage von XML, seinen Aufbau, Gültigkeitsdefinitionen und das Parsing von XML-Dokumenten. Kapitel 5 beschreibt die Baumstruktur von XML, sowie die Adressierung von Elementen mit XPath. Kapitel 6 widmet sich dem XML Linking und den verschiedenen Möglichkeiten der Verknüpfung von Ressourcen. Es werden die Konzepte von XInclude, XBase und XPointer vorgestellt.
Kapitel 7 behandelt das Thema XML Metadaten und das semantische Web, wobei die Bedeutung von Metadaten und deren Anwendung mit XLinks erläutert werden. Kapitel 8 stellt die Verwendung von Stylesheets (XSL) zur Weiterverarbeitung und Anzeige von XML-Dokumenten vor.
Schlüsselwörter
XML Linking, XML, Web-Applikation, Wertschöpfungskette, W3-Konsortium, Metadaten, semantisches Web, RDF, RDDL, Stylesheets, XSL, XPath, XInclude, XBase, XPointer, XLink
- Arbeit zitieren
- Nicolas Höning (Autor:in), 2003, XML Linking. Abbildung einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette in einer Web-Applikation, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/13571