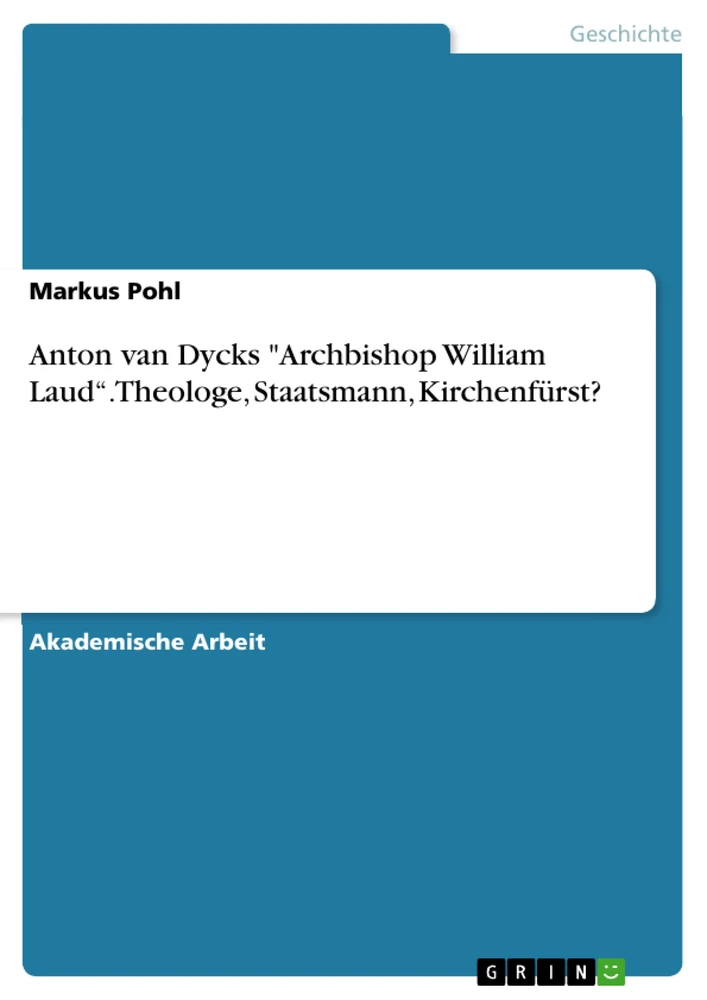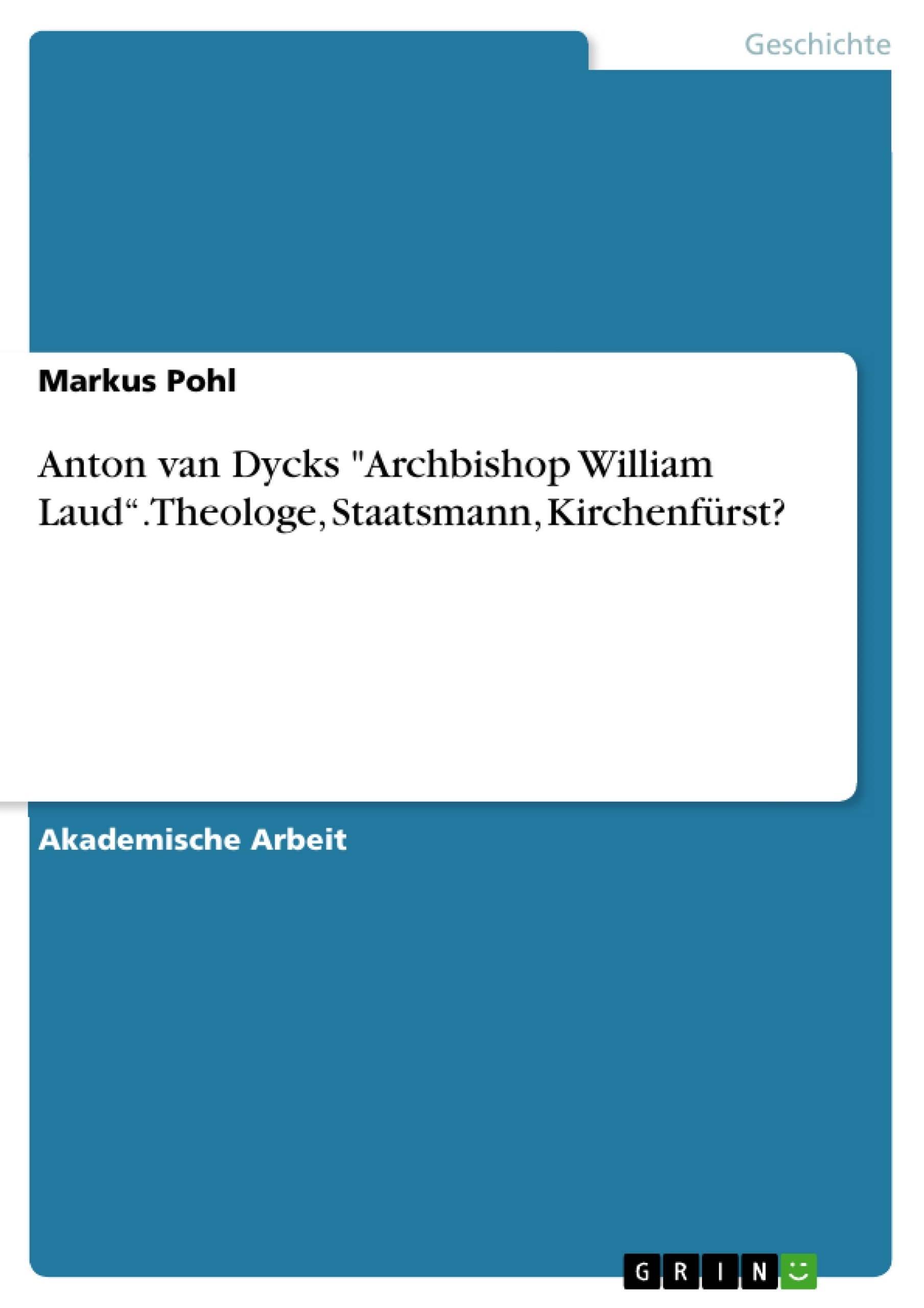William Laud war als Erzbischof und Politiker ein enger Berater des englischen Königs Charles I. Im Zuge des Bürgerkriegs wurde er hingerichtet. Diese Arbeit befasst sich mit den unterschiedlichen Fassungen Anton von Dycks Gemälde William Lauds und stellt die Frage nach der Selbstinszenierung des anglikanischen Bischofs und Staatsmanns.
Inhaltsverzeichnis
- Wer war William Laud?
- Anton van Dycks Londoner Jahre
- Das Gemälde
- Die Frage nach dem Original van Dycks – zur Quellenkritik
- Der Hintergrund - Deutung des Gemäldes
- Theologe mit Aufgaben im Staatsdienst – ein anglikanischer Bischof
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Gemälde „Archbishop William Laud“ von Anton van Dyck und untersucht dessen Bedeutung im Kontext von Lauds Leben und Wirken. Ziel ist es, die künstlerischen und politischen Dimensionen des Portraits zu analysieren und den Anspruch, den William Laud durch die Wahl des Künstlers und die Gestaltung des Gemäldes für sich selbst formulierte, herauszuarbeiten.
- Das Gemälde als Selbstbildnis William Lauds
- Anton van Dycks Rolle als Hofmaler König Karls I. und die politische Dimension des Portraits
- Die Bedeutung von Kleidung, Attributen und Ikonographie im Gemälde
- Die Rolle des Hintergrunds und seine Interpretation im Kontext der politischen Situation in England
- Die Frage nach dem Original van Dycks und der Quellenkritik
Zusammenfassung der Kapitel
Wer war William Laud?
Dieses Kapitel stellt William Laud, den Erzbischof von Canterbury und Berater König Karls I., als Schlüsselfigur im englischen Bürgerkrieg vor. Es beschreibt Lauds Werdegang, seine Rolle als Kirchenfürst und die Bedeutung des „Book of Common Prayer“ für den Ausbruch des Ersten Bischoffkriegs. Außerdem wird die Entstehung des van Dyck-Gemäldes als Auftrag Lauds und seine Bedeutung für die Selbstinszenierung des Erzbischofs beleuchtet.
Anton van Dycks Londoner Jahre
Dieses Kapitel skizziert die künstlerische und politische Karriere von Anton van Dyck. Es beleuchtet seine Beziehung zu Peter Paul Rubens, seine Reisen nach England und Italien sowie seine Ernennung zum Hofmaler König Karls I. Die Arbeit erläutert, wie van Dycks Porträts, darunter auch das von William Laud, in der politischen und religiösen Landschaft Englands eine Rolle spielten.
Das Gemälde
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Gemälde „Archbishop William Laud“ und der Frage nach dem Original van Dycks. Es analysiert die verschiedenen Exemplare des Gemäldes und die Schwierigkeiten bei der Identifizierung des Originals. Es stellt die verschiedenen Versionen des Portraits vor und untersucht die Quellenlage anhand von Kunstverzeichnissen, Ausstellungskatalogen und Fachliteratur.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert wichtige Aspekte aus der Geschichte Englands im 17. Jahrhundert, insbesondere den englischen Bürgerkrieg, die Rolle der Kirche, die politische Bedeutung des Königtums und die Kunst der Porträtmalerei. Schlüsselbegriffe sind William Laud, Anton van Dyck, Erzbischof von Canterbury, „Book of Common Prayer“, Hofmaler, politische Ikonographie, Divine Right of Kings, Gegenreformation, Porträtmalerei, Quellenkritik.
- Quote paper
- Markus Pohl (Author), 2011, Anton van Dycks "Archbishop William Laud“. Theologe, Staatsmann, Kirchenfürst?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1356149