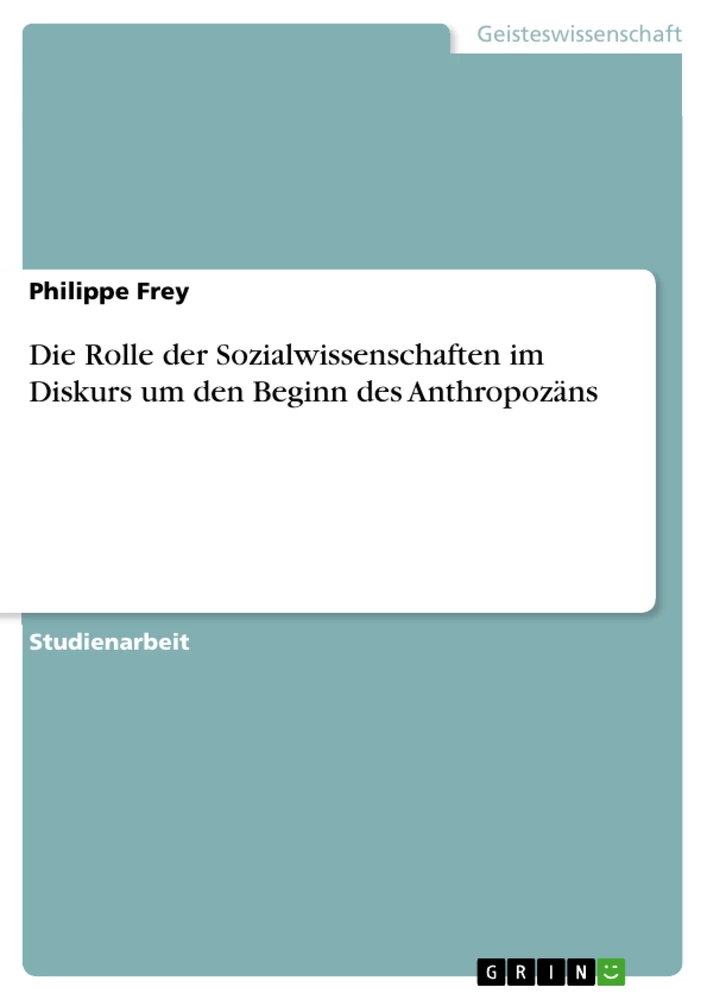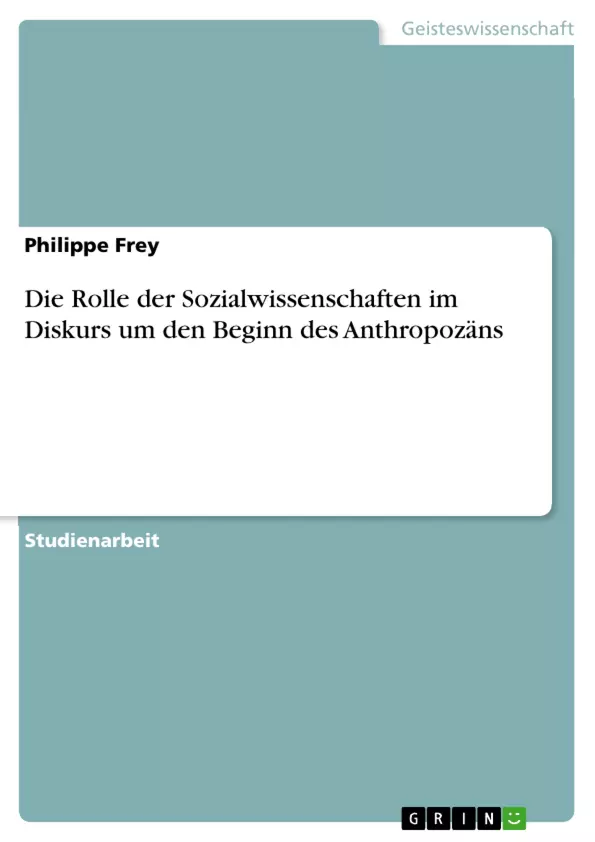Die bei weitem kürzeste Epoche der Unterteilung in Erdzeit-Dynastien wird Anthropozän genannt. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie die Einflussnahme des menschlichen Daseins auf seine Natur und Umwelt beziehungsweise im Gesamten auf den Planeten Erde darlegt.
Zentral für die These des Anthropozäns ist die Einsicht über das Ende des Holozäns, welches auch als Nacheiszeit umschrieben werden kann und von knapp 12.000 Jahren vor heute bis in die Gegenwart reicht. Autoren wie Jan Zalasiewicz, Mark Williams, Will Steffen oder Paul Crutzen (2010), größtenteils aus dem Gebiet der Geologie, verstehen unter dem Begriff Anthropozän die zum Teil permanenten Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Erde.
David R. Butler (2021) beschreibt das Anthropozän als eine Periode noch nie dagewesener menschlicher Einflüsse auf die Umweltsysteme der Erde. Doch wann hat das Anthropozän begonnen?
Während nahezu alle temporären Abschnitte der Erdgeschichte mehr oder weniger konkret abgesteckt werden können, befindet sich vor allem die zeitliche Bestimmung um den Beginn des Anthropozäns in einem hingebungsvoll geführten akademischen Diskurs, der durch Interdisziplinarität gekennzeichnet ist.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- 1.1: Hintergrund und Relevanz
- 1.2: Forschungsfragen und Zielsetzung
- 1.3: Aufbau der Arbeit
- Kapitel 2: Theoretischer Rahmen
- 2.1: Konzepte der Inklusion und Exklusion
- 2.2: Bildungstheoretische Ansätze
- 2.3: Empirische Forschung zu Inklusion in der Bildung
- Kapitel 3: Methoden und Design
- 3.1: Forschungsdesign und Datenerhebung
- 3.2: Stichprobe und Datenauswertung
- Kapitel 4: Ergebnisse
- 4.1: Ergebnisse der qualitativen Analyse
- 4.2: Ergebnisse der quantitativen Analyse
- Kapitel 5: Diskussion
- 5.1: Interpretation der Ergebnisse
- 5.2: Limitationen der Studie
- 5.3: Implikationen für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Inklusion in der Bildung und analysiert die Herausforderungen und Chancen der inklusiven Beschulung. Sie untersucht die Erfahrungen von Lehrkräften und Schülern mit Inklusion und analysiert die Auswirkungen auf die Lernqualität und die soziale Integration.
- Die Konzepte der Inklusion und Exklusion in der Bildung
- Die Rolle der Lehrkräfte bei der Gestaltung inklusiver Lernumgebungen
- Die Auswirkungen von Inklusion auf die Lernqualität und die soziale Integration von Schülern
- Empirische Forschungsergebnisse zu Inklusion in der Bildung
- Praxisimplikationen für die Gestaltung inklusiver Bildungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Inklusion in der Bildung ein und erläutert die Relevanz des Themas. Es werden die Forschungsfragen und die Zielsetzung der Arbeit dargelegt. Kapitel 2 präsentiert den theoretischen Rahmen der Arbeit und beleuchtet die Konzepte der Inklusion und Exklusion, relevante Bildungstheorien und empirische Forschungsergebnisse zu Inklusion. Kapitel 3 beschreibt die verwendeten Methoden und das Forschungsdesign der Studie, einschließlich Datenerhebung, Stichprobe und Datenauswertung. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Studie und beleuchtet die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse.
Schlüsselwörter
Inklusion, Exklusion, Bildung, Inklusion in der Bildung, Lehrkräfte, Schüler, Lernqualität, soziale Integration, empirische Forschung, BiLieF Projekt, inklusive Beschulung
- Arbeit zitieren
- Philippe Frey (Autor:in), 2023, Die Rolle der Sozialwissenschaften im Diskurs um den Beginn des Anthropozäns, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1355942