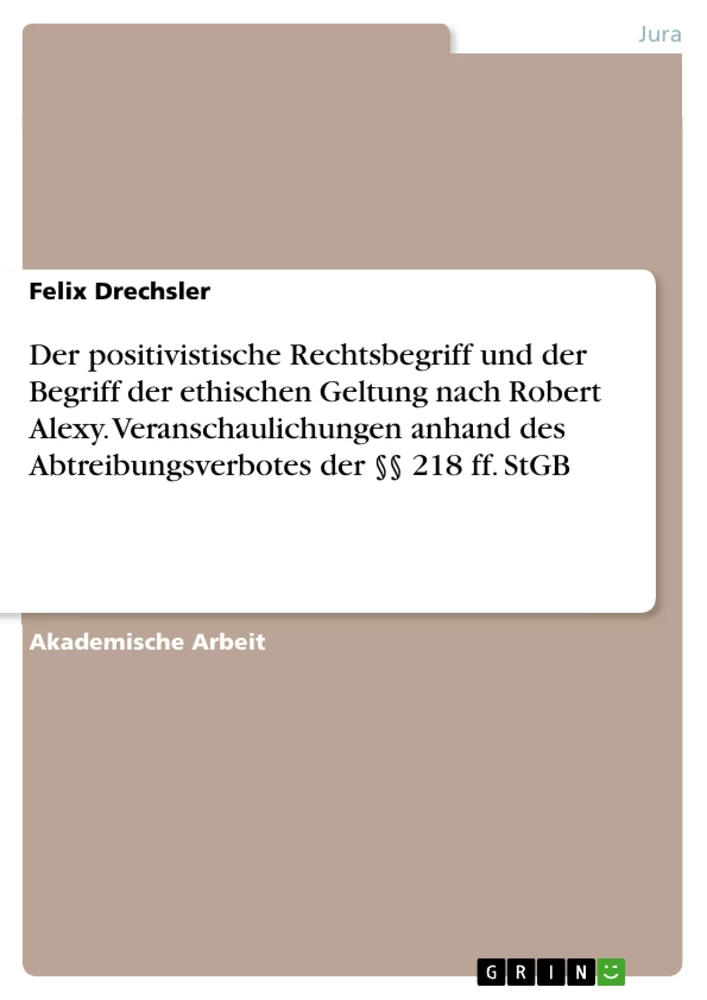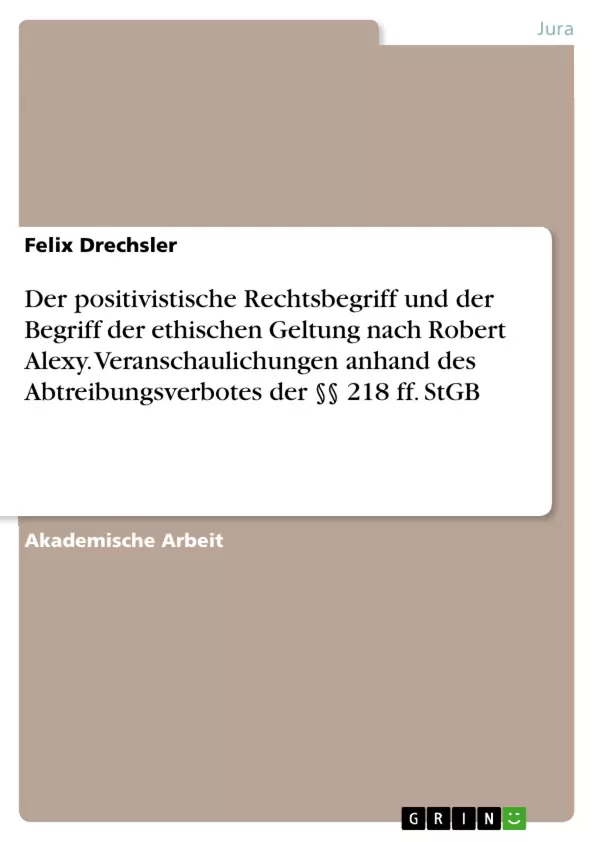Die Studienabschlussarbeit befasst sich mit der rechtsphilosophischen Problematik des nicht-positivistischen Rechtsbegriffes, vertreten durch Robert Alexy sowie verneint durch Hans Kelsen. Im Rahmen der Arbeit wird Alexys Begriff der ethischen Geltung skizziert und in Verbindung zu der inhaltlichen Richtigkeit des Rechts erörtert. Um die finale Befürwortung eines nicht-positivistischen Rechtsbegriffes zu veranschaulichen, wird das Abtreibungsverbot nach den §§ 218 ff. StGB eingehender untersucht sowie die konfliktbehaftete Geschichte hinter dem Tatbestand erleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Das Verhältnis von Recht und Moral als ein dem Rechtsbegriff immanenter und historischer Streit mit Gegenwartsbezug
- II. Erörterung der inhaltlichen Richtigkeit des Rechts in Verbindung zum Begriff der ethischen Geltung des Rechts bei Robert Alexy
- 1. Robert Alexys triologische Struktur des Rechtsbegriffes
- 2. Robert Alexys Begriff der ethischen Geltung
- 3. Auszüge der argumentativen Vorgehensweise Alexys
- III. Die methodische Vollendung der gesetzespositivistischen Rechtslehre Hans Kelsens
- 1. Kelsens rechtsbegrifflicher Methodendualismus
- 2. Gegenüberstellung Kelsens und Alexys
- IV. Das Verbot des Schwangerschaftsabbruches nach §§ 218 StGB - eine rechtstheoretische Auseinandersetzung
- 1. Entstehungsgeschichtliche Darstellung der Normenkette
- 2. Rechtstheoretische Diskussion der Tatbestände
- V. Das kontroverse Votieren um einen nichtpositivistischen Rechtsbegriff
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Recht und Moral anhand des positivistischen Rechtsbegriffs und des Konzepts der ethischen Geltung nach Robert Alexy. Sie vergleicht Alexys Ansatz mit der gesetzespositivistischen Rechtslehre Hans Kelsens und illustriert die theoretischen Überlegungen anhand des Verbots von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland (§§ 218 ff. StGB).
- Der positivistische Rechtsbegriff und seine Kritik
- Robert Alexys Theorie der ethischen Geltung des Rechts
- Der Vergleich zwischen Alexys und Kelsens Rechtsphilosophie
- Die rechtstheoretische Auseinandersetzung mit dem Schwangerschaftsabbruchverbot
- Die Debatte um einen nichtpositivistischen Rechtsbegriff
Zusammenfassung der Kapitel
I. Das Verhältnis von Recht und Moral als ein dem Rechtsbegriff immanenter und historischer Streit mit Gegenwartsbezug: Dieses einleitende Kapitel dürfte den historischen und aktuellen Diskurs um das Verhältnis von Recht und Moral beleuchten und die zentrale Fragestellung der Arbeit einführen, indem es die Spannungen zwischen rein positivistischen und ethisch fundierten Rechtsauffassungen darstellt und den Bezug zur aktuellen Rechtspraxis herstellt.
II. Erörterung der inhaltlichen Richtigkeit des Rechts in Verbindung zum Begriff der ethischen Geltung des Rechts bei Robert Alexy: Dieses Kapitel analysiert Robert Alexys Rechtsphilosophie, insbesondere seinen triologischen Rechtsbegriff, der neben dem positiven Recht auch die moralische Richtigkeit und die soziale Wirksamkeit berücksichtigt. Es wird detailliert auf den Begriff der ethischen Geltung eingegangen und seine Verbindung zur inhaltlichen Richtigkeit des Rechts erörtert. Die argumentativen Strategien Alexys, wie das Richtigkeits-, Unrechts- und Prinzipienargument, werden im Detail analysiert und deren Bedeutung für die Rechtstheorie erläutert.
III. Die methodische Vollendung der gesetzespositivistischen Rechtslehre Hans Kelsens: Hier wird die Rechtsphilosophie Hans Kelsens vorgestellt, insbesondere sein rechtspositivistischer Methodendualismus und seine Trennung von Recht und Moral. Der Fokus liegt auf Kelsens Grundnorm und seiner Normbegründung. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich zwischen Kelsens und Alexys Ansätzen, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Rechtsphilosophien herauszuarbeiten.
IV. Das Verbot des Schwangerschaftsabbruches nach §§ 218 StGB - eine rechtstheoretische Auseinandersetzung: Dieses Kapitel analysiert das deutsche Verbot des Schwangerschaftsabbruchs aus rechtstheoretischer Perspektive. Es wird die Entstehungsgeschichte der relevanten Normen dargestellt, ihre rechtliche Begründung im Lichte der Theorien von Kelsen und Alexy untersucht und die ethischen und moralischen Aspekte des Verbotes diskutiert. Die Kapitel analysieren wahrscheinlich die geltenden Rechtsnormen und ihre historische Entwicklung im Kontext von Weimarer Republik, Nationalsozialismus und der nachfolgenden Rechtsprechung.
V. Das kontroverse Votieren um einen nichtpositivistischen Rechtsbegriff: Dieses Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Implikationen der verschiedenen Rechtsbegriffe für die Rechtspraxis. Es wird die Kontroverse um einen rein positivistischen versus einen nichtpositivistischen Rechtsbegriff erörtern und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Positionen abwägen.
Schlüsselwörter
Positivistischer Rechtsbegriff, Ethische Geltung, Robert Alexy, Hans Kelsen, Recht und Moral, Schwangerschaftsabbruch, §§ 218 ff. StGB, Rechtspositivismus, Nichtpositivismus, Inhaltliche Richtigkeit, Rechtsgeltung, Grundnorm, Juristische Argumentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das Verhältnis von Recht und Moral
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht das komplexe Verhältnis von Recht und Moral, insbesondere im Kontext des positivistischen Rechtsbegriffs und der Theorie der ethischen Geltung nach Robert Alexy. Sie vergleicht Alexys Ansatz mit der Rechtsphilosophie Hans Kelsens und illustriert die theoretischen Überlegungen anhand des Verbots von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland (§§ 218 ff. StGB).
Welche Rechtsphilosophen stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rechtsphilosophien von Robert Alexy und Hans Kelsen. Alexys Theorie der ethischen Geltung des Rechts wird im Detail analysiert und mit Kelsens gesetzespositivistischem Ansatz verglichen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer Ansätze werden herausgearbeitet.
Welche Rolle spielt Robert Alexys Rechtsphilosophie in der Arbeit?
Robert Alexys triologischer Rechtsbegriff, der positive Recht, moralische Richtigkeit und soziale Wirksamkeit umfasst, bildet einen zentralen Bestandteil der Arbeit. Die Analyse konzentriert sich auf seinen Begriff der ethischen Geltung und die damit verbundenen argumentativen Strategien (Richtigkeits-, Unrechts- und Prinzipienargument).
Wie wird Hans Kelsens Rechtsphilosophie in die Untersuchung einbezogen?
Die Arbeit präsentiert Kelsens gesetzespositivistische Rechtslehre, insbesondere seinen methodischen Dualismus und die Trennung von Recht und Moral. Seine Grundnorm und die damit verbundene Normbegründung werden erläutert und im Vergleich zu Alexys Ansatz diskutiert.
Welche Bedeutung hat das Beispiel des Schwangerschaftsabbruchs?
Das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs nach §§ 218 ff. StGB dient als Fallbeispiel, um die theoretischen Überlegungen zu illustrieren. Die Arbeit analysiert die Entstehungsgeschichte der relevanten Normen, untersucht deren rechtliche Begründung im Lichte der Theorien von Kelsen und Alexy und diskutiert die ethischen und moralischen Aspekte des Verbots.
Welche zentralen Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Positivistischer Rechtsbegriff und seine Kritik, Robert Alexys Theorie der ethischen Geltung, Vergleich zwischen Alexys und Kelsens Rechtsphilosophie, rechtstheoretische Auseinandersetzung mit dem Schwangerschaftsabbruchverbot, und die Debatte um einen nichtpositivistischen Rechtsbegriff.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel I beleuchtet den historischen und aktuellen Diskurs um das Verhältnis von Recht und Moral. Kapitel II analysiert Alexys Rechtsphilosophie. Kapitel III präsentiert Kelsens Rechtsphilosophie und vergleicht sie mit Alexys Ansatz. Kapitel IV analysiert das Schwangerschaftsabbruchverbot. Kapitel V fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Implikationen der verschiedenen Rechtsbegriffe für die Rechtspraxis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Positivistischer Rechtsbegriff, Ethische Geltung, Robert Alexy, Hans Kelsen, Recht und Moral, Schwangerschaftsabbruch, §§ 218 ff. StGB, Rechtspositivismus, Nichtpositivismus, Inhaltliche Richtigkeit, Rechtsgeltung, Grundnorm, Juristische Argumentation.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für Rechtsphilosophie, insbesondere für die Debatte um den positivistischen Rechtsbegriff und das Verhältnis von Recht und Moral interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Rechtswissenschaft und verwandter Disziplinen.
- Quote paper
- Felix Drechsler (Author), 2022, Der positivistische Rechtsbegriff und der Begriff der ethischen Geltung nach Robert Alexy. Veranschaulichungen anhand des Abtreibungsverbotes der §§ 218 ff. StGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1353568