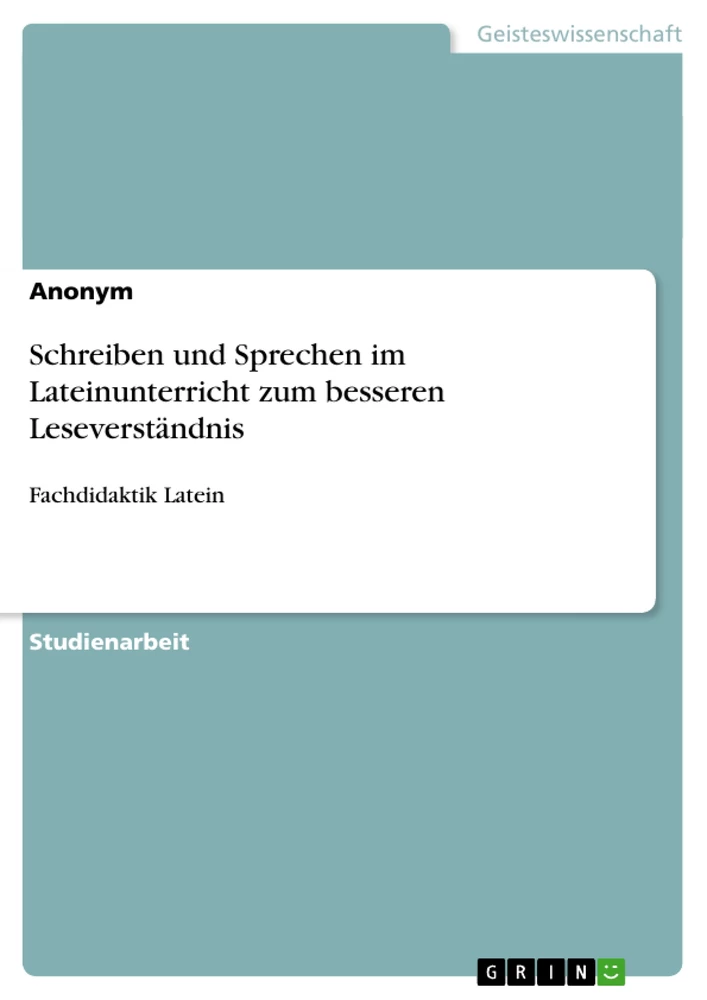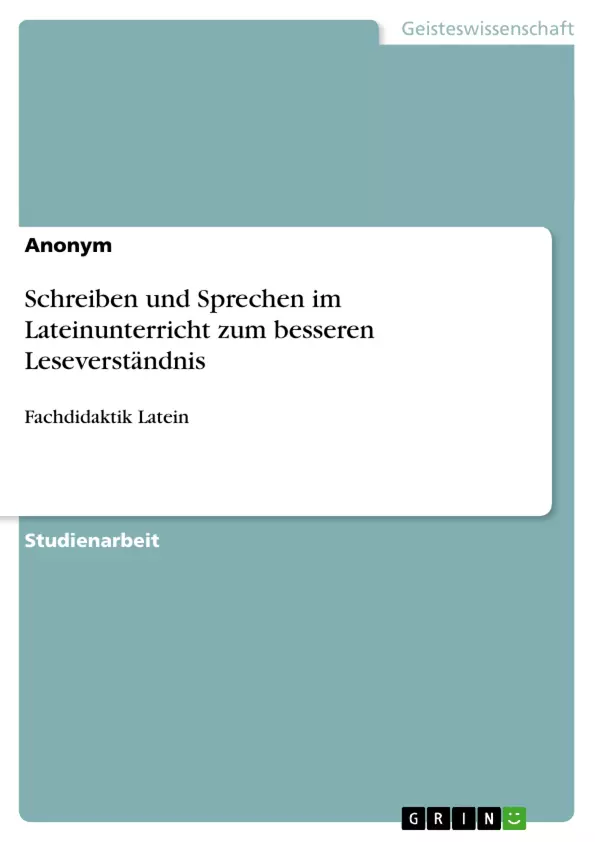Krell greift in ihrem Artikel „Kein Leseverstehen ohne Sprechen und Schreiben!“, die Diskussion in der Schul- und Bildungspolitik um die Bedeutung und Aktualität des Lateinunterrichts auf, um zu bekräftigen, dass neben seiner hohen Bedeutung für die Allgemeinbildung das Lateinische als „Muttersprache Europas“ die Basis zum Erlernen moderner europäischer Fremdsprachen sein kann. Hinzu kommt, das der Lateinunterricht durchaus zu einem verbesserten Umgang mit der Muttersprache führen kann, und durch die damit einhergehende Erweiterung des Wortschatzes auch keinesfalls, wie von vielen behauptet ein Elitefach ist, sondern gerade nicht elitären Schülern beim Erreichen von Chancengleichheit helfen kann.
Im Lateinunterricht werden die Sprachkenntnisse in der Regel über Rezeption und Kognition erworben, wobei der Wortschatz und die Grammatik auf passive Weise beim Übersetzen von Texten erlernt und gefestigt werden.
Das Hauptziel des Lateinunterrichts liegt allerdings nicht, wie beim modernen fremdsprachlichen Unterricht, im aktiven Gebrauch der Sprache, sondern eher darin, eine möglichst effektive Lektürefähigkeit zu erlernen.
Das Problem, welches Krell hierbei sieht, ist, dass eine Sprache nicht allein durch Rezeption und Kognition erlernt werden kann: „Übersetzen lernt man nicht durch ausschließliches Übersetzen, Lesen und Verstehen lernt man nicht durch ausschließliches Lesen.“
Denn es hat sich erwiesen, dass durch diese Methoden allein, sich die Lektürefähigkeit der Schüler nicht besonders stark ausprägt. Natürlich darf hierbei nicht außer Acht gelassen werden, dass lateinische Texte auch aufgrund der differenzierten Syntax und der hohen Sprachökonomie in der Regel freilich schwieriger zu verstehen sind als Texte der modernen Fremdsprachen. Allerdings ist der Grund dafür auch in der unterschiedlichen Unterrichtsgestaltung der verschieden Fremdsprachen zu suchen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Lateinunterricht
3. Methoden des neusprachlichen Unterrichts und ihre Anwendung im Lateinunterricht
4. Die praktische Umsetzung im Unterricht
4.1. Die textlinguistische Auswertung eines Lesestücks
4.2. Die Erarbeitung eines Tafelbildes im Klassenverband
4.3. Das gesteuerte Tafelbild
4.4. Lückentext zur Wortschatzarbeit
4.5. Der Lateinische Fragekatalog
4.6. Die gelenkte Textproduktion
5. Schlussbemerkung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Es ist ein richtiger Grundsatz, dass eine Sprache durch sprechen gelernt werden muss. Dieser Grundsatz, der bei neueren Sprachen durchaus angewendet wird, kann nicht ganz unrichtig sein beim Studium der alten.“[1]
Professor Hochegger vertrat hier die Meinung, dass dem aktiven Sprachgebrauch im Lateinunterricht eine besondere Bedeutung beigemessen werden sollte.
Auch Michaela Krell beschäftigt sich in ihrem Artikel „Kein Leseverstehen ohne Sprechen und Schreiben!“ (erschienen in „Forum Classicum“ 2/2006) mit dieser Thematik und stellt dar, in welchem Maße lateinisches Sprechen und Lesen zum Sprachverständnis beitragen kann.
Diese Hausarbeit stellt den besagten Artikel vor und erklärt welche Bedeutung nach Krell einem aktiven Sprachgebrauch im Lateinunterricht beigemessen werden sollte. Im weiteren Verlauf werden Beispiele für Aufgabenstellungen gegeben, durch welche sich die Theorie eines aktiven Umgangs mit Latein im Unterricht verwirklichen lässt. Im Anschluss wird eine Einschätzung zu Krells Aussagen und Ideen gegeben und es wird darauf Bezug genommen, inwiefern sich die Methoden erfolgreich und effizient im Unterricht einsetzen lassen.
2. Der Lateinunterricht
Krell greift in ihrem Artikel „Kein Leseverstehen ohne Sprechen und Schreiben!“, die Diskussion in der Schul- und Bildungspolitik um die Bedeutung und Aktualität des Lateinunterrichts auf, um zu bekräftigen, dass neben seiner hohen Bedeutung für die Allgemeinbildung das Lateinische als „Muttersprache Europas“[2] die Basis zum Erlernen moderner europäischer Fremdsprachen sein kann. Hinzu kommt, das der Lateinunterricht durchaus zu einem verbesserten Umgang mit der Muttersprache führen kann, und durch die damit einhergehende Erweiterung des Wortschatzes auch keinesfalls, wie von vielen behauptet ein Elitefach ist, sondern gerade nicht elitären Schülern beim Erreichen von Chancengleichheit helfen kann.[3]
Im Lateinunterricht werden die Sprachkenntnisse in der Regel über Rezeption und Kognition erworben, wobei der Wortschatz und die Grammatik auf passive Weise beim Übersetzen von Texten erlernt und gefestigt werden.
Das Hauptziel des Lateinunterrichts liegt allerdings nicht, wie beim modernen fremdsprachlichen Unterricht, im aktiven Gebrauch der Sprache, sondern eher darin, eine möglichst effektive Lektürefähigkeit zu erlernen.
Das Problem, welches Krell hierbei sieht, ist, dass eine Sprache nicht allein durch Rezeption und Kognition erlernt werden kann: „Übersetzen lernt man nicht durch ausschließliches Übersetzen, Lesen und Verstehen lernt man nicht durch ausschließliches Lesen.“[4]
Denn es hat sich erwiesen, dass durch diese Methoden allein, sich die Lektürefähigkeit der Schüler nicht besonders stark ausprägt. Natürlich darf hierbei nicht außer Acht gelassen werden, dass lateinische Texte auch aufgrund der differenzierten Syntax und der hohen Sprachökonomie in der Regel freilich schwieriger zu verstehen sind als Texte der modernen Fremdsprachen. Allerdings ist der Grund dafür auch in der unterschiedlichen Unterrichtsgestaltung der verschieden Fremdsprachen zu suchen.[5]
3. Methoden des neusprachlichen Unterrichts und ihre Anwendung im Lateinunterricht
Einen wesentlichen Unterschied zwischen dem alt- und neusprachlichen Unterricht sieht Krell in der Art und Weise des Spracherwerbs, der im neusprachlichen Unterricht ganz im Gegensatz zum altsprachlichen Unterricht auf einen aktiven Sprachgebrauch zielt. Denn „Aktive Sprachbeherrschung bedeutet nicht nur das Begreifen von Grammatikregeln (Kognition), sondern auch das Erlernen von syntaktischen, morphosyntaktischen und semantischen Mustern (Automatisierung).“[6]
Da ein verbesserter rezeptiver Sprachgebrauch erreicht werden kann, indem man einen produktiven Umgang mit der Sprache trainiert, wäre es vielleicht sinnvoll, auch im Lateinunterricht Methoden des neusprachlichen Unterrichts zum Erwerb einer aktiven Sprachbeherrschung anzuwenden. Denn dadurch kann eine Grundlage für den passiven Sprachgebrauch gebildet werden, da durch die Automatisierung, die dabei entsteht, können Texte leichter und auch schneller entschlüsselt werden, was bei dem aktuell von vielen Lehrern beklagten Zeitmangel im Unterricht nur von Vorteil sein kann.[7]
Durch die mündliche Produktion von lateinischen Sätzen schärft sich auch das Verständnis für gehörte Sätze. Die richtige Aussprache ist im Lateinischen sehr wichtig, da feine Klangunterschiede bereits Bedeutungsunterschiede sein können.[8]
Doch wie kann ein aktiver Sprachgebrauch im Lateinischen erreicht werden?
Hierbei muss wieder bedacht werden, dass der Lateinunterricht nicht wie die modernen Fremdsprachen auf eine kommunikative Kompetenz abzielt, sondern darauf, in Bezug auf die aktuelle Grammatik und Thematik und das aktuelle Vokabular „Latine scribere und Latine loqui“[9], also sowohl mündlich als auch schriftlich lateinische Sätze bilden, um bestimmte Schemata zu automatisieren. Denn gerade beim Übersetzen ist wegen der bereits genannten Sprachökonomie des Lateinischen ein automatisierter kontextbezogener Wortschatz von großem Vorteil.
[...]
[1] Bindseil, Heinrich Ernst: Verhandlungen der siebzehnten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Breslau vom 28. September bis 1. Oktober 1857. Breslau: Verlag Joseph Max und Komp., 1858, S. 143
[2] Vossen, C.: Mutter Latein und ihre Töchter: Europas Sprachen und ihre Herkunft. Düsseldorf: Stern-Verlag 1992 S.81
[3] vgl. Weeber, S. 33-34
[4] vgl. Krell, S. 109
[5] Vgl. Krell, S. 109
[6] Krell S. 109
[7] Krell S. 110
[8] vgl. Wolf, S. 209 ff.
[9] Krell, Michaela: Kein Leseverstehen ohne Sprechen und Schreiben!, in: Forum Classicum. Zeitschrift für die Fächer Latein und Griechisch an Schulen und Universitäten (2/2006), Bamberg S. 110
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Schreiben und Sprechen im Lateinunterricht zum besseren Leseverständnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/135186