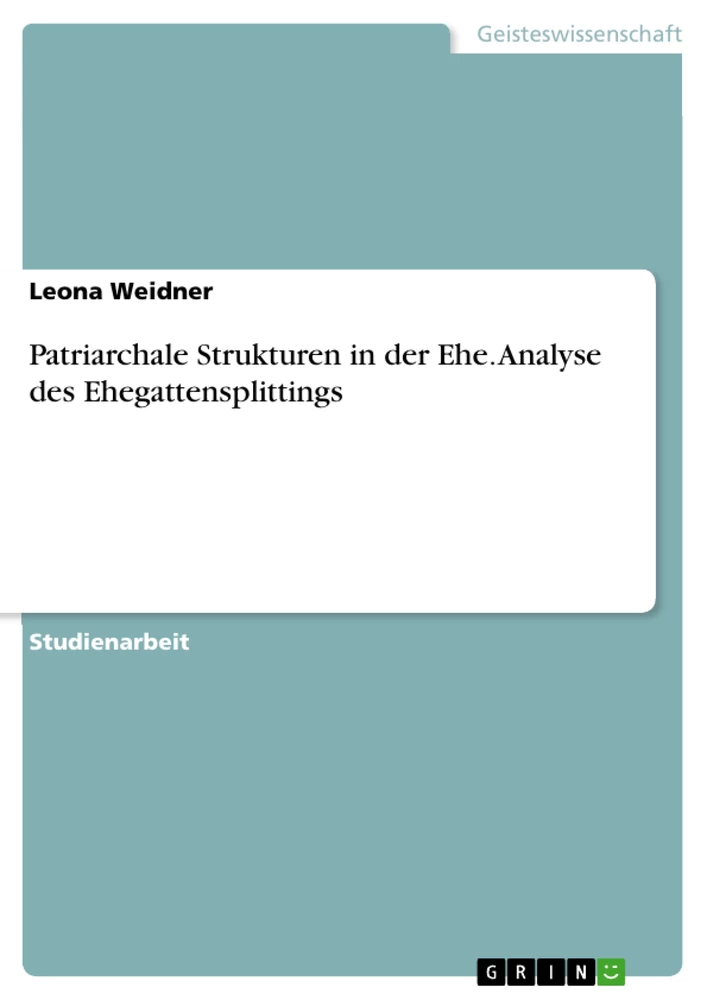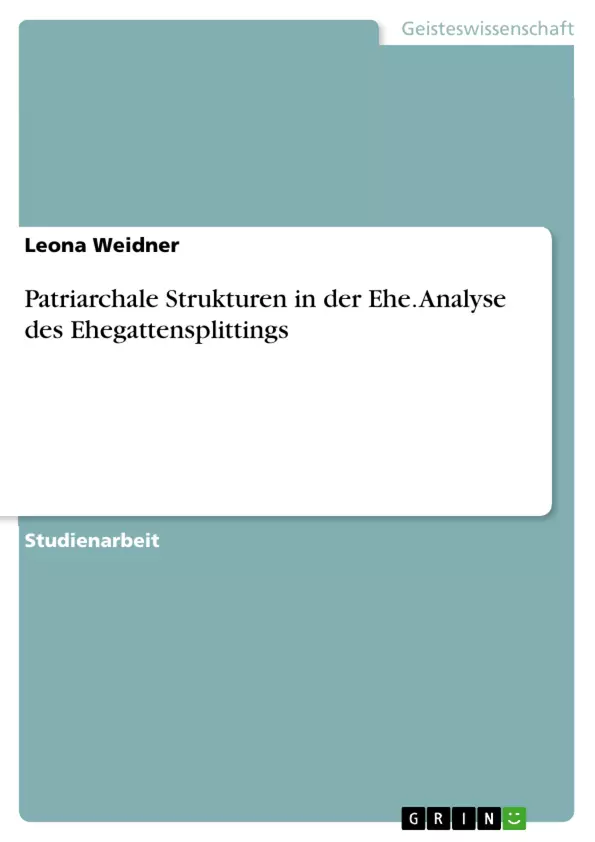Diese Arbeit befasst sich mit den patriarchalen Strukturen der Ehe und wirft dabei einen besonderen Blick auf das Ehegattensplitting. Hierbei steht die folgende Forschungsfrage im Mittelpunkt: Inwieweit ist der Einfluss des Ehegattensplitting auf die Geschlechterbeziehungen in Deutschland aus gleichheitsfeministischer Sicht zu bewerten? Um die Leitfrage zu beantworten, wird zuerst ein Überblick über die Forschung zum Thema Geschlechterbeziehungen gegeben und begründet, warum ich die Patriarchatstheorie von Sylvia Walby zur Analyse des Ehegattensplittings gewählt wurde und was das für die Konzeption der Frau in dieser Arbeit bedeutet. Daraufhin soll näher auf die Theorie eingegangen werden.
In der Analyse werden dann die reellen Auswirkungen des Ehegattensplittings erläutert und dargelegt, inwiefern diese nach Sylvia Walbys Theorie als patriarchal zu bewerten sind. Die Beantwortung dieser Frage ist relevant, da die Forschung den eigentlichen politischen Zweck von Ehen selten gegen deren geschlechtsspezifischen Auswirkungen aufwiegt und das Konzept diesbezüglich auch gesellschaftlich wenig hinterfragt wird. Diese Arbeit soll deshalb auch ein Denkanstoß sein, zu überlegen, welche normativen Vorstellungen hinter politischen Familienkonzepten wie der Ehe stehen und ob ein Konzept wie die Ehe dementsprechend noch sinnvoll und angemessen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie von Geschlechterbeziehungen und Patriarchat
- 2.1. Geschlechterbeziehungen der Politikwissenschaft
- 2.2. Der soziologische Patriarchatsbegriff
- 2.3. Die Frau* in dieser Arbeit
- 2.4. Die sechs patriarchalen Strukturen nach Sylvia Walby
- 2.4.1. Der patriarchale Produktionsmodus
- 2.4.2. Patriarchale Zusammenhänge in der Lohnarbeit
- 2.4.3. Der patriarchale Staat
- 2.4.4. Männliche Gewalt
- 2.4.5. Patriarchale Zusammenhänge in der Sexualität
- 2.4.6. Patriarchale Kultur
- 2.5. Grenzen der Theorie
- 3. Das Ehegattensplitting
- 3.1. Gesamtbeurteilung der deutschen Wohlfahrtspolitik
- 3.2. Wie funktioniert Ehegattensplitting
- 4. Einordnung in die Patriarchatstheorie
- 4.1. Auswirkungen auf Frauen* in der Lohnarbeit
- 4.2. Entzug der Produkte der eigenen Arbeit
- 4.3. Hetero- und Mononormativität
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Ehegattensplittings auf Geschlechterbeziehungen in Deutschland aus gleichheitsfeministischer Perspektive. Sie analysiert, inwieweit das Ehegattensplitting patriarchale Strukturen verstärkt oder aufrechterhält. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Auswirkungen auf Frauen* als marginalisierte Gruppe.
- Analyse des Ehegattensplittings im Kontext der deutschen Wohlfahrtspolitik
- Anwendung der Patriarchatstheorie von Sylvia Walby zur Bewertung des Ehegattensplittings
- Untersuchung der Auswirkungen des Ehegattensplittings auf Frauen* in der Lohnarbeit
- Diskussion der Rolle von Hetero- und Mononormativität im Kontext des Ehegattensplittings
- Bewertung des Ehegattensplittings im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit gleichheitsfeministischen Zielen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss des Ehegattensplittings auf Geschlechterbeziehungen in Deutschland aus gleichheitsfeministischer Sicht. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Ehe und deren rechtliche Gestaltung, insbesondere den Aspekt der finanziellen Abhängigkeit von Frauen*. Die Autorin begründet ihre Fokussierung auf das Ehegattensplitting und die Wahl der Patriarchatstheorie von Sylvia Walby als analytisches Werkzeug. Die Arbeit wird als Beitrag zur kritischen Reflexion gesellschaftlicher Familienkonzepte positioniert.
2. Theorie von Geschlechterbeziehungen und Patriarchat: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über bestehende Forschung zu Geschlechterverhältnissen in Politikwissenschaft und Soziologie. Es werden verschiedene Ansätze, wie der von Birgit Sauer und Gender Regime Ansätze, vorgestellt und deren Eignung zur Analyse des Ehegattensplittings diskutiert. Die Autorin begründet die Wahl der Patriarchatstheorie von Sylvia Walby und erläutert ihre Relevanz für die Konzeption des Begriffs "Frau*" in dieser Arbeit. Das Kapitel schließt mit einer detaillierten Darstellung der gewählten Theorie und ihrer Limitationen im Kontext der Untersuchung.
3. Das Ehegattensplitting: Dieses Kapitel beschreibt das deutsche Ehegattensplitting und seine Funktionsweise im Detail. Es analysiert die Gesamtbeurteilung der deutschen Wohlfahrtspolitik im Bezug auf das Ehegattensplitting und seine Auswirkungen auf die Verteilung von Einkommen und Ressourcen innerhalb von Ehen. Der Abschnitt behandelt die Implikationen des Systems für die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die soziale Stellung von Frauen*. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Systems als sozialpolitisches Instrument und seinen komplexen Auswirkungen.
4. Einordnung in die Patriarchatstheorie: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Ehegattensplittings auf Frauen* im Kontext der Patriarchatstheorie von Sylvia Walby. Es untersucht, inwieweit das System patriarchale Strukturen in der Lohnarbeit reproduziert und verstärkt. Es werden konkrete Beispiele für den Entzug der Produkte der eigenen Arbeit und die Verstärkung von Hetero- und Mononormativität durch das Ehegattensplitting erörtert. Dieses Kapitel stellt die Verbindung zwischen der theoretischen Grundlage und der empirischen Analyse her, um die Forschungsfrage zu beantworten.
Schlüsselwörter
Ehegattensplitting, Patriarchat, Geschlechterbeziehungen, Gleichheitsfeminismus, Wohlfahrtsstaat, Sylvia Walby, Deutschland, Frauen*, Lohnarbeit, Hetero- und Mononormativität, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einfluss des Ehegattensplittings auf Geschlechterbeziehungen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Ehegattensplittings auf Geschlechterbeziehungen in Deutschland aus einer gleichheitsfeministischen Perspektive. Der Fokus liegt auf der Analyse, inwieweit das Ehegattensplitting patriarchale Strukturen verstärkt oder aufrechterhält, insbesondere in Bezug auf die Auswirkungen auf Frauen* als marginalisierte Gruppe.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Patriarchatstheorie von Sylvia Walby als analytisches Werkzeug, um das Ehegattensplitting zu bewerten. Es werden die sechs patriarchalen Strukturen nach Walby (Produktionsmodus, Lohnarbeit, Staat, männliche Gewalt, Sexualität, Kultur) herangezogen, um die Auswirkungen des Splittings zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Theorie von Geschlechterbeziehungen und Patriarchat, 3. Das Ehegattensplitting, 4. Einordnung in die Patriarchatstheorie und 5. Fazit. Kapitel 2 bietet einen theoretischen Überblick, Kapitel 3 beschreibt das Ehegattensplitting, Kapitel 4 analysiert dessen Auswirkungen im Kontext der Patriarchatstheorie, und Kapitel 1 und 5 bilden Einleitung und Schlussfolgerung.
Wie wird das Ehegattensplitting in der Arbeit beschrieben?
Das Kapitel über das Ehegattensplitting beschreibt detailliert dessen Funktionsweise und analysiert seine Auswirkungen auf die Verteilung von Einkommen und Ressourcen innerhalb von Ehen. Es beleuchtet die Implikationen für die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die soziale Stellung von Frauen* und betrachtet das System als sozialpolitisches Instrument mit komplexen Auswirkungen.
Welche Auswirkungen des Ehegattensplittings werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Ehegattensplittings auf Frauen* in der Lohnarbeit, den Entzug der Produkte der eigenen Arbeit und die Verstärkung von Hetero- und Mononormativität. Es wird analysiert, inwieweit das System patriarchale Strukturen reproduziert und verstärkt.
Welche weiteren Themen werden behandelt?
Neben dem Ehegattensplitting werden auch die deutsche Wohlfahrtspolitik, verschiedene Ansätze der Geschlechterforschung (z.B. Birgit Sauer, Gender Regime Ansätze) und die Grenzen der gewählten Patriarchatstheorie diskutiert. Die Arbeit beleuchtet auch die historische Entwicklung der Ehe und deren rechtliche Gestaltung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Der Inhalt des Fazitkapitels wird hier nicht vorweggenommen, da es die Kernaussage der gesamten Arbeit darstellt und im vollständigen Text nachzulesen ist.)
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ehegattensplitting, Patriarchat, Geschlechterbeziehungen, Gleichheitsfeminismus, Wohlfahrtsstaat, Sylvia Walby, Deutschland, Frauen*, Lohnarbeit, Hetero- und Mononormativität, soziale Ungleichheit.
- Quote paper
- Leona Weidner (Author), 2022, Patriarchale Strukturen in der Ehe. Analyse des Ehegattensplittings, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1348060