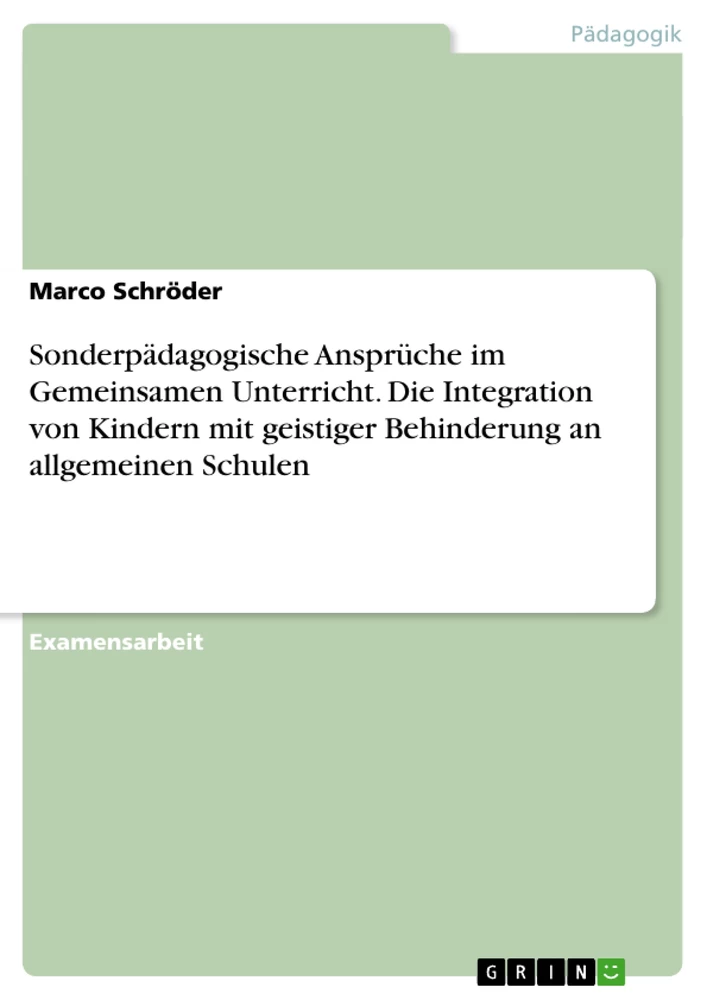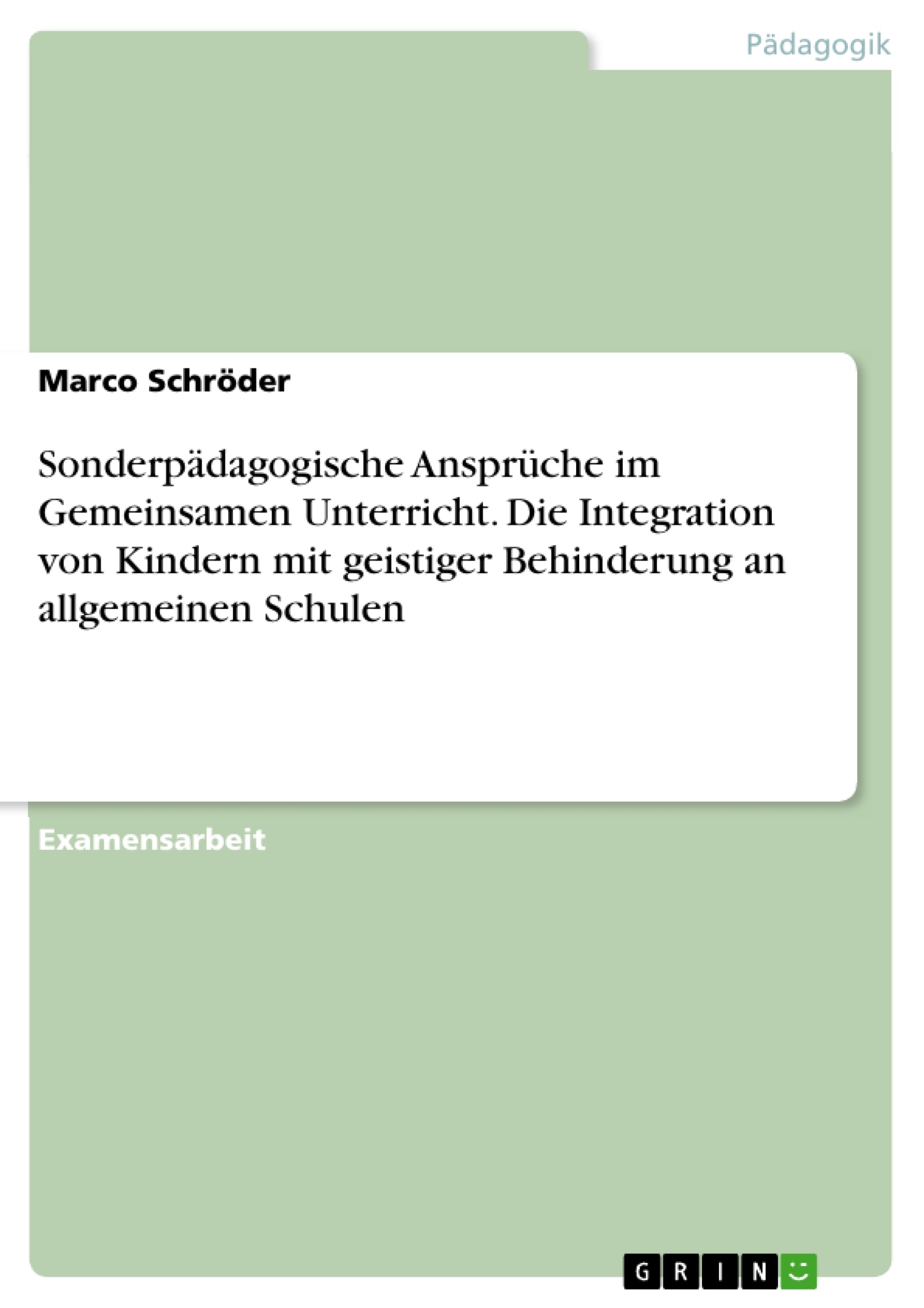Zum Ende meines Studiums drängten sich mir zunehmend Fragen nach meiner beruflichen Zukunft als Sonderpädagoge auf. So zum Beispiel „Wie wird sich das bisher in der Theorie gelernte in der Praxis umsetzen lassen?“, „Wie werde ich den ‚Sprung ins kalte Wasser’ verkraften, plötzlich nicht mehr mit Büchern, sondern mit Kindern zu ‚agieren’?“, „In welcher Schule (Schulform) werde ich tätig sein?“, „Mit welchen Schülern und Kollegen werde ich zu tun haben, und wie werden sie mich als Neuling aufnehmen?“. Ich möchte mich daher in dieser Arbeit, die ich als Abschlussarbeit meines Studiums, also als Manifestation meiner hier erworbenen Fähigkeiten begreife, dazu nutzen, mich diesen Fragen (zumindest theoretisch) zu nähern.
Der Titel der Arbeit, ‚Kooperation von Lehrerinnen und Lehrern im Gemeinsamen Unterricht - Erfahrungen und Überlegungen zur Gestaltung kooperativer Prozesse bei der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung in allgemeinen Schulen’ eröffnet einen Zugang zu vielen dieser Fragen, indem er wesentliche Größen nennt und zugleich in einen für meine berufliche Perspektive sinngebenden Zusammenhang stellt. Er beschreibt das Beschäftigungsfeld als Lehrer im Gemeinsamen Unterricht und verweist auf den Auftrag, Schüler mit ‚geistiger Behinderung’ in den Unterricht an allgemeinen Schulen einzubinden. Gleichzeitig gibt er den Hinweis, dass die besondere Aufgabe hierbei in der Gestaltung der kooperativen Prozesse liegt.
Als Lehrer im Gemeinsamen Unterricht in einer allgemeinen Schule zu unterrichten, zeigt mir eine Alternative zur Tätigkeit in der Schule für Geistigbehinderte auf. Die zunehmende Individualisierung und die sich damit ergebende Heterogenität der Schülerschaft, aber auch die aus der Beschäftigung mit integrativer Pädagogik gewonnene Erkenntnis, dass Sonderschule oft ‚Sonderbeschulung’ und damit Diskriminierung bedeutet, weisen ‚eine Schule für alle Kinder’ als Perspektive aus. Der Auftrag, den Schülern mit ‚geistiger Behinderung’ die Teilnahme am Gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen, verlangt nicht nur ein spezialisiertes sonderpädagogisches Wissen, sondern eröffnet auch neue Aufgaben und Anforderungen durch die gemeinsame Gestaltung kooperativer Prozesse. Letztendlich werden sich mir viele der oben genannten Fragen und die damit verbundenen Erwartungen erst allmählich und im Verlaufe meiner Arbeit als Lehrer erschließen, sie stellen aber in jedem Fall eine interessante Herausforderung dar.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen, Voraussetzungen und Überlegungen zum gemeinsamen Unterricht
- 2.1 Gemeinsamer Unterricht als logische Konsequenz des Wandels im Behinderungsbegriff
- 2.2 Die bildungspolitischen Rahmenbedingungen aus dem Blickfeld des gemeinsamen Unterrichts
- 2.3 Überlegungen zur schulischen Integration von,geistig behinderten' Kindern
- 2.4 Eine Schule für alle: Schüler mit, schwerer Behinderung' im Gemeinsamen Unterricht
- 3. Kooperation von Lehrern im Gemeinsamen Unterricht
- 3.1 Methode
- 3.2 Schule konkret: Gespräch mit einer Sonderpädagogin
- 3.3 Situation und Aufgaben der Sonderpädagogen
- 3.4 Situation und Aufgaben der Grundschullehrer aus sonderpädagogischer Sicht
- 3.5 Rollenerwartungen im Team
- 3.6 Konflikte in der Kooperation
- 3.7 Bedingungen für eine erfolgreiche Kooperation
- 4. Reflexion
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Kooperation von Lehrerinnen und Lehrern im Gemeinsamen Unterricht. Der Fokus liegt auf der Gestaltung kooperativer Prozesse bei der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung in allgemeinen Schulen. Die Arbeit analysiert den Wandel des Behinderungsbegriffs und die damit verbundenen bildungspolitischen Rahmenbedingungen für den gemeinsamen Unterricht. Zudem werden die spezifischen Bedürfnisse und Möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung und schwerer Behinderung im integrativen Unterricht beleuchtet.
- Der Wandel des Behinderungsbegriffs und die Integration von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung in allgemeinen Schulen
- Bildungspolitische Rahmenbedingungen und Herausforderungen des gemeinsamen Unterrichts
- Die Rolle von Sonderpädagogen und Regelschullehrern in der Kooperation
- Die Gestaltung kooperativer Prozesse im Unterricht und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben
- Bedingungen für eine erfolgreiche Kooperation zwischen Lehrern im Gemeinsamen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Kooperation von Lehrern im Gemeinsamen Unterricht ein und beleuchtet die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Regelschullehrern und Sonderpädagogen. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen für den gemeinsamen Unterricht, indem es den Wandel des Behinderungsbegriffs, die bildungspolitischen Rahmenbedingungen, sowie die spezifischen Bedürfnisse und Möglichkeiten von Schülern mit geistiger Behinderung und schwerer Behinderung im integrativen Unterricht diskutiert. Kapitel 3 analysiert die Erfahrungen und Herausforderungen der Zusammenarbeit im Gemeinsamen Unterricht anhand eines Interviews mit einer Sonderpädagogin. Die Kapitel 3.3 und 3.4 beschreiben die Situation und Aufgaben von Sonderpädagogen und Grundschullehrern in der kooperativen Arbeit. Schließlich werden die Rollenerwartungen im Team, Konflikte in der Kooperation und Bedingungen für eine erfolgreiche Kooperation beleuchtet.
Schlüsselwörter
Gemeinsamer Unterricht, Kooperation, Sonderpädagogik, Integration, Inklusion, geistige Behinderung, schwere Behinderung, Inklusionspädagogik, Schulische Integration, Bildungspolitk, Lehrerrolle, Teamarbeit, Konflikte, Zusammenarbeit, Bedingungen für gelungene Kooperation.
- Arbeit zitieren
- Marco Schröder (Autor:in), 2003, Sonderpädagogische Ansprüche im Gemeinsamen Unterricht. Die Integration von Kindern mit geistiger Behinderung an allgemeinen Schulen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/13425