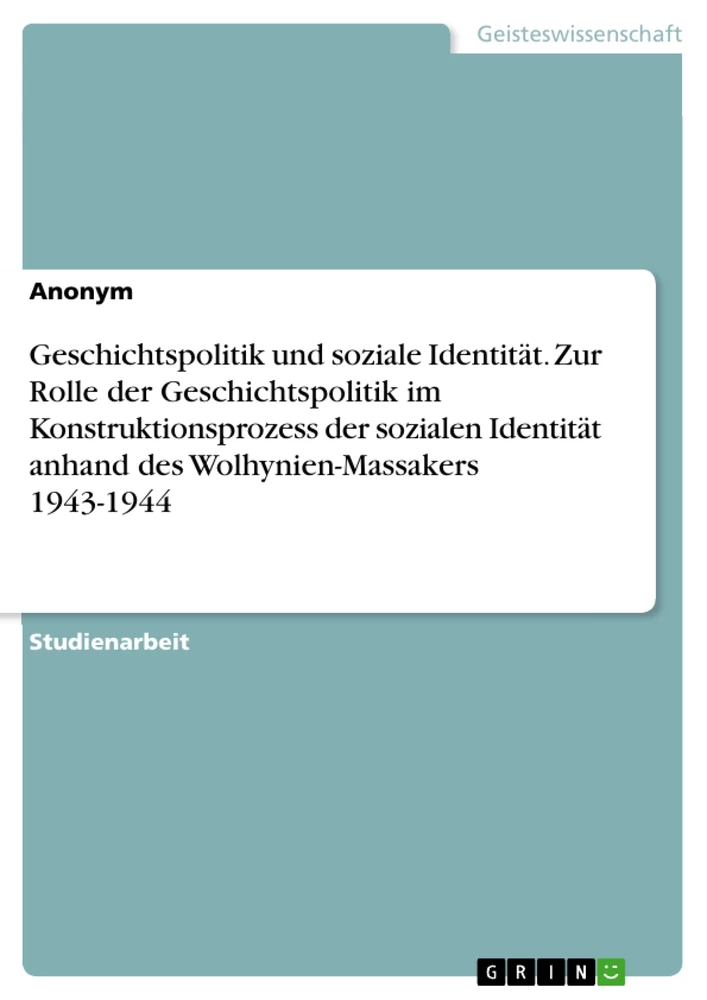Inwiefern kann der Umgang mit der Wolhynien-Tragödie in Polen und in der Ukraine als ein Teil vom Konstruktionsprozess ihrer sozialen Identität wahrgenommen werden?
Diese Arbeit befasst sich mit der Wahrnehmung vom Wolhynien-Massaker in Polen und in der Ukraine. Dabei ist das Ziel, nicht die Richtigkeit der Aussagen der Historiker*innen festzustellen, sondern zu analysieren, auf welche Weise mit der Thematik in den beiden Ländern umgegangen wird und wurde.
Die Analyse findet anhand der Theorie von Horst-Alfred Heinrich statt. Der Soziologe erkennt in Henri Tajfel’s Theorie der sozialen Identität viele Aussagen, die den Zusammenhang der sozialen Identität mit der Geschichtspolitik erklären lassen.
Zunächst werden die Thesen von Heinrich erläutert. Der zweite Teil geht auf das Wolhynien-Massaker und das polnisch-ukrainische Konflikt ein. Dabei werden die historischen Aspekte angesprochen, ebenso wie die Versuche der beiden Länder, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Daraufhin folgt eine Analyse der kollektiven Erinnerung in Polen und in der Ukraine in Hinsicht auf die Wolhynien-Tragödie. Zum Schluss wird ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Erklärungsansatz von Horst-Alfred Heinrich
- Grundlagen der Theorie sozialer Identität
- Der Bezug auf die Geschichte. Die Theorie temporaler Vergleiche von Stuart Albert
- 3. Das Massaker von Wolhynien und Ostgalizien und ihre Aufarbeitung
- 3.1 Der Konflikt aus historischer Sicht
- 3.2 Die Aufarbeitung des Konflikts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die unterschiedliche Wahrnehmung des Wolhynien-Massakers in Polen und der Ukraine. Ziel ist nicht die Feststellung der historischen Richtigkeit, sondern die Analyse des Umgangs mit diesem Thema in beiden Ländern im Kontext der Konstruktion sozialer Identität. Die Analyse basiert auf der Theorie von Horst-Alfred Heinrich.
- Die Rolle der kollektiven Erinnerung bei der Konstruktion nationaler Identität.
- Der Einfluss von Geschichtspolitik auf die Wahrnehmung des Wolhynien-Massakers.
- Die unterschiedlichen Interpretationen des Konflikts in Polen und der Ukraine.
- Die Anwendung der Theorie sozialer Identität auf den Fall des Wolhynien-Massakers.
- Der Vergleich verschiedener historiografischer Ansätze zur Aufarbeitung des Konflikts.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der unterschiedlichen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und insbesondere den polnisch-ukrainischen Konflikt in Wolhynien und Ostgalizien ein. Sie hebt die Diskrepanzen in den Opferzahlen und Interpretationen der Ereignisse hervor und stellt die Forschungsfrage nach dem Umgang mit der Wolhynien-Tragödie als Teil des Konstruktionsprozesses der sozialen Identität in Polen und der Ukraine. Der theoretische Ansatz von Horst-Alfred Heinrich wird als Grundlage der Analyse vorgestellt.
2. Der Erklärungsansatz von Horst-Alfred Heinrich: Dieses Kapitel präsentiert den theoretischen Rahmen der Arbeit, basierend auf Horst-Alfred Heinrichs Ansatz. Heinrich verbindet die Theorie der sozialen Identität von Tajfel mit der Theorie des zeitlichen Vergleichs von Stuart Albert. Es wird erläutert, wie soziale Gruppen ihre Identität durch positive Selbstwertgefühl-Strategien, Vergleiche mit anderen Gruppen und die Manipulation historischer Ereignisse aufrechterhalten. Die verschiedenen Strategien im Umgang mit negativem Vergleichsergebnissen – Wechsel des Vergleichsobjekts, der Vergleichsdimension oder Redefinition sozialer Kategorien – werden detailliert beschrieben. Die Bedeutung der Geschichte als Instrument der Geschichtspolitik zur Stärkung der nationalen Identität wird hervorgehoben.
3. Das Massaker von Wolhynien und Ostgalizien und ihre Aufarbeitung: Dieses Kapitel beschreibt den Konflikt in Wolhynien und Ostgalizien während des Zweiten Weltkriegs, fokussiert auf die Beteiligung der UPA und OUN-B an den Massakern an der polnischen und jüdischen Bevölkerung. Es beleuchtet die unterschiedlichen historischen Interpretationen des Konflikts durch verschiedene Gruppen von Historikern, darunter "Kämpfer", "Legitimisten", "Ankläger", "Verteidiger" und "Versöhner". Die Kapitel analysiert die Aufarbeitung des Konflikts in der Nachkriegszeit unter dem kommunistischen Regime und die Entwicklung der Geschichtspolitik in Polen und der Ukraine nach 1989, einschließlich der unterschiedlichen staatlichen Strategien im Umgang mit der Vergangenheit und der Rolle von OUN und UPA in der nationalen Erinnerungskultur.
Schlüsselwörter
Wolhynien-Massaker, polnisch-ukrainischer Konflikt, soziale Identität, Geschichtspolitik, kollektive Erinnerung, Theorie der sozialen Identität, Horst-Alfred Heinrich, Henri Tajfel, nationale Identität, Erinnerungskultur, UPA, OUN-B, Historiografie, Opfer-Täter-Diskussion, ethnische Säuberung, Genozid.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Umgang mit dem Wolhynien-Massaker in Polen und der Ukraine im Kontext der Konstruktion sozialer Identität"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die unterschiedliche Wahrnehmung des Massakers von Wolhynien und Ostgalizien in Polen und der Ukraine. Der Fokus liegt nicht auf der Feststellung der historischen Richtigkeit, sondern auf der Analyse des Umgangs mit diesem Thema in beiden Ländern im Kontext der Konstruktion sozialer Identität.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Analyse basiert auf dem Erklärungsansatz von Horst-Alfred Heinrich, der die Theorie der sozialen Identität von Tajfel mit der Theorie des zeitlichen Vergleichs von Stuart Albert verbindet. Dieser Ansatz erklärt, wie soziale Gruppen ihre Identität durch positive Selbstwertgefühl-Strategien, Vergleiche mit anderen Gruppen und die Manipulation historischer Ereignisse aufrechterhalten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der kollektiven Erinnerung bei der Konstruktion nationaler Identität, den Einfluss von Geschichtspolitik auf die Wahrnehmung des Massakers, die unterschiedlichen Interpretationen des Konflikts in Polen und der Ukraine, die Anwendung der Theorie sozialer Identität auf den Fall des Wolhynien-Massakers und den Vergleich verschiedener historiografischer Ansätze zur Aufarbeitung des Konflikts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Einleitung, die den theoretischen Ansatz und die Forschungsfrage vorstellt; ein Kapitel zur Theorie von Horst-Alfred Heinrich; und ein Kapitel zum Massaker von Wolhynien und Ostgalizien und dessen Aufarbeitung, welches unterschiedliche historische Interpretationen und die Geschichtspolitik in Polen und der Ukraine beleuchtet.
Welche Akteure werden im Zusammenhang mit dem Massaker genannt?
Die Arbeit behandelt die Beteiligung der UPA und OUN-B an den Massakern an der polnischen und jüdischen Bevölkerung. Verschiedene Gruppen von Historikern werden im Hinblick auf ihre Interpretationen des Konflikts betrachtet ("Kämpfer", "Legitimisten", "Ankläger", "Verteidiger", "Versöhner").
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Wolhynien-Massaker, polnisch-ukrainischer Konflikt, soziale Identität, Geschichtspolitik, kollektive Erinnerung, Theorie der sozialen Identität, Horst-Alfred Heinrich, Henri Tajfel, nationale Identität, Erinnerungskultur, UPA, OUN-B, Historiografie, Opfer-Täter-Diskussion, ethnische Säuberung, Genozid.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen Wahrnehmungen und den Umgang mit dem Wolhynien-Massaker in Polen und der Ukraine zu analysieren und im Kontext der Konstruktion sozialer Identität zu verstehen. Es geht nicht um die Feststellung historischer Fakten, sondern um die Analyse der Erinnerungskulturen und Geschichtspolitiken beider Länder.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Geschichtspolitik und soziale Identität. Zur Rolle der Geschichtspolitik im Konstruktionsprozess der sozialen Identität anhand des Wolhynien-Massakers 1943-1944, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1333629