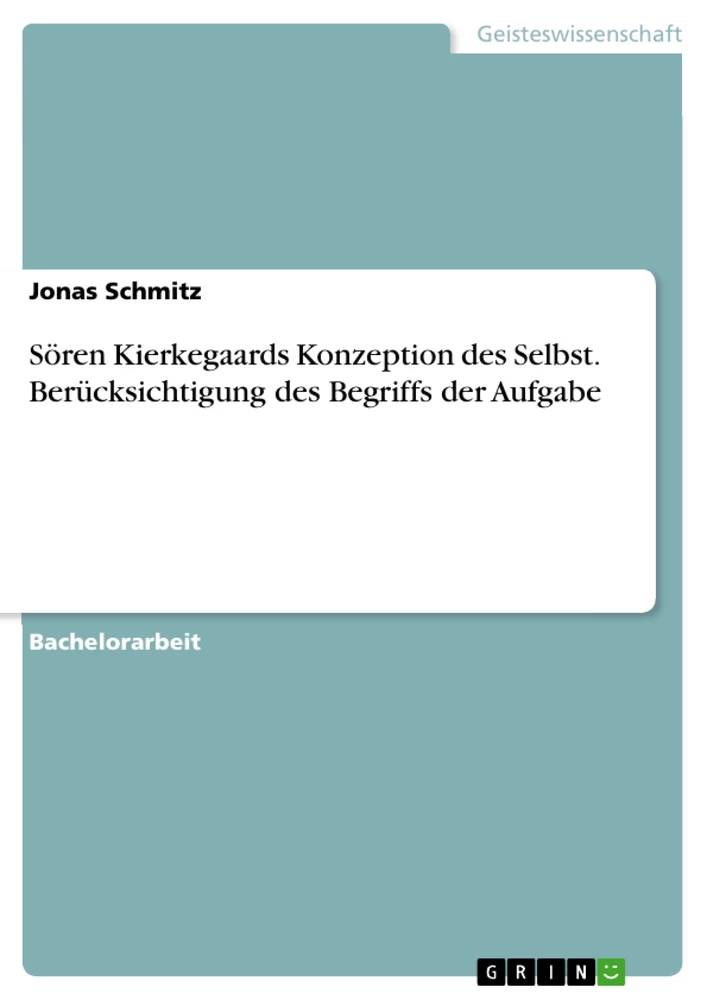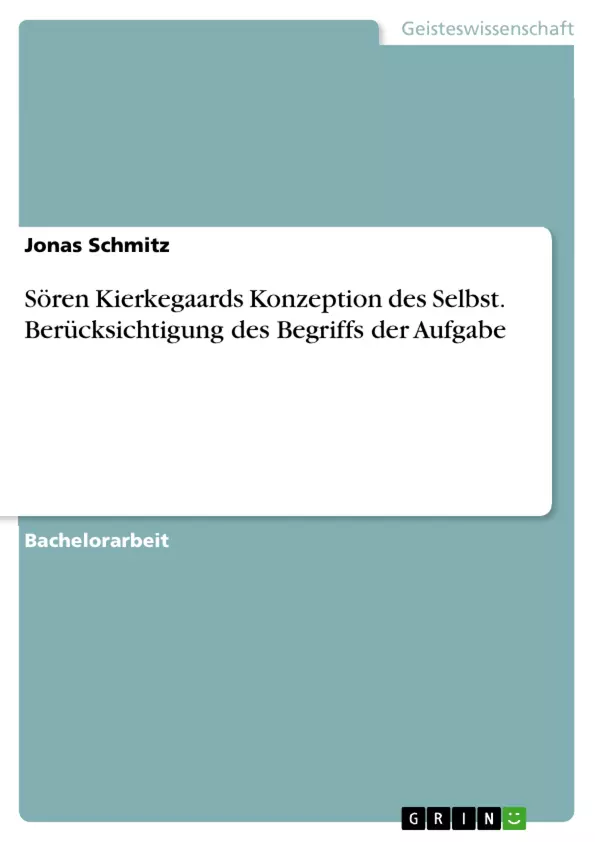Diese Bachelorarbeit widmet sich der Frage nach der Konzeption des Selbst bei Kierkegaard unter Berücksichtigung des Begriffs der Aufgabe. Kierkegaard entwickelt eine Konzeption des Selbst, die in einem immer wiederkehrenden Prozess, in einer Vollzugshaftigkeit besteht. Zur Untersuchung wird hauptsächlich der erste Abschnitt der Krankheit zum Tode herangezogen. Des weiteren wird uns Kierkegaards Forderung an das Selbst – die Aufgabe – interessieren. Für ein besseres Verständnis wird die Rolle der Vermittlung geklärt werden. Außerdem nicht zu vernachlässigen ist die Bedeutung Hegels, an welchen angelehnt, Kierkegaard eine eigene Form der Dialektik - die Existenzdialektik - entwirft. Sodann wir das Kierkegaard'sche Selbst - das Selbst als Verhältnis - erläutert und in Bezug zu seinem Verständnis des Menschen sowie dessen Grundbedingung gestellt. Dabei kristallisiert sich die Verzweiflung als "Schlüssel zum Selbst" heraus. Letzten Endes werden das Selbst und die damit einhergehende Aufgabe zusammen verwoben und deren Bedeutungs- und Plausibilitätsgehalt erarbeitet.
"Erkenne Dich Selbst!" soll am Portal des Orakels von Delphi gestanden haben. Die Frage nach Selbsterkenntnis bildet eine der Ausgangsfragen der Philosophie europäischer Prägung. Ihre Relevanz scheint einleuchtend, denn könnte der Mensch irgendetwas anderes erkennen, wenn er sich selbst nicht erkennen würde? Somit wäre die Frage nach dem Selbst allen anderen vorzuziehen. Die Frage nach Selbsterkenntnis, nach dem Selbst, die Frage nach einem gelingenden Menschsein wurden in verschiedener Art und Weise behandelt.
Doch treffen diese Probleme bei Sören Aabye Kierkegaard auf einen bis dato unbekannten fruchtbaren Boden etwas anderer Art. Die Herangehensweise des dänischen Philosophen ist eine, die sich schwer fassen lässt und sich ganz bewusst oft paradox vollzieht. Sein Schreibtstil nimmt häufig poetische Züge an und ähnelt eher selten den trockenen Ausführungen anderer Traktate. Durch seine Methode der indirekten Mitteilung steht nicht nur der Inhalt im Vordergrund, sondern auch die Form.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kierkegaards Dialektik
- 2.1 Entweder Denken oder bloße Schriftstellerei
- 2.2 Die Rolle der Vermittlung – die indirekte Mitteilung
- 2.3 Hegels Schatten
- 2.3.1 Existenzdialektik
- 3. Kierkegaards Konzeption des Selbst
- 3.1 Das Selbst als Verhältnis
- 3.1.1 Setzung der Thesen am Beginn der Krankheit zum Tode
- 3.1.2 Der Mensch als Inter-esse
- 3.1.3 Der Mensch im Rahmen der Zeit und die Rolle des Augenblicks
- 3.1.4 Verstricktheit als Brückenbegriff von Inter-esse, Zu-Sich-Verhalten und der Setzung durch das Andere
- 3.1.5 Die Verzweiflung als Schlüssel zum Selbst
- 3.2 Das Selbst als Aufgabe
- 3.2.1 'Gabe' und Aufgabe
- 3.2.2 Das gesunde Selbst und die Formen der Verzweiflung
- 3.2.3 Den Verstand verlieren – Aufhalten im und Aushalten des Paradoxons und die Hin-Gabe zu Gott
- 4. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert Sören Kierkegaards Konzeption des Selbst unter besonderer Berücksichtigung des Begriffs der Aufgabe. Im Fokus steht die Frage, wie sich Kierkegaards Selbstverständnis von dem traditionellen Verständnis einer unveränderlichen Essenz unterscheidet und wie die Aufgabe als ein immer wiederkehrender Prozess des Selbst-Werden im Vordergrund steht. Die Arbeit untersucht den ersten Teil der "Krankheit zum Tode", in der Kierkegaard das Wesen der Verzweiflung im Zusammenhang mit dem Selbst beleuchtet.
- Die Bedeutung der Aufgabe als zentraler Aspekt der Selbstfindung
- Kierkegaards Kritik an der traditionellen Vorstellung des Selbst als unveränderliche Essenz
- Die Rolle der Verzweiflung als Schlüssel zum Selbstverständnis
- Die Bedeutung von Hegels Philosophie für Kierkegaards Denkweise
- Die Verbindung von philosophischer Reflexion und poetischem Schreibstil
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach Kierkegaards Konzeption des Selbst vor und beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext der europäischen Philosophie. Zudem wird Kierkegaards einzigartige Herangehensweise anhand seiner Schreibmethode der indirekten Mitteilung näher betrachtet.
Das zweite Kapitel widmet sich Kierkegaards Dialektik. Es wird deutlich, dass seine Schriften über bloße Schriftstellerei hinausgehen und seine eigene Form der Existenzdialektik, die in starkem Kontrast zu Hegels Dialektik steht, beleuchtet wird.
Das dritte Kapitel geht detailliert auf Kierkegaards Konzeption des Selbst ein, indem es zunächst das Selbst als ein Verhältnis definiert und die zentralen Thesen der "Krankheit zum Tode" präsentiert. Im weiteren Verlauf werden Kierkegaards Ausführungen zur Verzweiflung und zur Aufgabe als Schlüssel zum Selbstverständnis erläutert.
Schlüsselwörter
Kierkegaard, Selbst, Aufgabe, Verzweiflung, Existenzdialektik, Krankheit zum Tode, indirekte Mitteilung, Hegels Schatten, Inter-esse, Verhältnis, anthropologische Thesen, Vermittlung, poetischer Schreibstil, Selbstfindung.
- Arbeit zitieren
- Jonas Schmitz (Autor:in), 2021, Sören Kierkegaards Konzeption des Selbst. Berücksichtigung des Begriffs der Aufgabe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1333416