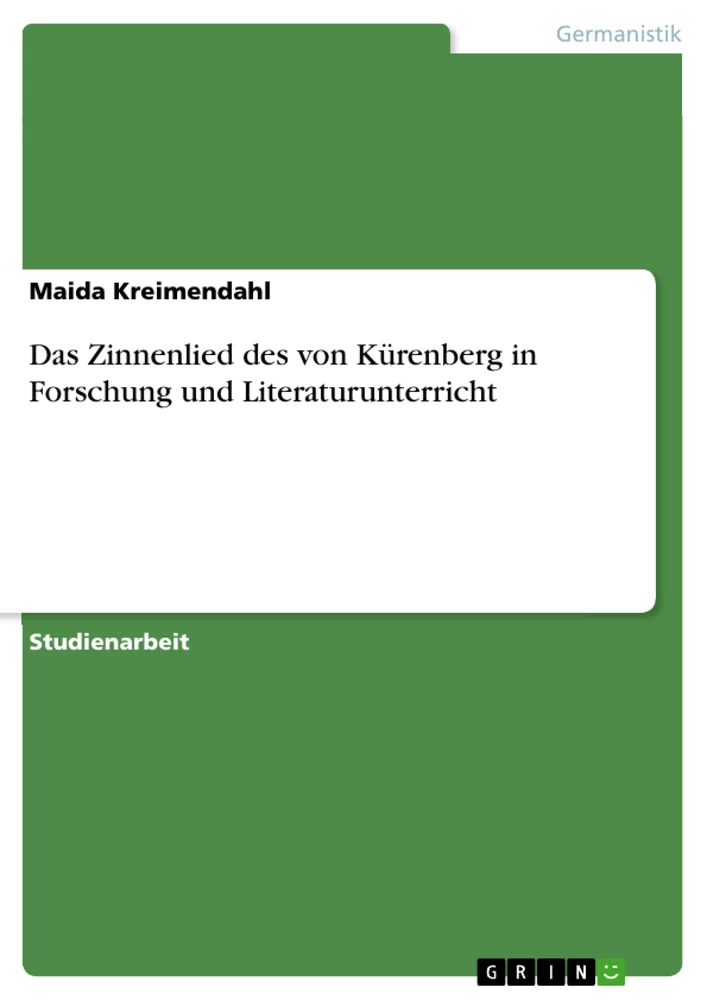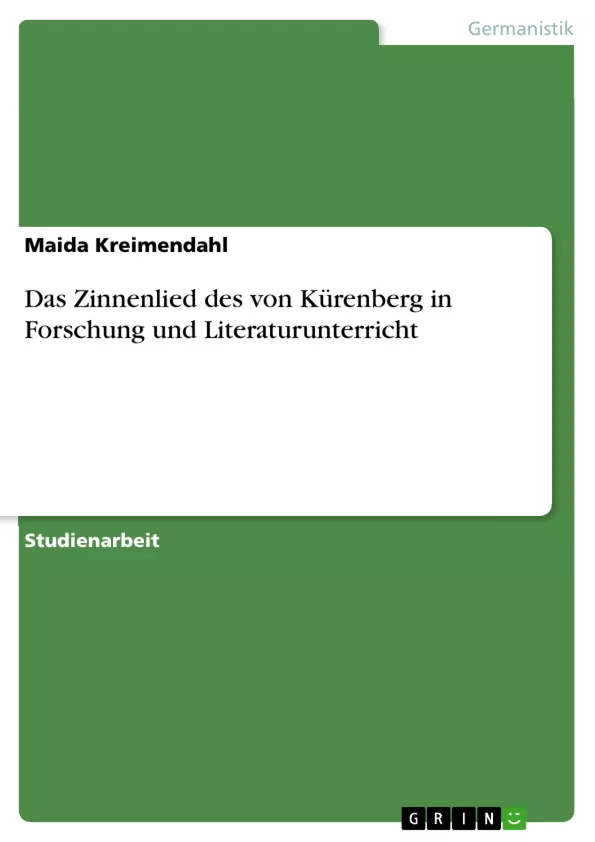Die Lieder des von Kürenberg zählen zu den bekannten Texten mittelalterlichen Minnesangs. Besonders das Falkenlied steht häufig im Zentrum des Kürenberg-Diskurses. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Zinnenstrophen, die als Zinnenwechsel ediert werden. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt der Zinnenstrophen auf den Genderkonfigurationen der Protagonisten, ihren antizipierten Rollenbildern sowie deren Destruktion. Um diesen Themen Tiefe zu verleihen, gibt die Arbeit zunächst einen Überblick über Autor, Überlieferung und spezifische Merkmale des frühen Minnesang. Danach erfolgt der Einstieg in die Textanalyse und Interpretation mit der zentralen Frage nach der bedeutungsimmanenten Anordnung der Strophen und deren Auswirkung auf die Rollenbilder der Protagonisten. Des Weiteren wird die Aufführungssituation der Texte als Interpretationsdimension vorgestellt und daran anschließend die Funktion der „Frau“ im Minnesang durchleuchtet.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der didaktischen Umsetzung des mittelalterlichen Stoffes mit seinen Möglichkeiten und Hindernissen für den Deutschunterricht. Die Vorschläge zur Nutzbarmachung des Stoffes orientieren sich durch die Jahrgangsstufen am Prinzip des handlungs- und produktionsorientierten Ansatzes, der die Selbsttätigkeit der Schüler als oberstes Bildungsziel beschreibt und einen identitätsorientierten Literaturunterricht anstrebt. Der direkte Bezug, den die Gender-Thematik zur Lebenswelt der Schüler erlaubt, kann als einer der großen Vorteile des Lyrikthemas gesehen werden. Hier stehen neben den literarischen Elementen besonders die Auseinandersetzung mit den eigenen Rollenanforderungen an Mann und Frau im Mittelpunkt. Auch die Handschrift selbst findet als Medium Eingang in die didaktischen Überlegungen. Ihre Stärken sollen besonders im Bereich „Original – Edition“ und „Bildanalyse“ zum Einsatz kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. in Kürenberges wîse - Autor, Sänger oder Fiktion?
- 2.1 sô sprach daz wîb - Überlieferung und Edition
- 2.2 Früher donauländischer Minnesang
- 2.3 Der Wechsel
- 3. Das Zinnenlied des von Kürenberg
- 3.1 Ich stuont mir nehtint spâte
- 3.2 Nu bring mir her vil balde
- 3.3 Jô stuont ich nehtint spâte
- 4. Interpretatorische Überlegungen
- 4.1 si muos der mîner mînne iemer darbende sîn - Zinnenwechsel?
- 4.2 er muos mir diu lant rûmen - Zinnenlied?
- 4.3 frouwe oder magedîn? - Das Budapester Fragment
- 4.4 dô hôrt ich einen rîter vil wol singen – Vortragssituation als Interpretationsdimension
- 4.5 ich was ein wip - Die Funktion der Rolle „Frau“
- 5. Daz ich ir holt sî - Doing Gender im Minnesang - Didaktische Überlegungen für den Deutschunterricht
- 5.1 Unterrichtsvorschläge für die Jahrgänge 5-10
- 5.2 Die Handschrift als Medium
- 6. Fazit
- 7. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zinnenstrophen des von Kürenberg, fokussiert auf die Darstellung von Gender-Figurationen und deren Dekonstruktion. Sie beleuchtet die Überlieferung, die Interpretation der Strophen und deren Bedeutung für die Rollenbilder der Protagonisten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der didaktischen Umsetzung des Stoffes im Deutschunterricht.
- Gender-Konfigurationen im frühen Minnesang
- Überlieferung und Edition der Zinnenstrophen
- Interpretation der Strophenanordnung und deren Wirkung auf die Rollenbilder
- Die Aufführungssituation als Interpretationsdimension
- Didaktische Überlegungen zur Umsetzung im Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Arbeit zum Zinnenlied des von Kürenberg in den Kontext des mittelalterlichen Minnesangs, wobei das Falkenlied als ein häufig diskutiertes Beispiel genannt wird. Der Fokus der Arbeit liegt auf den Gender-Konfigurationen der Protagonisten und deren Rollenbildern. Es wird ein Überblick über Autor, Überlieferung und spezifische Merkmale des frühen Minnesangs gegeben, bevor die Textanalyse und Interpretation beginnt.
2. in Kürenberges wîse – Autor, Sänger oder Fiktion?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Identität des Autors. Es wird auf die minimale gesicherte Biografie des "von Kürenberg" eingegangen und verschiedene Theorien zu seinem Namen und seiner möglichen Selbstbezeichnung in den Liedern diskutiert. Die beiden Überlieferungszeugen, die Manessische Handschrift (C) und das Budapester Fragment (Bu), werden vorgestellt und deren Bedeutung für die Rekonstruktion des Textes beleuchtet. Die unterschiedliche Anordnung der Strophen in den Handschriften und in gängigen Editionen wird thematisiert und die Gründe für diese Abweichungen werden als zentraler Punkt für die weitere Arbeit genannt.
3. Das Zinnenlied des von Kürenberg: Dieses Kapitel analysiert die einzelnen Strophen des Zinnenliedes. Es werden die Strophen einzeln betrachtet, wobei auf ihren Inhalt und mögliche Deutungen eingegangen wird. Die Analyse fokussiert wohl auf die sprachlichen Mittel und die Darstellung der Beziehung zwischen den Protagonisten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Strophen im Kontext des Gesamtwerkes, um einen fundierten Überblick über den Inhalt und die Thematik des Kapitels zu schaffen.
4. Interpretatorische Überlegungen: Dieses Kapitel präsentiert interpretatorische Ansätze zu den Zinnenstrophen. Es befasst sich mit verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, unter anderem mit der Frage nach einem möglichen Zinnenwechsel und der Bedeutung der räumlichen Konstellation. Die Rolle der Frau im Minnesang und die Vortragssituation als Interpretationsdimension werden analysiert. Die verschiedenen Perspektiven und Deutungsmöglichkeiten werden gegenübergestellt und kritisch diskutiert.
5. Daz ich ir holt sî - Doing Gender im Minnesang - Didaktische Überlegungen für den Deutschunterricht: Dieses Kapitel widmet sich der didaktischen Umsetzung des Stoffes im Deutschunterricht. Es werden konkrete Vorschläge für den Unterricht in den Jahrgängen 5-10 unter Berücksichtigung eines handlungs- und produktionsorientierten Ansatzes gemacht. Die Einbeziehung der Handschrift als Medium im Unterricht wird ebenfalls diskutiert, wobei die "Bildanalyse" und der Vergleich von Original und Edition besonders hervorgehoben werden. Der direkte Bezug zur Lebenswelt der Schüler durch die Gender-Thematik wird als großer Vorteil dargestellt.
Schlüsselwörter
Minnesang, von Kürenberg, Zinnenlied, Gender-Figurationen, Rollenbilder, Überlieferung, Edition, Textinterpretation, Didaktik, Deutschunterricht, mittelalterliche Lyrik, Frauenlied, Wechsel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "in Kürenberges wîse - Autor, Sänger oder Fiktion?"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Zinnenstrophen des von Kürenberg, konzentriert sich auf die Darstellung von Gender-Figurationen und deren Dekonstruktion. Sie untersucht die Überlieferung, Interpretation der Strophen und deren Bedeutung für die Rollenbilder der Protagonisten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der didaktischen Umsetzung im Deutschunterricht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Gender-Konfigurationen im frühen Minnesang, Überlieferung und Edition der Zinnenstrophen, Interpretation der Strophenanordnung und deren Wirkung auf die Rollenbilder, die Aufführungssituation als Interpretationsdimension und didaktische Überlegungen zur Umsetzung im Deutschunterricht.
Wer ist der Autor der Zinnenstrophen und wie verlässlich sind die Quellen?
Kapitel 2 ("in Kürenberges wîse – Autor, Sänger oder Fiktion?") befasst sich mit der Frage nach der Identität des Autors "von Kürenberg". Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien zu seinem Namen und seiner möglichen Selbstbezeichnung. Die beiden Überlieferungszeugen, die Manessische Handschrift (C) und das Budapester Fragment (Bu), werden vorgestellt und deren Bedeutung für die Rekonstruktion des Textes beleuchtet. Die unterschiedliche Strophenanordnung in den Handschriften und Editionen wird als zentraler Punkt für die Interpretation betrachtet.
Wie sind die Zinnenstrophen aufgebaut und wie werden sie interpretiert?
Kapitel 3 beschreibt den Aufbau des Zinnenliedes und analysiert die einzelnen Strophen hinsichtlich ihres Inhalts und möglicher Deutungen. Kapitel 4 ("Interpretatorische Überlegungen") präsentiert verschiedene interpretatorische Ansätze, diskutiert mögliche Zinnenwechsel, die Bedeutung der räumlichen Konstellation, die Rolle der Frau im Minnesang und die Vortragssituation als Interpretationsdimension. Verschiedene Perspektiven und Deutungsmöglichkeiten werden gegenübergestellt und kritisch diskutiert.
Welche didaktischen Vorschläge werden für den Unterricht gemacht?
Kapitel 5 ("Daz ich ir holt sî - Doing Gender im Minnesang - Didaktische Überlegungen für den Deutschunterricht") bietet konkrete Unterrichtsvorschläge für die Jahrgänge 5-10. Es wird ein handlungs- und produktionsorientierter Ansatz vorgeschlagen, der die Handschrift als Medium einbezieht ("Bildanalyse", Vergleich von Original und Edition). Der Bezug zur Lebenswelt der Schüler durch die Gender-Thematik wird als Vorteil hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Minnesang, von Kürenberg, Zinnenlied, Gender-Figurationen, Rollenbilder, Überlieferung, Edition, Textinterpretation, Didaktik, Deutschunterricht, mittelalterliche Lyrik, Frauenlied, Wechsel.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, der Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" bietet eine detaillierte Übersicht über den Inhalt jedes Kapitels, von der Einleitung bis zum Fazit.
Wie wird das Falkenlied in der Arbeit erwähnt?
Die Einleitung erwähnt das Falkenlied als ein häufig diskutiertes Beispiel im Kontext des mittelalterlichen Minnesangs, um die Arbeit zum Zinnenlied des von Kürenberg einzuordnen.
- Arbeit zitieren
- Maida Kreimendahl (Autor:in), 2014, Das Zinnenlied des von Kürenberg in Forschung und Literaturunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1331158