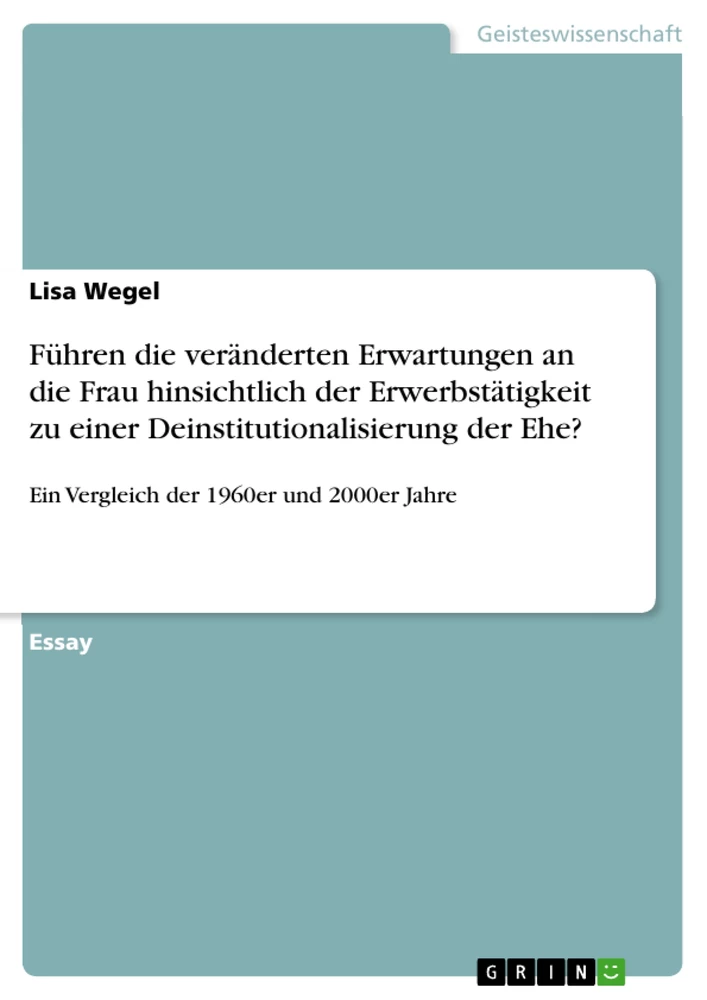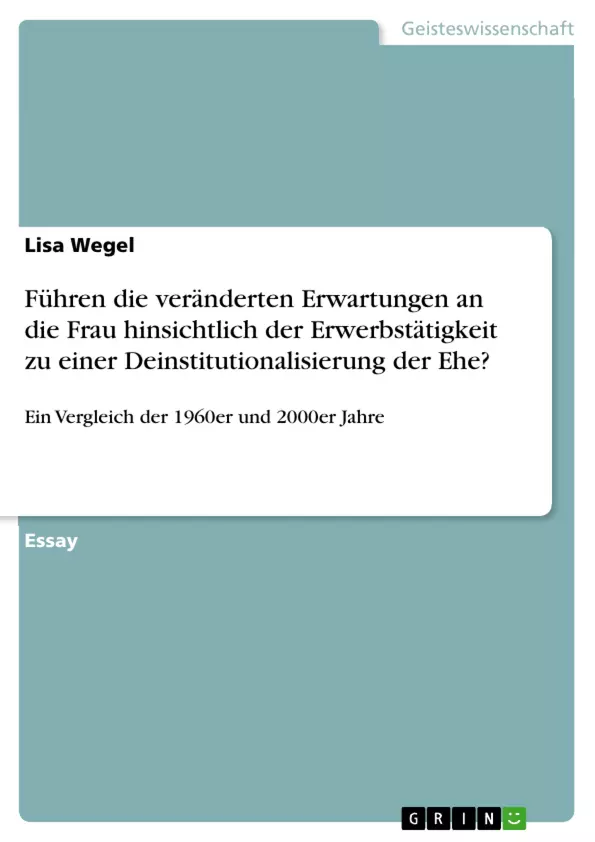„Bis dass der Tod euch scheidet“ – diese Frage wird Paaren, die heiraten, während des Ehegelübdes gestellt und mit „Ja“ beantwortet. Das Gelübde auf Ewigkeit verliert aber für immer mehr Paare in den 2000er Jahren an Bedeutung: Viele Menschen leben ohne Trauschein zusammen, beinahe jede zweite Ehe wurde im Jahr 2005 geschieden (Statistisches Bundesamt Deutschland 2021).
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen gestiegen ist (Statistisches Bundesamt Deutschland 2020). Es lässt sich vermuten, dass diese Veränderung mit den sinkenden Eheschließungen zusammenhängen.
Hieraus lässt sich die Fragestellung ableiten: Führen die veränderten Erwartungen an die Frau hinsichtlich der Erwerbstätigkeit zu einer Deinstitutionalisierung der Ehe?
Verglichen werden jeweils die beiden Zeiträume um die 1960er und 2000er Jahre. Die Wahl des Zeitraumes begründet sich darin, dass zwischen 1960 und den 2000er Jahren einige gewaltige Veränderungen die Gesellschaft neu geprägt haben, wie zum Beispiel neue Sozialgesetze, das Anstreben von Gleichberechtigung und mehr.
Eine mögliche These lautet daher: Die starken gesellschaftlichen Veränderungen hinsichtlich der Gleichberechtigung der Geschlechter, die die Gesellschaft und damit auch die Frau in den Jahren nach 1960 stark geprägt haben, haben dazu geführt, dass sie unabhängiger von ihrem Ehemann geworden ist.
Dadurch, dass sie nun vermehrt ihre eigenen Interessen verfolgen kann, haben sich auch die Erwartungen an die Frau verändert: sie übernimmt nun nicht mehr nur die Rolle als Ehefrau, Mutter und Hausfrau, sondern auch die, der eigenständigen Arbeitnehmerin. Durch die zusätzliche Rolle, die die Frau unabhängiger macht, kann man möglicherweise schlussfolgern, dass sich die Bedeutung der Ehe dadurch verringert und eine Deinstitutionalisierung stattgefunden hat.
Um die aufgestellte These anhand einer Analyse zu bestätigen, soll im Folgenden der Begriff der Institutionalisierung nach Berger und Luckmann erläutert werden, anhand dessen dann die These begründet wird. Am Ende stellt das Ergebnis dar, dass sich die Anfangs genannte These bestätigen lässt, der Faktor der gestiegenen Erwerbstätigkeit der Frau jedoch nicht der einzige kausale Grund einer Deinstitutionalisierung der Ehe ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil I
- Hauptteil II
- Hauptteil III
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob veränderte Erwartungen an die Frau hinsichtlich der Erwerbstätigkeit zu einer Deinstitutionalisierung der Ehe geführt haben. Verglichen werden die 1960er und 2000er Jahre. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Ehe im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen.
- Veränderung der Erwartungen an Frauenrolle
- Entwicklung der Eheschließungs- und Scheidungsraten
- Der Begriff der Institutionalisierung nach Berger und Luckmann
- Deinstitutionalisierung der Ehe im Kontext gesellschaftlicher Modernisierung
- Zusammenhang zwischen Frauen-Erwerbstätigkeit und Ehe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage auf: Führen veränderte Erwartungen an die Frau hinsichtlich der Erwerbstätigkeit zu einer Deinstitutionalisierung der Ehe? Sie vergleicht die 1960er und 2000er Jahre und formuliert eine These: Gesellschaftliche Veränderungen nach 1960 führten zu größerer Unabhängigkeit der Frau und veränderten Erwartungen an ihre Rolle, was die Bedeutung der Ehe verringerte. Die Methodik wird kurz skizziert: Erläuterung des Begriffs Institutionalisierung nach Berger und Luckmann und anschließende Begründung der These.
Hauptteil I: Dieser Teil analysiert Daten zu Eheschließungen, Ehescheidungen und Erwerbstätigkeit von Frauen in den 1960er und 2000er Jahren. Die deutlich gesunkenen Eheschließungs- und gestiegenen Scheidungsraten werden präsentiert. Der Fokus liegt auf der veränderten Erwartungshaltung an Frauen: In den 1960er Jahren hatten Frauen aufgrund eingeschränkten Bildungs- und Berufszugangs eine starke Abhängigkeit vom Ehemann. Im Gegensatz dazu prägen in den 2000er Jahren Bildungsexpansion, Gleichstellung und Emanzipation das Bild einer unabhängigen, berufstätigen Frau.
Hauptteil II: Dieser Abschnitt erläutert den Begriff der (De-)Institutionalisierung nach Berger und Luckmann. Institutionalisierung wird als Prozess der Habitualisierung und wechselseitigen Typisierung von Handlungen beschrieben. Am Beispiel der Ehe wird gezeigt, wie feste Erwartungen und Normen entstehen und sanktioniert werden. Die Analyse zeigt, wie die Ehe in den 1960er Jahren als stark institutionalisierte Institution fungierte, in der von Frauen die Erfüllung traditioneller Rollenmuster erwartet wurde. Die Nichterfüllung führte zu gesellschaftlichen Sanktionen.
Hauptteil III: Dieser Teil analysiert den Wandel der Institution Ehe. Die hohe Scheidungsrate wird als Indiz für einen Bedeutungsverlust der Ehe interpretiert. Alternative Lebensformen wie nichteheliche Lebensgemeinschaften, berufstätige Mütter und Patchworkfamilien werden als Beispiele genannt. Der abnehmende materielle Nutzen von Kindern in wohlhabenden Gesellschaften und der Kulturwandel hin zu einer individualistischeren Lebenseinstellung werden als weitere Faktoren diskutiert. Es wird festgehalten, dass die Emanzipation der Frau und ihre berufliche Selbstverwirklichung zu einer Deinstitutionalisierung der Ehe beitragen.
Schlüsselwörter
Deinstitutionalisierung der Ehe, Frauenrolle, Erwerbstätigkeit, Institutionalisierung (Berger/Luckmann), Gesellschaftlicher Wandel, 1960er Jahre, 2000er Jahre, Eheschließungen, Ehescheidungen, Emanzipation, Gleichberechtigung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deinstitutionalisierung der Ehe
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen veränderten Erwartungen an die Frauenrolle hinsichtlich der Erwerbstätigkeit und der Deinstitutionalisierung der Ehe. Sie vergleicht die 1960er und 2000er Jahre und analysiert die Entwicklung der Ehe im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Führen veränderte Erwartungen an die Frau hinsichtlich der Erwerbstätigkeit zu einer Deinstitutionalisierung der Ehe?
Welche Zeiträume werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die 1960er und 2000er Jahre, um die Veränderungen in den Erwartungen an Frauen und die Entwicklung der Ehe aufzuzeigen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Veränderung der Erwartungen an die Frauenrolle, Entwicklung der Eheschließungs- und Scheidungsraten, der Begriff der Institutionalisierung nach Berger und Luckmann, Deinstitutionalisierung der Ehe im Kontext gesellschaftlicher Modernisierung und der Zusammenhang zwischen Frauen-Erwerbstätigkeit und Ehe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptteile und einen Schluss mit Schlüsselbegriffen. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die These vor. Hauptteil I analysiert Daten zu Eheschließungen, Scheidungen und Frauen-Erwerbstätigkeit. Hauptteil II erläutert den Begriff der Institutionalisierung nach Berger und Luckmann. Hauptteil III analysiert den Wandel der Institution Ehe und die Faktoren, die dazu beitragen.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Analyse von Daten zu Eheschließungen, Scheidungen und Frauen-Erwerbstätigkeit. Der theoretische Rahmen wird durch den Begriff der Institutionalisierung nach Berger und Luckmann gebildet.
Welche These wird aufgestellt?
Die Arbeit vertritt die These, dass gesellschaftliche Veränderungen nach 1960 zu größerer Unabhängigkeit der Frau und veränderten Erwartungen an ihre Rolle führten, was die Bedeutung der Ehe verringerte.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Emanzipation der Frau und ihre berufliche Selbstverwirklichung zu einer Deinstitutionalisierung der Ehe beitragen. Die hohe Scheidungsrate wird als Indiz für einen Bedeutungsverlust der Ehe interpretiert. Weitere Faktoren wie alternative Lebensformen und der Kulturwandel werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Deinstitutionalisierung der Ehe, Frauenrolle, Erwerbstätigkeit, Institutionalisierung (Berger/Luckmann), gesellschaftlicher Wandel, 1960er Jahre, 2000er Jahre, Eheschließungen, Ehescheidungen, Emanzipation, Gleichberechtigung.
- Arbeit zitieren
- Lisa Wegel (Autor:in), 2022, Führen die veränderten Erwartungen an die Frau hinsichtlich der Erwerbstätigkeit zu einer Deinstitutionalisierung der Ehe?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1326229