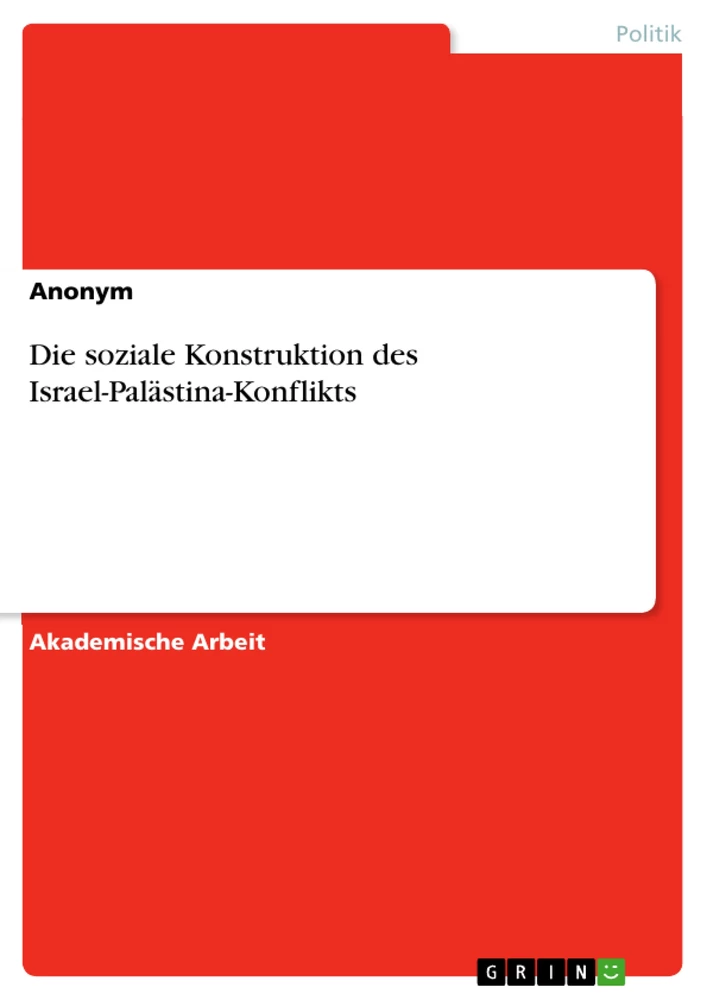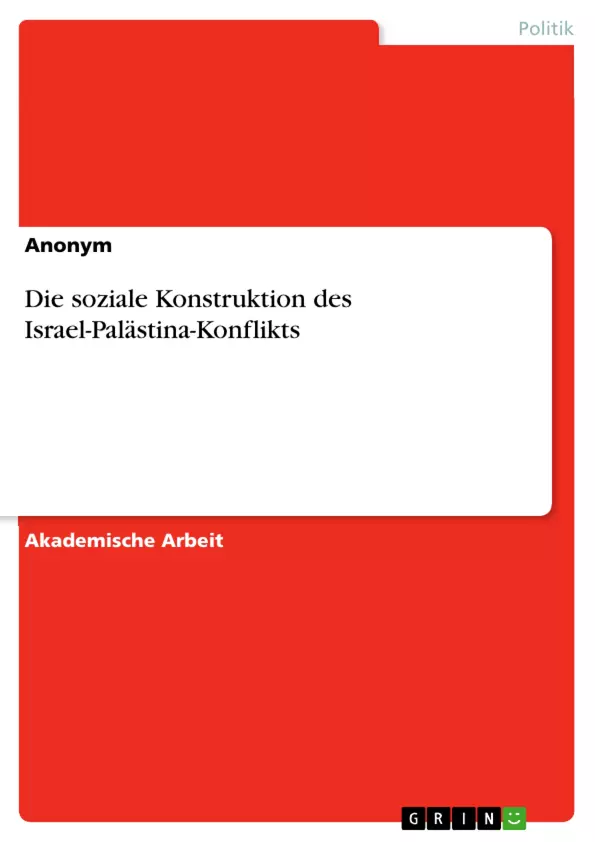Im Nahostkonflikt gibt es Situationen, die von palästinensischer und israelischer Seite jeweils eigene Interpretationen erhalten. Meine These in der vorliegenden Arbeit ist daher, dass diese beiden Parteien unterschiedliche Auslegungen verschiedener Tatsachen nutzen, um die eigene Bevölkerung zu geschlossenem Auftreten gegen den gemeinsamen Gegner zu bewegen, eigene Standpunkte zu legitimieren und dem Kontrahenten gleichzeitig die Rechtfertigung für seine Ansprüche und Handlungen zu nehmen. Da es sich um einen räumlich sehr konzentrierten Konflikt handelt, in dem beide Seiten als Ziel die Gründung eines eignen Staates auf teils ein und demselben Gebiet verfolgen, wird die Legitimation von territorialem Anspruch im Vordergrund stehen. Als theoretisches Modell für meine Untersuchung wird der Konstruktivismus dienen, welcher sich als einer der wenigen Ansätze in der IB Forschung mit den verschiedenen Interpretationen der Wirklichkeit beschäftigt.
Hierzu wird Gert Krells Standardwerk "Weltbilder und Weltordnung" mein zentrales Bezugswerk sein, um im ersten Kapitel die theoretischen Grundlagen des Konstruktivismus zu erläutern. Zusätzlich wird hier auf die Konstruktion von staatlichen Interessen nach Alexander Wendt eingegangen. Anschließend wird dem Leser die Bedeutung der Sprache in dessen Ansatz des Konstruktivismus näher gebracht. Da für die Untersuchung des Nahostkonflikts im Hinblick auf die Interpretation der Wirklichkeit Identitäten eine unverzichtbare Rolle spielen, wird deren Rolle in einem Konflikt ebenfalls erläutert. Im zweiten Teil der Arbeit wird die gewonnene theoretische Basis auf den Israel-Palästina-Konflikt angewendet. Zur Überprüfung meiner These werden für die palästinensische Seite die Palästinensische Nationalcharta (1968) und die Unabhängigkeitserklärung (1988), und auf israelischer Seite die Erklärung zur Staatsgründung von 1948 darauf hin überprüft, wie sie die Wirklichkeit zur Beeinflussung des Konfliktes konstruieren und welchen Einfluss die Konstruktionen der beiden Seiten auf eine Lösbarkeit des Konflikts haben. Im letzten Abschnitt werden abschließend Ansätze präsentiert, die zu einer Lösung des Konflikts beitragen können.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung und Vorstellung der These
- B. Theoretische Rahmenstruktur: Der Konstruktivismus
- I. Grundlagen des Konstruktivismus
- II. Die Rolle der Sprache im Konstruktivismus nach Nicholas Onuf
- III. Das,Selbst' und die,Anderen' - Identität und Narrative im Konstruktivismus
- C. Die soziale Konstruktion des Israel-Palästina-Konflikts
- I. Israelische und palästinensische Meta-Narrative
- 1. Konstruktion der israelischen Identität in der Staatsgründungserklärung von 1948
- 2. Konstruktion der palästinensischen Identität: Die Palästinensische Nationalcharta 1968 und die Unabhängigkeitserklärung 1988
- II. Israelische und palästinensische Meta-Narrative im Vergleich
- III. Maßnahmen zur Deeskalation des Identitätskonflikts
- I. Israelische und palästinensische Meta-Narrative
- D. Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Israel-Palästina-Konflikt durch die Linse des Konstruktivismus, um aufzuzeigen, wie die beiden Seiten die Wirklichkeit interpretieren und konstruieren, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen und den Konflikt zu ihrem Vorteil zu beeinflussen.
- Die Rolle des Konstruktivismus in der Analyse internationaler Konflikte
- Die Konstruktion von Identitäten im Israel-Palästina-Konflikt
- Die Bedeutung von Narrativen und Meta-Narrativen für die Konfliktdynamik
- Die Analyse der Staatsgründungserklärung Israels und der palästinensischen Nationalcharta
- Möglichkeiten zur Deeskalation des Konflikts und zur Förderung von Frieden
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung und Vorstellung der These
Die Einleitung führt in das Thema des Israel-Palästina-Konflikts ein und stellt die These vor, dass beide Seiten die Wirklichkeit unterschiedlich interpretieren, um ihre eigene Bevölkerung zu mobilisieren und die Legitimität ihrer Forderungen zu stärken.
B. Theoretische Rahmenstruktur: Der Konstruktivismus
Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Konstruktivismus und diskutiert die Rolle von Ideen, Sprache und Identität in der Konstruktion der internationalen Wirklichkeit.
C. Die soziale Konstruktion des Israel-Palästina-Konflikts
Dieses Kapitel untersucht die israelischen und palästinensischen Meta-Narrative und analysiert, wie diese die Wirklichkeit konstruieren und die Konfliktdynamik beeinflussen.
Schlüsselwörter
Konstruktivismus, Israel-Palästina-Konflikt, Identität, Narrative, Meta-Narrative, Staatsgründungserklärung, Palästinensische Nationalcharta, Deeskalation, Frieden.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Die soziale Konstruktion des Israel-Palästina-Konflikts, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1320776