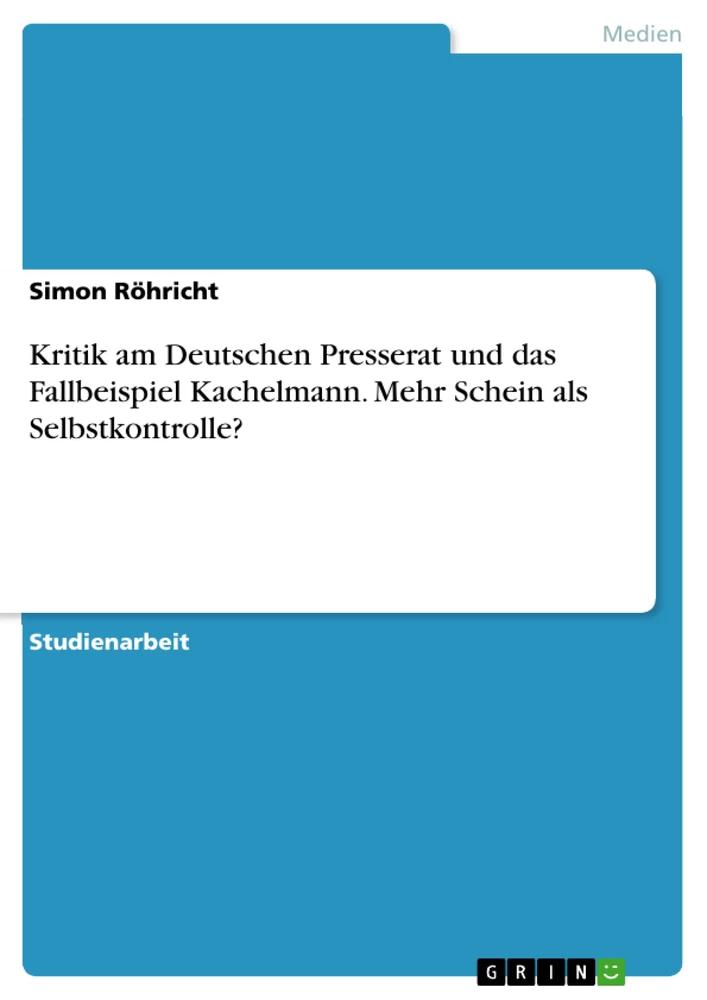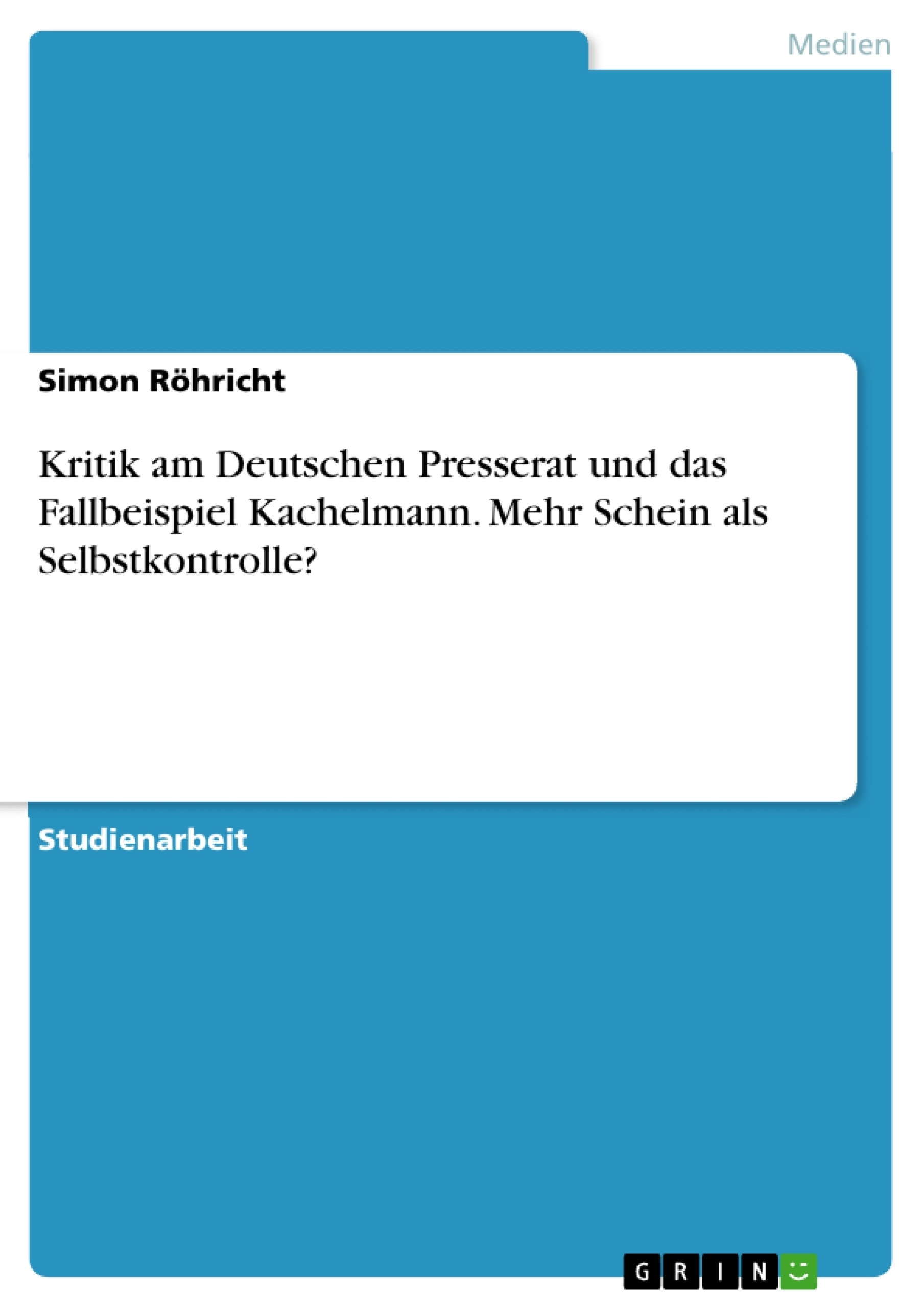Bei der Arbeit handelt es sich um eine kritische Auseinandersetzung mit der Effektivität des Deutschen Presserates. Zu Beginn wird ein Überblick zur Funktionsweise des Deutschen Presserates und seinen Sanktionsmöglichkeiten geliefert. Dann werden die häufigsten Kritikpunkte am Gremium von Wissenschaftlern und Journalisten zusammengetragen.
Es folgt eine Auseinandersetzung mit dem Fall Kachelmann (mit Fokus auf der medialen Auseinandersetzung mit dem Fall), der als prominentes Negativbeispiel für die Funktionsweise des Presserates genutzt werden kann.
Der deutsche Presserat regelt seit 1952 die Selbstkontrolle des deutschen Pressewesens. Seit seiner Entstehung ist der deutsche Presserat häufig öffentlicher Kritik ausgesetzt, da diverse Defizite in der Struktur und Arbeitsweise des Gremiums gesehen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der deutsche Presserat
- 2.1 Medienethische Einordnung: Medienselbstkontrolle
- 2.2 Eine knappe Historie des deutschen Presserates
- 2.3 Struktur und Arbeitsweise
- 3 Kritik am deutschen Presserat
- 3.1 Reaktion statt Initiative
- 3.2 ,,Zahnloser Tiger“
- 3.3 Mangel an Öffentlichkeit
- 4. Fallbeispiel: der Kachelmann-Prozess
- 4.1 Fehlverhalten der Medien
- 4.2 Reaktion des Presserates
- 5. Diskussion: Mögliche Reformen
- 6.Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Kritik am deutschen Presserat und untersucht die Defizite in seiner Struktur und Arbeitsweise. Der Fokus liegt dabei auf der mangelnden Wirksamkeit des Gremiums im Kontext der Medienselbstkontrolle, insbesondere anhand des Fallbeispiels Kachelmann-Prozess.
- Medienselbstkontrolle und ihre ethische Grundlage
- Die Geschichte und Struktur des deutschen Presserates
- Kritikpunkte am deutschen Presserat
- Der Kachelmann-Prozess als Fallbeispiel für mediales Fehlverhalten
- Diskussion möglicher Reformen des Presserates
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Kritik am deutschen Presserat und stellt das Fallbeispiel Kachelmann-Prozess als zentralen Gegenstand der Arbeit vor. Kapitel 2 liefert eine medienethische Einordnung des Begriffs Medienselbstkontrolle und präsentiert einen kurzen Überblick über die Entstehung und Funktionsweise des Presserates. Kapitel 3 beleuchtet die Kritik am Presserat, indem es die Punkte Reaktion statt Initiative, ,,Zahnloser Tiger“ und mangelnde Öffentlichkeit behandelt. Kapitel 4 analysiert den Kachelmann-Prozess, wobei der Fokus auf dem medialen Fehlverhalten und der Reaktion des Presserates liegt.
Schlüsselwörter
Medienselbstkontrolle, Presserat, Kritik, Medienethik, Kachelmann-Prozess, Fehlverhalten, Reformen, Pressefreiheit, Öffentlichkeit.
- Quote paper
- Simon Röhricht (Author), 2022, Kritik am Deutschen Presserat und das Fallbeispiel Kachelmann. Mehr Schein als Selbstkontrolle?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1311282