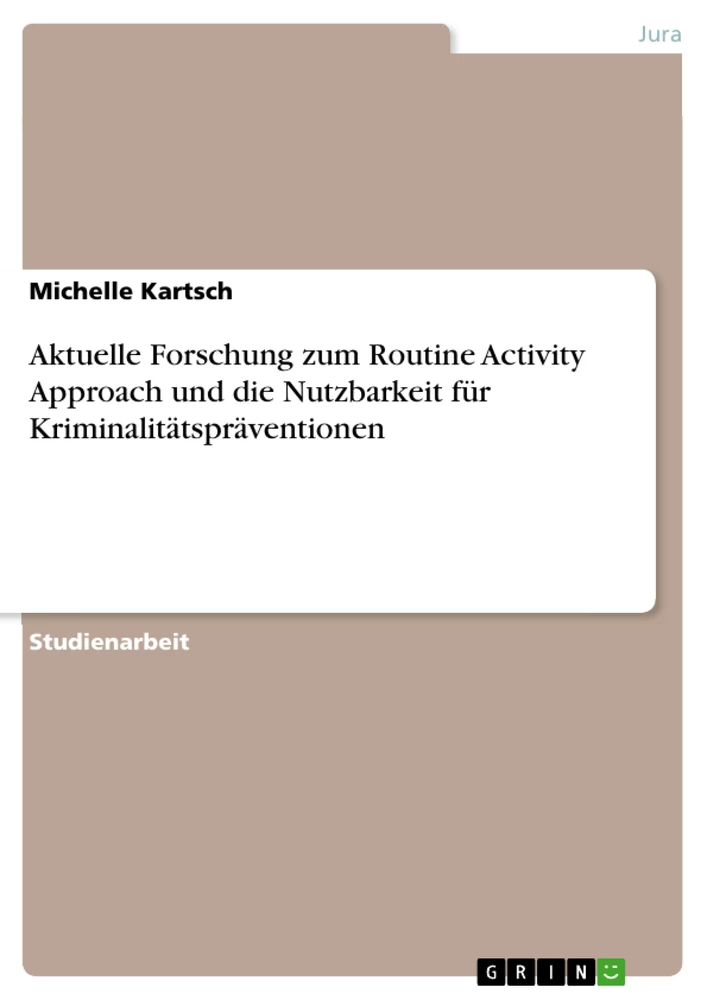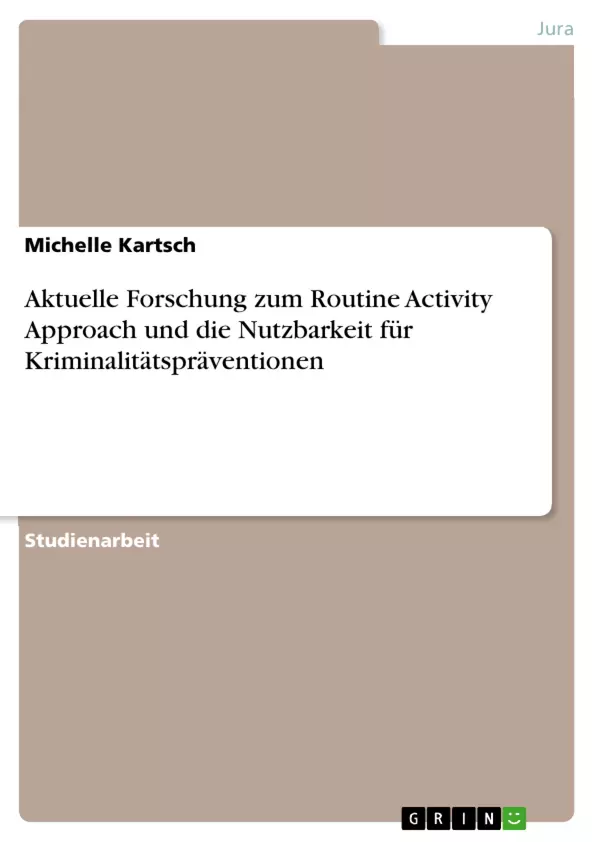Die Tatsituation als Ansatzpunkt hat zur Erklärung von abweichendem Verhalten durch die traditionellen Kriminalitätstheorien lange Zeit keine Beachtung erhalten. Es dominierte eine täterbezogene Sicht. Daher wirkte der durch Cohen und Felson entwickelte Ansatz revolutionär, stellte dieser doch erstmalig die Tatgelegenheiten und nicht die Täterpersönlichkeit in den Fokus. Gegenstand dieser Arbeit ist der auf Grundlage dessen entstandenen Routine Activity Approach zum einen und die dazu betriebene Forschung zum anderen. Ziel ist es, die empirische Überprüfbarkeit herauszufiltern und damit ihre Nutzbarkeit für Kriminalitätspräventionen abzuleiten. Schwerpunkt dieser ist die Darstellung des aktuellen Forschungsstands, wobei im Rahmen dieser Arbeit ein Ausschnitt dargestellt wird.
Der Forschungsstandort Nordamerika bietet derzeit die umfangreichste Studienanzahl. Die empirischen Erkenntnisse können jedoch unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Unterschiede in ihren Grundzügen ebenfalls auf die europäische Gesellschaft übertragen werden. In der vorliegenden Arbeit wird zuerst die Theorie dargelegt. Es folgt eine Präsentation der veröffentlichten Studien, um die empirische Überprüfbarkeit des Ansatzes aufzuzeigen. Zunächst wird die Entstehung des Ansatzes kurz skizziert. Daran anknüpfend werden die drei wichtigsten Kernelemente der Theorie wiedergegeben. Im Folgenden wird die Bedeutung der Routineaktivitäten für der Routine Activity Approach zusammengefasst. Anschließend wird der aktuelle Forschungsstand aufgeteilt auf einzelne Delikte und Risikogruppen für Viktimisierung vorgestellt. Abschließend folgt ein Fazit und eine kritische Stellungnahme.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Routine Activity Approach
- I. Kernelemente
- II. Routineaktivitäten
- III. Mikro-Makro-Modell
- C. Aktuelle Forschung
- I. Eigentumskriminalität
- 1. Allgemein
- 2. Bezugspunkt Europa
- II. Stalking
- III. Amokläufe
- IV. Organisierte Kriminalität
- V. Vergewaltigung
- VI. Sonstige Delikte
- VII. Individuell abweichendes Verhalten
- VIII. Behinderung als Risikofaktor
- I. Eigentumskriminalität
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Routine Activity Approach (RAA) und seine Anwendung in der aktuellen kriminologischen Forschung. Ziel ist es, die Kernelemente des RAA zu erläutern und dessen Relevanz für das Verständnis verschiedener Kriminalitätsformen aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, wie der RAA in empirischen Studien eingesetzt wird und welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden können.
- Kernelemente des Routine Activity Approach
- Anwendung des RAA auf verschiedene Kriminalitätsformen
- Analyse aktueller empirischer Forschungsergebnisse zum RAA
- Stärken und Schwächen des RAA
- Potenzial des RAA für Kriminalprävention
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des Routine Activity Approach (RAA) in der Kriminologie. Sie beschreibt den Forschungsstand und die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, aktuelle Forschungsergebnisse zum RAA zu analysieren und dessen Anwendbarkeit auf verschiedene Kriminalitätsphänomene zu untersuchen. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über die behandelten Themen.
B. Routine Activity Approach: Dieses Kapitel erklärt die zentralen Elemente des Routine Activity Approach (RAA), ein bedeutendes kriminologisches Modell zur Erklärung von Kriminalität. Es beschreibt die drei Kernelemente: motivierte Täter, geeignete Ziele und das Fehlen geeigneter Schutzmaßnahmen. Des Weiteren werden die verschiedenen Routineaktivitäten von Tätern und Opfern analysiert und das Mikro-Makro-Modell des RAA erläutert, welches die Wechselwirkungen zwischen individuellen Handlungen und gesellschaftlichen Strukturen verdeutlicht. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der aktuellen Forschung im Folgeabschnitt.
C. Aktuelle Forschung: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Übersicht über aktuelle Forschungsergebnisse, die den Routine Activity Approach (RAA) zur Erklärung verschiedener Kriminalitätsformen anwenden. Es werden Studien zu Eigentumskriminalität (einschließlich Wohnungseinbruchsdiebstahl mit europäischem Fokus), Stalking, Amokläufen, organisierter Kriminalität, Vergewaltigung, sonstigen Delikten, individuell abweichendem Verhalten und Behinderung als Risikofaktor vorgestellt. Jede Untersektion analysiert die Anwendung des RAA auf den jeweiligen Deliktbereich, beleuchtet die Ergebnisse der Studien und diskutiert deren Implikationen für die Kriminalprävention und -forschung. Die Kapitel zeigen die breite Anwendbarkeit des RAA und seine Bedeutung für das Verständnis unterschiedlicher Kriminalitätsphänomene auf.
Schlüsselwörter
Routine Activity Approach, Kriminologie, Kriminalität, Kriminalitätsforschung, Kriminalprävention, Eigentumskriminalität, Stalking, Amokläufe, organisierte Kriminalität, Vergewaltigung, Risikofaktoren, empirische Forschung, Präventionsstrategien, Motiv, Gelegenheit, Schutz.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Routine Activity Approach und aktuelle kriminologische Forschung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über den Routine Activity Approach (RAA) in der Kriminologie. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Erklärung des RAA, seiner Anwendung in der aktuellen Forschung und der Analyse verschiedener Kriminalitätsformen unter diesem Ansatz.
Was ist der Routine Activity Approach (RAA)?
Der RAA ist ein kriminologisches Modell zur Erklärung von Kriminalität. Er basiert auf drei Kernelementen: einem motivierten Täter, einem geeigneten Ziel und dem Fehlen geeigneter Schutzmaßnahmen. Das Dokument erklärt diese Elemente detailliert und beschreibt auch das Mikro-Makro-Modell, das die Interaktion zwischen individuellen Handlungen und gesellschaftlichen Strukturen beleuchtet.
Welche Kriminalitätsformen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt eine breite Palette von Kriminalitätsformen unter dem Blickwinkel des RAA. Dazu gehören Eigentumskriminalität (mit besonderem Fokus auf Wohnungseinbruchsdiebstahl in Europa), Stalking, Amokläufe, organisierte Kriminalität, Vergewaltigung, sonstige Delikte, individuell abweichendes Verhalten und Behinderung als Risikofaktor.
Wie wird der RAA in der aktuellen Forschung angewendet?
Das Dokument analysiert aktuelle empirische Forschungsergebnisse, die den RAA zur Erklärung der oben genannten Kriminalitätsformen verwenden. Es präsentiert die Ergebnisse dieser Studien und diskutiert deren Implikationen für die Kriminalprävention und -forschung. Die Analyse zeigt die breite Anwendbarkeit des RAA und seine Bedeutung für das Verständnis verschiedener Kriminalitätsphänomene auf.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die Kernelemente des RAA zu erläutern und dessen Relevanz für das Verständnis verschiedener Kriminalitätsformen aufzuzeigen. Es analysiert, wie der RAA in empirischen Studien eingesetzt wird und welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden können. Zusätzlich werden Stärken und Schwächen des RAA sowie dessen Potenzial für die Kriminalprävention diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Routine Activity Approach, Kriminologie, Kriminalität, Kriminalitätsforschung, Kriminalprävention, Eigentumskriminalität, Stalking, Amokläufe, organisierte Kriminalität, Vergewaltigung, Risikofaktoren, empirische Forschung, Präventionsstrategien, Motiv, Gelegenheit, Schutz.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, eine detaillierte Erklärung des Routine Activity Approach, eine umfassende Übersicht über aktuelle Forschungsergebnisse zur Anwendung des RAA auf verschiedene Kriminalitätsformen, und abschließend ein Fazit. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung seiner Inhalte.
- Quote paper
- Michelle Kartsch (Author), 2021, Aktuelle Forschung zum Routine Activity Approach und die Nutzbarkeit für Kriminalitätspräventionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1309514