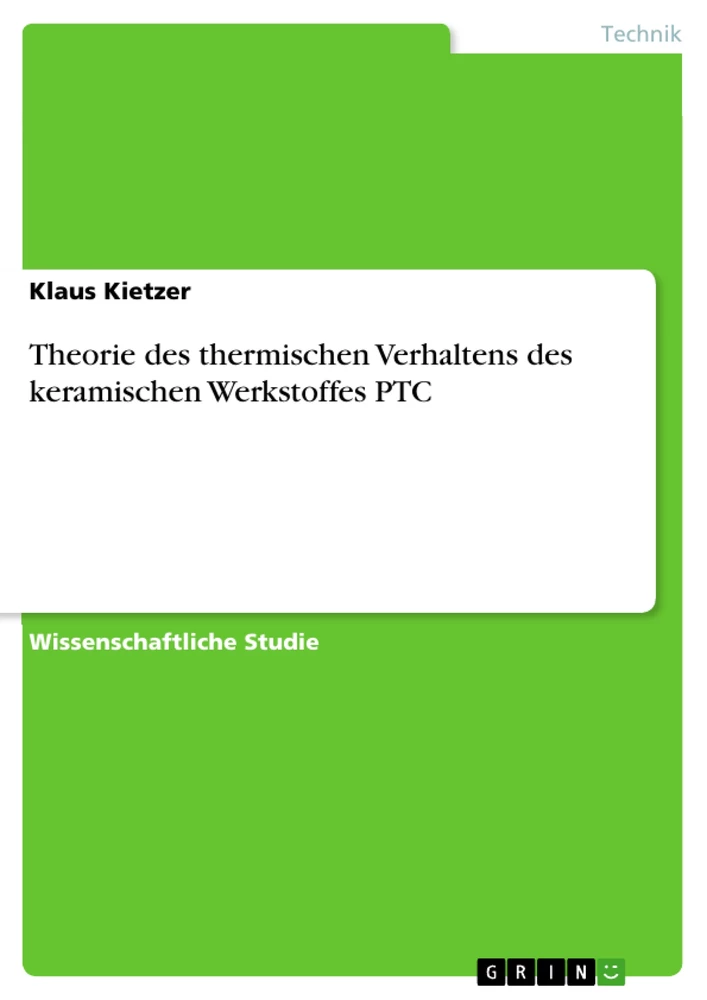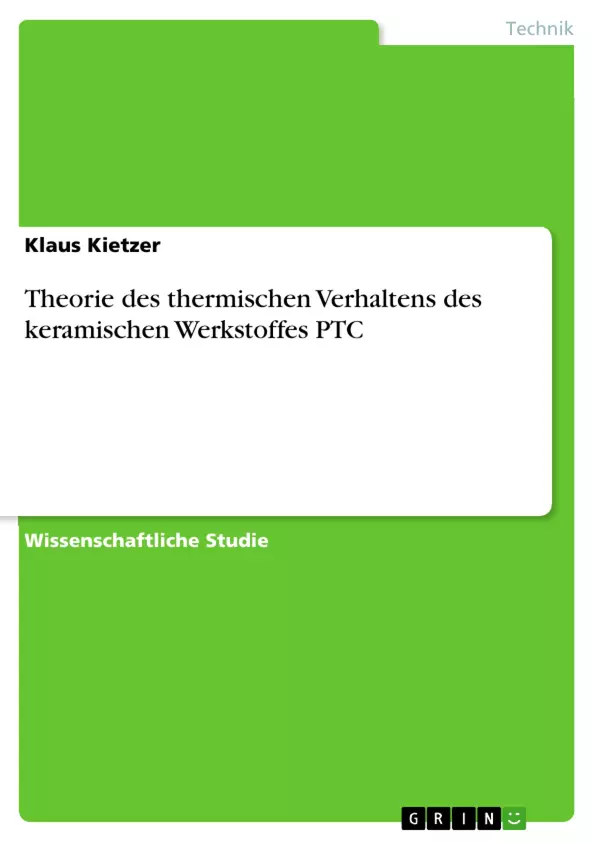Der keramische Werkstoff PTC weist spezielle Eigenschaften auf, die ihn für elektrische Heizungen in Automobilen sowohl in Niedervolt- als auch in Hochvoltanlagen prädestinieren. Bei bestimmten Temperaturen (Curie-Temperatur) regelt sich der elektrische Strom selbsttätig ab, was insbesondere in Hochvoltanlagen einen Sicherheitsfaktor bedeutet. Andererseits kann der lineare Niedervolt-PTC nicht wegen der freiliegenden Pole ohne einen Berührungsschutz als Hochvolt-PTC-Heizer betrieben werden. In einer Heizungsanlage bilden der PTC-Stab als Wärmeerzeuger (Heizquelle) und der Wärmetauscher als Übergabestelle an das Heizmedium (Senke) voneinander abhängige Einheiten, die einen stationären Heizprozess gestalten. Die Wärmeerzeugung in der Quelle ist ein instationärer Vorgang: Jedes Watt der elektrischen Leistung generiert pro Sekunde ein Joule Wärmemenge, die kontinuierlich und zeitgleich in der Senke abgeführt werden muss. Zwischen der Wärmeerzeugung und Wärmeübertragung besteht die Dualität, dass die Ergiebigkeit der Senke permanent mit der Ergiebigkeit der Quelle korrespondieren muss. An der Nahtstelle zwischen Quelle und Senke beeinflussen unterschiedliche Materialien die Wärmeleitung, die als Störquellen auf den stationären Heizvorgang wirksam sind.
Im Automobilbau hat sich der lineare Niedervolt-PTC-Heizer etabliert, der für Hochvolt-PTC-Heizungen einer Modifikation bedarf. Als Isolation gegen die Hochspannung ist eine Kunststoffummantelung um die Pole vorgesehen. Es gilt die allgemeine Erkenntnis, dass eine gute elektrische Isolationsschicht eine schlechte Wärmeleitung verursacht, [3]. Ein Alternativvorschlag zu dem linearen PTC-Heizer ist der konzentrische oder quadratische Heizstab, bei dem der hochvoltführende Pluspol von dem Minuspol eingekapselt ist. In beiden Versionen ist das gleiche Problem verborgen, dass unterschiedliche Materialien die Wärmeleitung beeinträchtigen.
Die Gestaltung des Hochvolt-PTC-Heizers für die praktische Nutzanwendung im Automobilbau wird von den Anforderungen an die äußeren Abmessungen, die Wärmeleistung und die Curie-Temperatur bestimmt. In der vorgelegten Abhandlung wird ein mathematisches Modell entwickelt, das die Wärmeerzeugung in der Quelle und die Wärmeleitung zur Senke abbildet, um auf theoretische Weise Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für einen praktikablen Einsatz im Automobilbau zu gewinnen.
1. Einleitung
Der keramische Werkstoff PTC weist spezielle Eigenschaften auf, die ihn für elektrische Heizungen in Automobilen sowohl in Niedervolt- als auch in Hochvoltanlagen prädestinieren. Bei bestimmten Temperaturen (Curie-Temperatur) regelt sich der elektrische Strom selbsttätig ab, was insbesondere in Hochvoltanlagen einen Sicherheitsfaktor bedeutet. Andererseits kann der lineare Niedervolt-PTC nicht wegen der freiliegenden Pole ohne einen Berührungsschutz als Hochvolt-PTC-Heizer betrieben werden. In einer Heizungsanlage bilden der PTC-Stab als Wärmeerzeuger (Heizquelle) und der Wärmetauscher als Übergabestelle an das Heizmedium (Senke) voneinander abhängige Einheiten, die einen stationären Heizprozess gestalten. Die Wärmeerzeugung in der Quelle ist ein instationärer Vorgang: Jedes Watt der elektrischen Leistung generiert pro Sekunde ein Joule Wärmemenge, die kontinuierlich und zeitgleich in der Senke abgeführt werden muss. Zwischen der Wärmeerzeugung und Wärmeübertragung besteht die Dualität, dass die Ergiebigkeit der Senke permanent mit der Ergiebigkeit der Quelle korrespondieren muss.. An der Nahtstelle zwischen Quelle und Senke beeinflussen unterschiedliche Materialien die Wärmeleitung, die als Störquellen auf den stationären Heizvorgang wirksam sind.
Im Automobilbau hat sich der lineare Niedervolt-PTC-Heizer etabliert, der für Hochvolt-PTC-Heizungen einer Modifikation bedarf. Als Isolation gegen die Hochspannung ist eine Kunststoffummantelung um die Pole vorgesehen. Es gilt die allgemeine Erkenntnis, dass eine gute elektrische Isolationsschicht eine schlechte Wärmeleitung verursacht, 3. Ein Alternativvorschlag zu dem linearen PTC-Heizer ist der konzentrische oder quadratische Heizstab, bei dem der hochvoltführende Pluspol von dem Minuspol eingekapselt ist. In beiden Versionen ist das gleiche Problem verborgen, dass unterschiedliche Materialien die Wärmeleitung beeinträchtigen.
Die Gestaltung des Hochvolt-PTC-Heizers für die praktische Nutzanwendung im Automobilbau wird von den Anforderungen an die äußeren Abmessungen, die Wärmeleistung und die Curie-Temperatur bestimmt. In der vorgelegten Abhandlung wird ein mathematisches Modell entwickelt, das die Wärmeerzeugung in der Quelle und die Wärmeleitung zur Senke abbildet, um auf theoretische Weise Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für einen praktikablen Einsatz im Automobilbau zu gewinnen.
2. Analoge Potentialfeldtheorie
Die PTC-Heizelemente sind stabartig mit prismatischer Grundfläche ausgebildet, die als ebene Scheiben in Einheitsdicke zu Stäben beliebiger Länge aufeinander aufgereiht werden können. PTC-Steine werden aus einem keramischen Gemisch verschiedener Komponenten in Formen gepresst und gesintert. Für die Herleitung eines mathematischen Modells wird angenommen, dass die PTC-Partikel gleichmäßig und homogen verteilt sind und in den ebenen Querschnitten auf diese Weise einem quasi-isotropen Feldträger entsprechen. Isotrope Feldträger gehören zu der Familie der Potentialfunktionen, die dem Laplaceschen Differentialoperator genügen und eindeutig durch die Randbedingungen bestimmt werden. Aus dieser Überlegung gefolgert wird die These formuliert, dass der keramische Werkstoff PTC der Potentialtheorie zugeordnet werden kann. Die Übereinstimmung des mathematischen Modells mit dem Verhalten des PTC-Heizers ist von der Richtigkeit der getroffenen Annahmen bestimmt.
Im Bild 1 sind die prismatischen Querschnitte des linearen und quadratischen PTC-Heizers dargestellt. Der Vergleich mit dem Modell im Bild 2 demonstriert anschaulich den Unterschied im inneren Aufbau der beiden Querschnittsformen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1: Modell des linearen und quadratischen PTC
Bei den potentialtheoretischen Problemen hat die streng mathematische Theorie der komplexen Funktionen mit der konformen Abbildung bei der Tragflügeltheorie, der Torsion prismatischer Stäbe, der Festigkeit ebener Randwertprobleme und anderer Problemstellungen erfolgreich Lösungen erzielt. Eine andere Vorgehensart ist die Potentialanalogie, (von Prof. Betz 2 als „ingenieurmäßig“ bezeichnet), eine probate wissenschaftlich, logisch-anschauliche Methode , mit deren Hilfe Aussagen aus bekannten analogen Lösungen gewonnen werden, 1.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 2: Modell des linearen und quadratischen PTC
3. Analoge Beziehungen des linearen und quadratischen PTC-Elementes der Potentialströmung
Bei der ebenen Potentialströmung ist die Divergenz der Stromlinie laminar und wirbelfrei. Das Strömungsfeld bildet die Vorgänge der Wärmeerzeugung des PTC analog ab, wenn die Konturen anlog gestaltet sind. In folgenden Abschnitten werden die analogen Modelle entwickelt.
3.1 Das analoge Modell für das quadratischen PTC-Element
Über einen oben offenen Kegelstumpf wird durch die zentrale Öffnung ein Wasserstrom eingeleitet, der sich über die obere Öffnung laminar und wirbelfrei über die Mantelfläche ausbreitet und über den unteren Rand abfließt. Der Antrieb für den Wasserfluss ist das Erdpotential, das linear mit der Höhe abnimmt. Über die Sektoren der Mantelflächen breitet sich der Wasserstrom gleichmäßig aus und nimmt dabei ebenfalls mit r ab. (Bild 3)
Das Modell im Bild 3 könnte ein Zierbrunnen in einer Parkanlage sein, Es zeigt, wie das Verhalten der Antriebskräfte der Potentialströmung des Wasserfilmes die Wärmeerzeugung durch den elektrischen Strom im PTC analog Verhalten wiedergibt. Aus dieser Überlegung lassen sich die Beziehungen (1) und (2) anschaulich herleiten.
Im PTC entsprechen sich analog die Spannung U dem Erdpotential h und der Strom I pro Länge l dem Wasserfluss über das Segment 𝝋 am Innenring.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 3: Analoges Modell des quadratischen PTC
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2 Das analoge Modell für das lineare PTC-Elementes
Im Bild 4 ist ein dem linearen PTC angepasstes Modell der Potentialströmung dargestellt. Es handelt sich um eine Wasserwand, über deren Oberkante Wasser so eingeleitet wird, dass sich ein laminarer, wirbelfreier Wasserfilm ausbildet. Die Stromlinien verlaufen linear über die ganze Wandbreite. Der Antrieb für die Strömung ist das Erdpotential, und der Strom ist konstant über die Wasserwand verteilt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 4: Analoges Modell des linearen PTC
Die analogen Größen sind demzufolge die elektrische Spannung U, die linear bis zum Minuspol abnimmt, während der elektrische Teilstrom über die Polbreite b konstant verläuft. Daraus ergeben sich die analogen Beziehungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Das mathematische Modell der Wärmeerzeugung des quadratischen PTC-Heizers
Zunächst wird eine Beziehung zur Bestimmung von f in Gl. (3) unter der Annahme entwickelt, dass die örtlichen Leistungsanteile q(r,𝝋,z) isotrop über den gesamten PCT verteilt und homogen innerhalb des Keramikkörpers angeordnet sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nunmehr kann eine Beziehung entwickelt werden, die die Energieverteilung (r,𝝋,𝛿) innerhalb der ebenen Schicht mit der Dicke 𝛿 beschreibt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gl. (16) stellt die Energieverteilung in der Ebene (r,𝝋,𝛿) dar, die im Bild 5 grafisch dargestellt ist. Im Pluspol bei r = beträgt die elektrische Leistung /l, die über r am Minuspol bei r = insgesamt in Wärme umgesetzt wird. Die Zwischenstufen des Aufheizprozesses zeigen die Linien in Bild 5.
Außerdem ist dem Diagramm zu entnehmen, dass der Vorgang der Wärmeerzeugung instationär verläuft, das heißt, die Umsetzung der elektrischen Energie bewirkt eine ständig steigende Wärmemenge gemäß der Beziehung 1 W = 1 J/s.
Wesentlich ist auch noch die Tatsache, dass das Wärmefeld eine permanente Umverteilung der Temperatur bewirkt. Die Umverteilung ist von dem Gradienten des Wärmefeldes abhängig und verläuft stets vom höheren zum niedrigeren Temperaturniveau.
Im Abschnitt 5 wird die Umverteilung des Wärmefeldes als zweiter Teil des mathematischen Modells behandelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 5: Erzeugter Wärmestrom im quadratischen PTC
5. Wärmeleitung durch den PTC-Stab vom Plus zum Minuspol
Die ursächliche Überlegung zur Entwicklung eines quadratischen Hochvolt-PTC-Elementes ist, dass der hochspannungsführende Pluspol komplett vom Minuspol eingekapselt ist und ungekühlt bleibt. Daraus folgt, dass das innerhalb des PTC generierte Wärmeenergiefeld durch Wärmeleitung zum Minuspol abgeführt werden muss. Die Wärmeleitung durch den PTC wird durch die Beziehung von Fourier
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Bild 7 ist der Querschnitt in Dicke 𝛿 des linearen PTC, bestehend aus den beiden Polen mit die Breite b und dem eingeschlossenen PTC-Stein der Dicke s dargestellt
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 7: Querschnitt des linearen PTC
Im Abschnitt 3.2 wurde das Analogieverfahren für Potentialfunktionen beim quadratischen PTC erfolgreich angewendet. Die gleiche Methode führt zu den analogen Beziehungen des linearen PTC
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zur Anpassung des Ansatzes an die Randbedingungen wird eine Integration über die Querschnittsfläche ausgeführt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Bild 8 ist die Gleichung (31) grafisch dargestellt. Sie zeigt die Verteilung des Wärmefeldes innerhalb des PTC. Die grünen Linien zeigen in 4 Schritten die Erzeugung der Wärmemenge in Joule, bis die komplette Leistung im gesamten PTC umgesetzt ist, (rote Linie). Es ist ganz deutlich der wärmere Pluspol zu erkennen, so dass sofort der Temperatur-Gradient eine Umverteilung der Temperatur in Richtung Minuspol eingeleitet wird. Im folgendem wird die Umverteilung dargelegt.
Die Umverteilung der Temperatur durch Wärmeleitung vom Plus- zum Minuspol beschreibt das Gesetz von Fourier
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Gleichung (37) liefert das unvermutete Ergebnis, dass die ungleiche Wärmeerzeugung keinen Temperaturunterschied an den Polen theoretisch aufweist. Die mit der Wärmerzeugung synchron verlaufende Temperaturumverteilung vom Plus- zum Minuspol gleicht den Unterschied permanent aus, was auch im Versuch verifiziert wurde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 8: Erzeugter Wärmestrom im linearen PTC
6. Theoretische Schlussfolgerungen für die Projektierung von Hochvolt-PTC-Heizern
Für den linearen und quadratischen PTC-Heizer wurde ein mathematisches Modell entwickelt, dass die Erzeugung des Wärmefeldes und das daraus resultierende Temperaturfeld in Abhängigkeit von den Hauptabmessungen l, b, s bzw. l, und die für das Projekt geforderte Wärmeleistung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im dritten Projektschritt ist die maximale Arbeitstemperatur im PTC festzulegen. Der Werkstoff PTC besitzt die einzigartige Eigenschaft, bei Überhitzung im Störfall den Wärmefluss bis zum kompletten Abschalten zu reduzieren. Diese Sicherheitsfunktion überspannt wie ein Schutzschirm den gesamten Heizvorgang in der Quelle und Senke. Da von außen durch den individuellen Wärmebedarf aus dem Fond eingegriffen werden kann, ist ein gewisser Schwankungsbereich vorzuhalten, der den instationären Heizprozess in der Quelle und den stationären Wärmetausch in der Senke in einem thermischen Schwebezustand unterhalb des Sicherheitsschirmes versetzt.
Im letzten Schritt wird schließlich mit der Gestaltung der Senke die notwendige Kühlfläche bestimmt, wobei der am Minuspol der Quelle bereitstehende Wärmestrom durch Wärmetausch an das Heizmedium übertragen wird. so dass synchron mit der Wärmeerzeugung ein stationärer Heizprozess stabil am Laufen gehalten werden kann.
Dem allgemeinen Teil 1 zum Werkstoff PTC werden zwei weitere Teile nachgestellt, in denen aktuelle Detailprobleme theoretisch behandelt werden.
Ein solches Problem verbirgt sich in dem linearen Hochvolt-PTC-Heizer, bei deren Konstruktion die frei liegenden Pole mit einer Kunststoffummantelung als Hochspannungsschutz vorgesehen ist. Der Kunststoffmantel ist ein passives Bauteil, das am eigentlichen Heizprozess nicht beteiligt ist, aber als Nebenwirkung auf den Heizprozess Einfluss nimmt. Es werden die Ursachen dieses Einflusses aus den theoretischen Erkenntnissen ergründet und praktische Konsequenzen dargelegt.
Im dritten Teil wird ein Alternativprojekt der quadratischen Version in optimierter Funktionalität und Technologie zur praktischen Nutzanwendung entwickelt.
7. Literatur
1 Klaus Kietzer, Dissertation zur Potentialtheorie, Universität Rostock, 1966
2 Albert Betz, Konforme Abbildung, Springer-Verlag, 1948
3 Peter von Böckh, Thomas Wetzel, Wärmeübertragung, Springer Vieweg, 2017
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieses Dokuments über PTC-Heizelemente?
Dieses Dokument konzentriert sich auf die Analyse von PTC-Heizelementen (Positive Temperature Coefficient), insbesondere deren Anwendung in elektrischen Heizungen für Automobile, sowohl in Niedervolt- als auch in Hochvoltanlagen. Es untersucht die Eigenschaften, das Verhalten und die Modellierung dieser Heizelemente.
Welche Arten von PTC-Heizelementen werden diskutiert?
Es werden hauptsächlich zwei Arten von PTC-Heizelementen verglichen: lineare Niedervolt-PTC-Heizer und quadratische (konzentrische) Hochvolt-PTC-Heizer. Die Vor- und Nachteile beider Bauformen, insbesondere im Hinblick auf Wärmeleitung und Isolation, werden erörtert.
Was ist das Hauptproblem bei der Konstruktion von Hochvolt-PTC-Heizern?
Das Hauptproblem besteht darin, dass eine gute elektrische Isolationsschicht (wie eine Kunststoffummantelung) typischerweise eine schlechte Wärmeleitung verursacht, was die Effizienz des Heizelements beeinträchtigt. Unterschiedliche Materialien an der Nahtstelle zwischen Wärmequelle und -senke beeinflussen ebenfalls die Wärmeleitung.
Was ist die analoge Potentialfeldtheorie und wie wird sie angewendet?
Die analoge Potentialfeldtheorie wird verwendet, um das Verhalten von PTC-Heizelementen zu modellieren. Es wird angenommen, dass der keramische Werkstoff PTC der Potentialtheorie zugeordnet werden kann, und die Potentialströmung wird verwendet, um die Wärmeerzeugung analog abzubilden.
Welche analogen Modelle werden zur Beschreibung der PTC-Elemente verwendet?
Für das quadratische PTC-Element wird ein Kegelstumpfmodell verwendet, bei dem Wasser durch eine Öffnung fließt und sich laminar ausbreitet, um die Wärmeerzeugung zu simulieren. Für das lineare PTC-Element wird eine Wasserwand verwendet, über die Wasser gleichmäßig fließt, um die lineare Wärmeerzeugung darzustellen.
Wie wird die Wärmeerzeugung im quadratischen PTC-Heizer mathematisch modelliert?
Die Wärmeerzeugung wird durch eine Beziehung beschrieben, die die örtlichen Leistungsanteile q(r,𝝋,z) in Abhängigkeit von den Koordinaten innerhalb des PCT beschreibt. Es wird eine Formel entwickelt, die die Energieverteilung innerhalb einer ebenen Schicht mit der Dicke 𝛿 beschreibt.
Wie wird die Wärmeleitung im PTC-Stab vom Plus- zum Minuspol beschrieben?
Die Wärmeleitung wird durch das Gesetz von Fourier beschrieben, wobei die Wärmeleitung durch den PTC untersucht wird. Analoge Beziehungen zur Potentialströmung werden auch hier verwendet, um die Wärmeleitung zu modellieren.
Welche Schlussfolgerungen werden für die Projektierung von Hochvolt-PTC-Heizern gezogen?
Das entwickelte mathematische Modell ermöglicht es, das Wärmefeld und das resultierende Temperaturfeld in Abhängigkeit von den Hauptabmessungen und der geforderten Wärmeleistung zu analysieren. Wichtige Schritte für die Projektierung umfassen die Festlegung der maximalen Arbeitstemperatur, die Gestaltung der Kühlfläche und die Berücksichtigung der Sicherheitsfunktion des PTC-Werkstoffs, der bei Überhitzung den Wärmefluss reduziert.
Welche weiteren Themen werden in den folgenden Teilen behandelt?
In den folgenden Teilen werden Detailprobleme wie der Einfluss der Kunststoffummantelung auf lineare Hochvolt-PTC-Heizer und ein Alternativprojekt der quadratischen Version in optimierter Funktionalität und Technologie zur praktischen Nutzanwendung behandelt.
- Quote paper
- Klaus Kietzer (Author), Theorie des thermischen Verhaltens des keramischen Werkstoffes PTC, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1308605