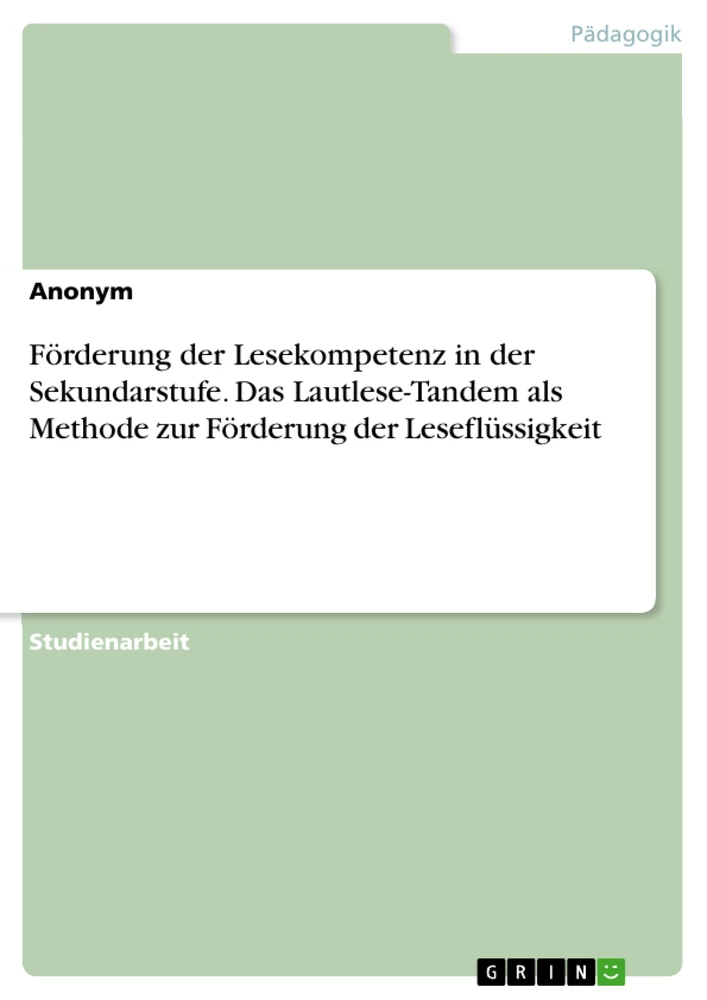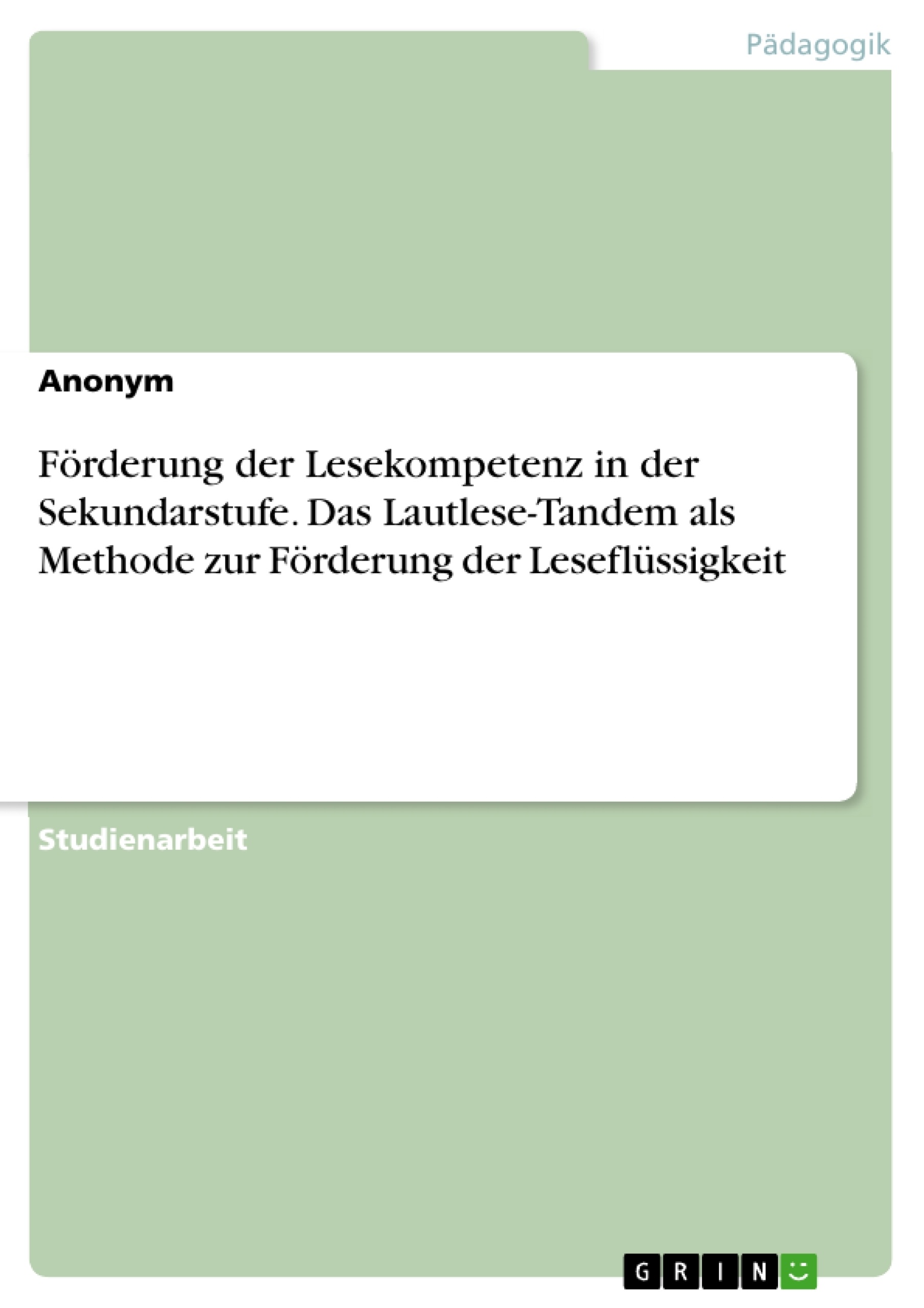Diese Hausarbeit knüpft an die alarmierenden Ergebnisse der PISA-Studie 2000 und 2019 an, aus denen hervorgeht, dass viele Kinder und Jugendliche (rund ein Fünftel der Schüler:innenschaft) große Probleme beim Lesen haben. Sie können altersangemessene Texte nicht ausreichend verstehen und verarbeiten. Dabei ist Lesen eine Schlüsselkompetenz, es bildet das Fundament für die Qualifizierung in Ausbildung und Beruf und ist insofern unzweifelhaft "Basis der Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben." Wenn Menschen lesen können, eröffnen sich ihnen viele Lebensbereiche - nicht lesen zu können hingegen kann verheerende Auswirkungen auf die Lebensbiographie der Schüler:innen haben.
In der Hausarbeit wird das Mehrebenen-Diagramm der Lesekompetenz nach C. Rosebrock und D. Nic (2010) erläutert, anschließend wird in die Lesefördermaßnahme 'Lautlese-Tandem' eingeführt und exemplarisch erarbeitet. Das Lautlese-Tandem ist eine kooperative Lernform, mittels derer die Lesekompetenzen der SuS systematisch verbessert werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Exkurs: Lesesozialisation
- Lesekompetenz – Definition
- Mehrebenenmodell nach Rosebrock / Nix (2010)
- Prozessebene
- Subjektebene
- Soziale Ebene
- Leseflüssigkeit diagnostizieren - Das Lautleseprotokoll
- Leseflüssigkeit fördern - Das Lautlese-Tandem
- Fazit und didaktische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Problematik von Defiziten in der basalen Lesekompetenz bei Schülerinnen und Schülern einer fünften Gymnasialklasse. Sie analysiert die Ursachen dieser Defizite, insbesondere im Kontext der Lesesozialisation, und stellt das didaktische Mehrebenenmodell der Lesekompetenz vor, um die Teilfähigkeiten des Lesens zu verstehen. Die Arbeit präsentiert die Einführung der Lesefördermaßnahme Lautlese-Tandem als kooperative Lernform in den Unterricht und erläutert die Anwendung des Leseprotokolls zur Diagnose der Leseflüssigkeit. Ziel ist es, Antworten auf die Frage zu finden, wie Lesekompetenz didaktisch beschrieben werden kann und welche Form der Leseförderung die Verbesserung der basalen Lesekompetenzen in der gymnasialen Sekundarstufe ermöglicht.
- Lesesozialisation und Einfluss des soziokulturellen Umfelds auf die Entwicklung von Lesekompetenz
- Didaktisches Mehrebenenmodell der Lesekompetenz
- Diagnose von Leseflüssigkeit mittels Lautleseprotokoll
- Förderung der Leseflüssigkeit durch das Lautlese-Tandem als kooperative Lernform
- Didaktische Reflexion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Problematik des Leselerns in der Schule und die Bedeutung von Lesekompetenz für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie stellt die Zielsetzung und den Fokus der Arbeit auf Schülerinnen und Schüler der fünften Gymnasialklasse dar.
- Exkurs: Lesesozialisation: Dieses Kapitel erklärt die These der Lesesozialisationsforschung, die besagt, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in den Prozess des Lesenlernens starten. Es wird der Einfluss des soziokulturellen Umfelds, insbesondere der Familie, auf die Entwicklung von Lesekompetenz untersucht.
- Lesekompetenz – Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff Lesekompetenz im Rahmen der PISA-Studie und beleuchtet die Entwicklung des Kompetenzkonstrukts von einer kognitionspsychologischen Perspektive hin zu einer umfassenderen Sichtweise, die motivationale Orientierungen, Einstellungen und soziale Faktoren miteinbezieht.
- Mehrebenenmodell nach Rosebrock / Nix (2010): Dieses Kapitel stellt das didaktische Mehrebenenmodell der Lesekompetenz vor, welches die Teilfähigkeiten des Lesens in Prozessebene, Subjektebene und soziale Ebene unterteilt. Das Modell bietet eine Grundlage für das Verständnis der Lesekompetenz und die Entwicklung von Fördermaßnahmen.
- Leseflüssigkeit diagnostizieren - Das Lautleseprotokoll: Dieses Kapitel beschreibt das Lautleseprotokoll als Diagnoseinstrument für Lehrkräfte, um die Leseflüssigkeit von Schülerinnen und Schülern zu messen. Es erläutert die Durchführung und die Interpretation des Protokolls.
- Leseflüssigkeit fördern - Das Lautlese-Tandem: Dieses Kapitel stellt das Lautlese-Tandem als kooperative Lernform zur Förderung der Leseflüssigkeit vor. Es erläutert die Durchführung des Trainings und die Vorteile dieser Methode.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, Lesesozialisation, Mehrebenenmodell, Leseflüssigkeit, Lautleseprotokoll, Lautlese-Tandem, Didaktik, Förderung, Unterrichtspraxis, Gymnasialklasse, Schülerinnen und Schüler.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Förderung der Lesekompetenz in der Sekundarstufe. Das Lautlese-Tandem als Methode zur Förderung der Leseflüssigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1303949