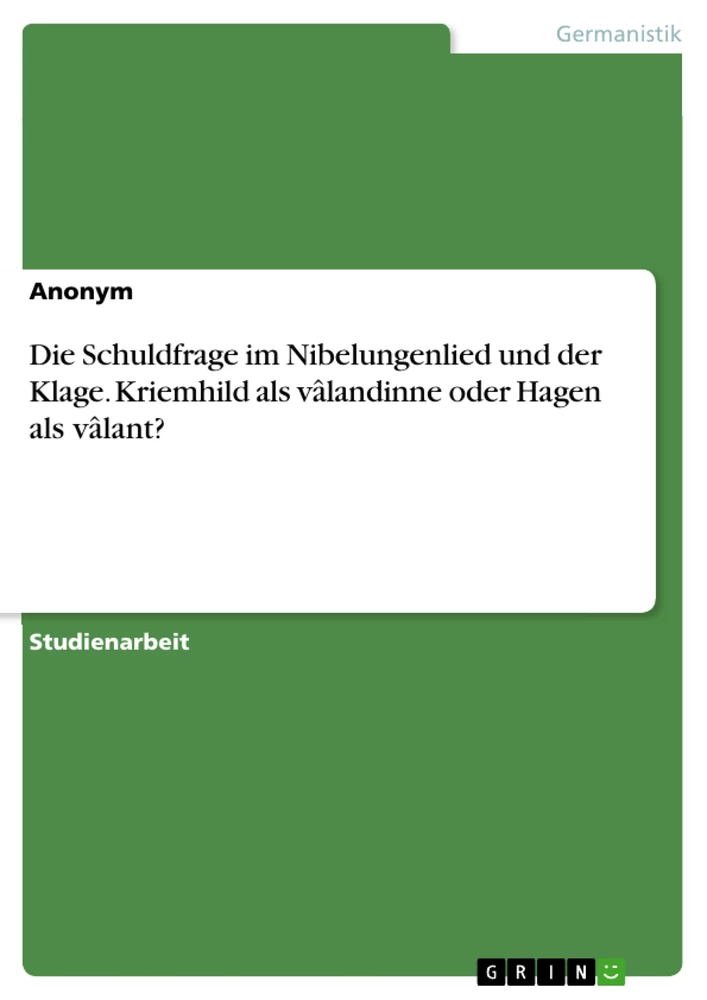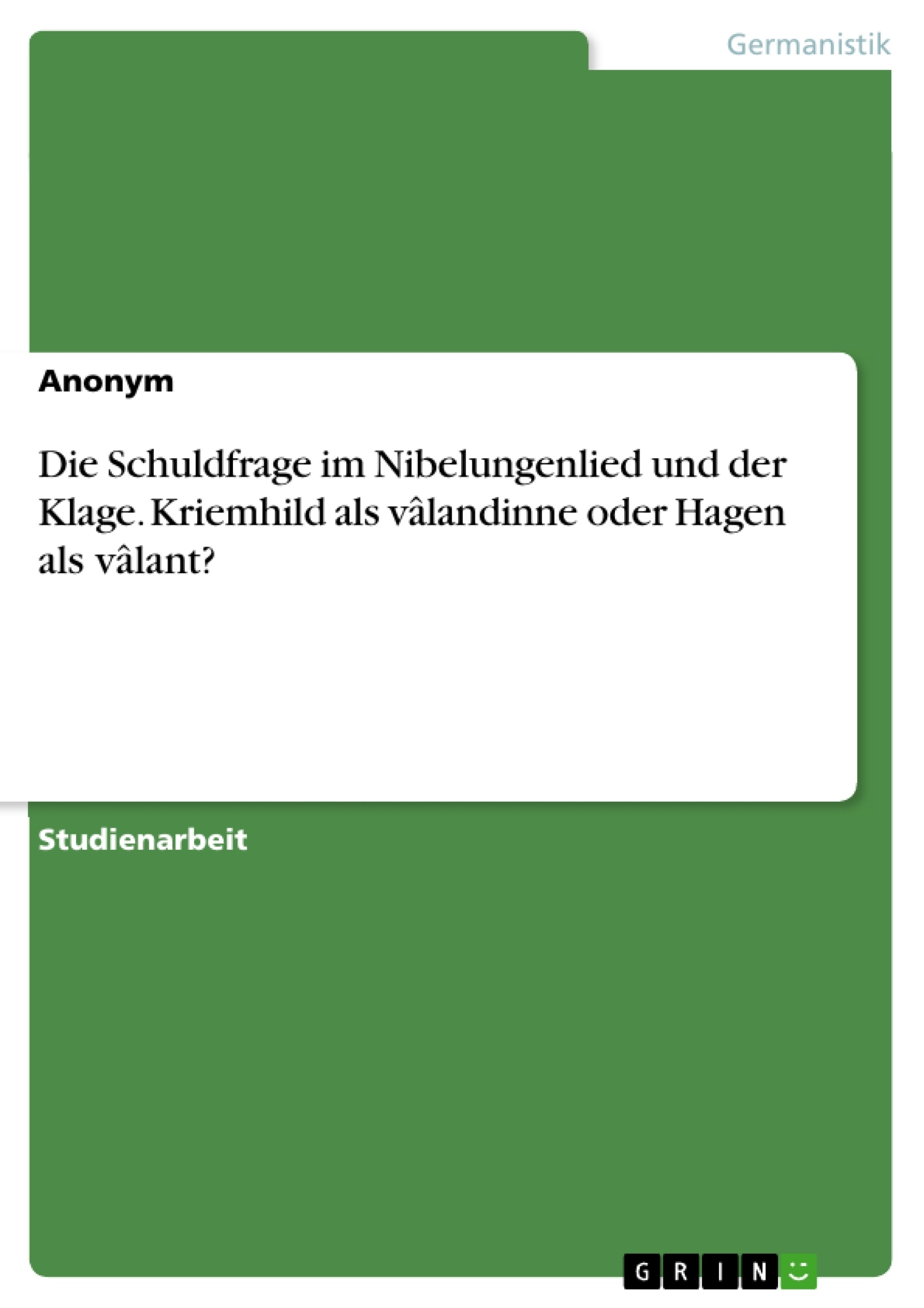Ziel dieser Arbeit ist, die Schuldfrage im Nibelungenlied und der Klage anhand der Figuren Kriemhild und Hagen vergleichend zu untersuchen. Dabei dient die 16. Aventiure des Nibelungenliedes, in der der Mordkomplott gegen Siegfried Gestalt annimmt und umgesetzt wird, als Ausgangspunkt der Analyse. Zuerst erfolgt die Bewertung von Kriemhild und dann die Bewertung von Hagen. Zuerst anhand des Nibelungenliedes, dann anhand der Klage. Nach dem Abschluss jeder Sektion erfolgt eine abschließende Bewertung. Abschluss der Arbeit bildet der Vergleich.
Die Arbeit geht dabei folgender Fragestellung nach: Wie bewerten das Nibelungenlied und die Klage anhand der Figuren Kriemhild und Hagen die Schuld am Ausbruch der Kämpfe und der daraus resultierenden Tode?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Nibelungenlied
- Ausgangssituation
- Bewertung von Kriemhild
- Durch den Erzähler
- Durch Hagen
- Durch Giselher
- Durch Iring
- Durch Rüdiger
- Durch Dietrich von Bern
- Bewertung von Hagen
- Durch den Erzähler
- Durch Kriemhild
- Durch Giselher
- Durch Volker
- Durch Hildebrand
- Durch Etzel
- Abschließende Bewertung
- Die Klage
- Bewertung von Kriemhild
- Durch den Erzähler
- Durch Dietrich von Bern
- Durch Etzel
- Durch Swämmel
- Durch Bischof Pilgrim
- Durch Brünhild
- Bewertung von Hagen
- Durch den Erzähler
- Durch Hildebrand
- Durch Dietrich von Bern
- Durch Etzel
- Durch direkte Rede von Einigen
- Bewertung von Kriemhild
- Abschließende Bewertung
- Abschließender Vergleich
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Analyse der Schuldfrage im Nibelungenlied und der Klage, indem sie die Figuren Kriemhild und Hagen vergleichend untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der 16. Aventiure des Nibelungenliedes, die den Mordkomplott gegen Siegfried beleuchtet. Die Untersuchung bewertet zunächst Kriemhild und anschließend Hagen, sowohl im Kontext des Nibelungenliedes als auch der Klage. Im Anschluss an jede Sektion erfolgt eine abschließende Bewertung, bevor schließlich ein Vergleich beider Werke die Arbeit abschließt.
- Die Schuldfrage im Nibelungenlied und der Klage
- Die Rolle von Kriemhild und Hagen in der Auslösung der Kämpfe und den Todesfällen
- Der Vergleich der Perspektiven des Nibelungenliedes und der Klage
- Die Bewertung der Figuren durch verschiedene Charaktere im Text
- Der Zusammenhang zwischen dem Nibelungenlied und der Klage
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Fragestellung der Arbeit ein und erläutert den Zusammenhang zwischen dem Nibelungenlied und der Klage. Das Kapitel „Das Nibelungenlied“ konzentriert sich auf die 16. Aventiure, die den Mord an Siegfried beschreibt. Es beleuchtet die Bewertung von Kriemhild und Hagen durch verschiedene Figuren im Text, um den jeweiligen Standpunkt zur Schuldfrage zu verdeutlichen. Die Klage wird in einem separaten Kapitel betrachtet, wobei die Bewertungen von Kriemhild und Hagen durch unterschiedliche Figuren analysiert werden.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind das Nibelungenlied, die Klage, Kriemhild, Hagen, Schuldfrage, Heldenepik, Mittelhochdeutsch, Vergleichende Literaturwissenschaft, Überlieferungsgemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser literaturwissenschaftlichen Analyse?
Die Arbeit untersucht vergleichend die Schuldfrage im „Nibelungenlied“ und in „Der Klage“, wobei die Figuren Kriemhild und Hagen im Mittelpunkt stehen.
Welche Rolle spielt die 16. Aventiure in dieser Untersuchung?
Die 16. Aventiure, in der das Mordkomplott gegen Siegfried geplant und ausgeführt wird, dient als wesentlicher Ausgangspunkt für die Analyse der Schuld.
Wie wird Kriemhild im Text bewertet?
Die Arbeit analysiert die Bewertung Kriemhilds durch verschiedene Instanzen wie den Erzähler, Hagen, Giselher, Dietrich von Bern und andere Charaktere in beiden Werken.
Welche Bezeichnung wird für Kriemhild und Hagen im Titel verwendet?
Der Titel stellt die Frage, ob Kriemhild als „vâlandinne“ (Teufelin) oder Hagen als „vâlant“ (Teufel/Bösewicht) zu betrachten ist.
Worin besteht der Vergleich zwischen dem Nibelungenlied und der Klage?
Die Arbeit vergleicht, wie unterschiedlich die beiden Werke die Schuld am Ausbruch der Kämpfe und den resultierenden Todesfällen gewichten und bewerten.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Die Schuldfrage im Nibelungenlied und der Klage. Kriemhild als vâlandinne oder Hagen als vâlant?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1300814