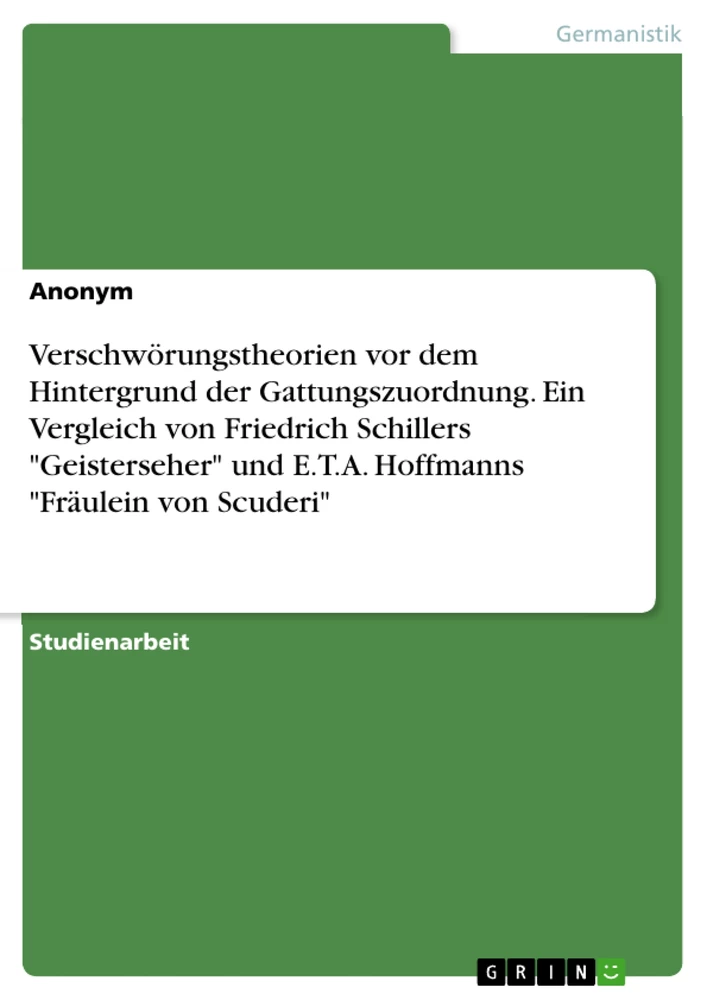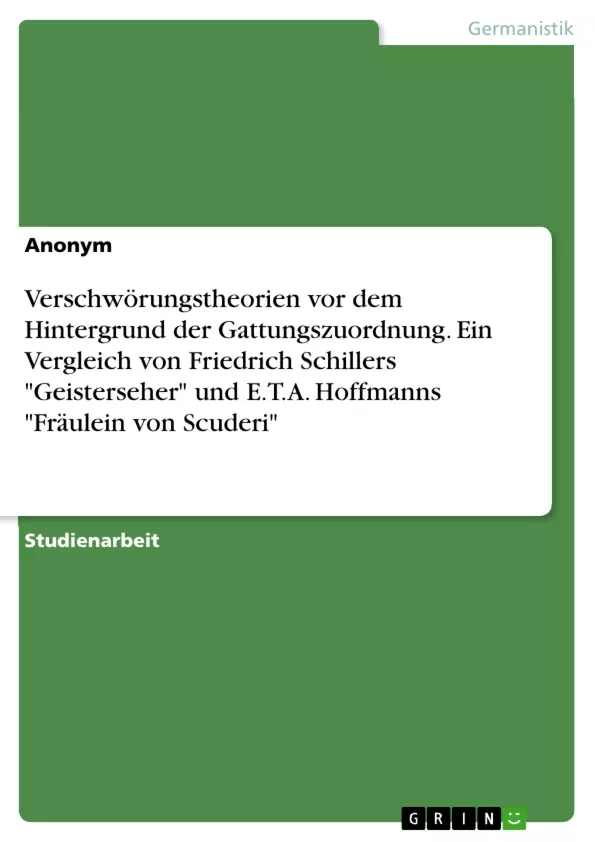Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, welche Auswirkungen die Gattungszuordnung (besonders in Bezug auf den Schauerroman und die Detektivgeschichte) auf die Darstellung der Verschwörungstheorien hat. Zunächst werden daher, noch unter den Punkt der Einleitung gefasst, die Charakteristika des Schauerromans und der Detektivgeschichte herausgearbeitet, die für den Verlauf der weiteren Arbeit von zentraler Bedeutung sind. Zudem wird in gebotener Kürze auf die Zuverlässigkeit der Erzählinstanz eingegangen, die vor allem in Schillers Geisterseher eine tragende Rolle spielt. Im Hauptteil sollen dann die verschiedenen Verschwörungstheorien ausgearbeitet werden. Bei Schillers "Geisterseher" in besonderem Hinblick auf die Entwicklung des Prinzen und die Geheimgesellschaft "Bucentauro" (unter Berücksichtigung der zentralen Rolle des Armeniers). Bei Hoffmanns "Fräulein von Scuderi" anhand der Figuren des Goldschmieds Cardillac, seines Gehilfen Olivier Brusson und Magdaleine von Scuderi. Angrenzend wird jeweils ein kurzes Fazit gezogen, ehe der abschließende Vergleich folgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schauerroman
- Detektivgeschichte
- Zuverlässigkeit der Erzählinstanz
- Verschwörungskonstellationen
- Schillers Geisterseher
- Entwicklung des Prinzen
- Die Geheimgesellschaft „Bucentauro“
- Fazit
- Hoffmanns Fräulein von Scuderi
- Cardillac und sein Gehilfe Brusson
- Das Fräulein von Scuderi und la Regnie
- Fazit
- Abschließender Vergleich
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Auswirkung der Gattungszuordnung, insbesondere hinsichtlich Schauerroman und Detektivgeschichte, auf die Darstellung von Verschwörungstheorien in den Werken „Der Geisterseher“ von Schiller und „Fräulein von Scuderi“ von Hoffmann. Die Analyse beleuchtet die Charakteristika beider Gattungen, insbesondere die Zuverlässigkeit der Erzählinstanz, um die unterschiedlichen Perspektiven auf die Verschwörungen zu verstehen.
- Die Merkmale des Schauerromans und der Detektivgeschichte
- Die Darstellung von Verschwörungen in beiden Werken
- Die Rolle der Erzählinstanz und ihre Zuverlässigkeit
- Der Einfluss der Gattungszuordnung auf die Verschwörungstheorien
- Der Vergleich der beiden Werke im Hinblick auf die Verschwörungskonstellationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Gattungszuordnung für die Darstellung von Verschwörungstheorien. Der Fokus liegt dabei auf den Charakteristika des Schauerromans und der Detektivgeschichte sowie der Zuverlässigkeit der Erzählinstanz. Das Kapitel über Verschwörungskonstellationen behandelt die unterschiedlichen Verschwörungstheorien in Schillers „Der Geisterseher“ und Hoffmanns „Fräulein von Scuderi“. Die Entwicklung des Prinzen, die Geheimgesellschaft „Bucentauro“ und die zentrale Rolle des Armeniers in Schillers Werk stehen im Mittelpunkt. Bei Hoffmann werden die Figuren des Goldschmieds Cardillac, seines Gehilfen Olivier Brusson und Magdaleine von Scuderi analysiert. Abschließend wird ein Vergleich der beiden Werke gezogen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Schauerroman, Detektivgeschichte, Verschwörungstheorie, Erzählinstanz, Zuverlässigkeit, „Der Geisterseher“, Schiller, „Fräulein von Scuderi“, Hoffmann, Cardillac, „Bucentauro“.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat die literarische Gattung auf Verschwörungstheorien?
Die Arbeit untersucht, wie Merkmale des Schauerromans und der Detektivgeschichte die Darstellung und Wahrnehmung von Verschwörungen in der Literatur beeinflussen.
Worum geht es in Schillers „Der Geisterseher“?
Im Fokus stehen die Entwicklung eines Prinzen und die Machenschaften der Geheimgesellschaft „Bucentauro“ unter dem Einfluss der mysteriösen Figur des Armeniers.
Welche Rolle spielt die Detektivgeschichte in Hoffmanns „Fräulein von Scuderi“?
Das Werk gilt als eine der ersten Detektivgeschichten, in der das Fräulein von Scuderi versucht, die Wahrheit hinter den Verbrechen des Goldschmieds Cardillac aufzudecken.
Warum ist die Zuverlässigkeit der Erzählinstanz wichtig?
Besonders in Schillers Werk entscheidet die (Un-)Zuverlässigkeit des Erzählers darüber, ob der Leser die Verschwörung als real oder als Täuschung wahrnimmt.
Was kennzeichnet einen Schauerroman im Kontext von Verschwörungen?
Schauerromane nutzen oft unheimliche, übernatürliche Elemente und Geheimbünde, um eine Atmosphäre der Bedrohung und Unsicherheit zu schaffen.
Wer sind die Hauptfiguren in Hoffmanns Erzählung?
Zentrale Figuren sind der Goldschmied René Cardillac, sein Gehilfe Olivier Brusson und die Titelheldin Magdaleine von Scuderi.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Verschwörungstheorien vor dem Hintergrund der Gattungszuordnung. Ein Vergleich von Friedrich Schillers "Geisterseher" und E.T.A. Hoffmanns "Fräulein von Scuderi", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1300807