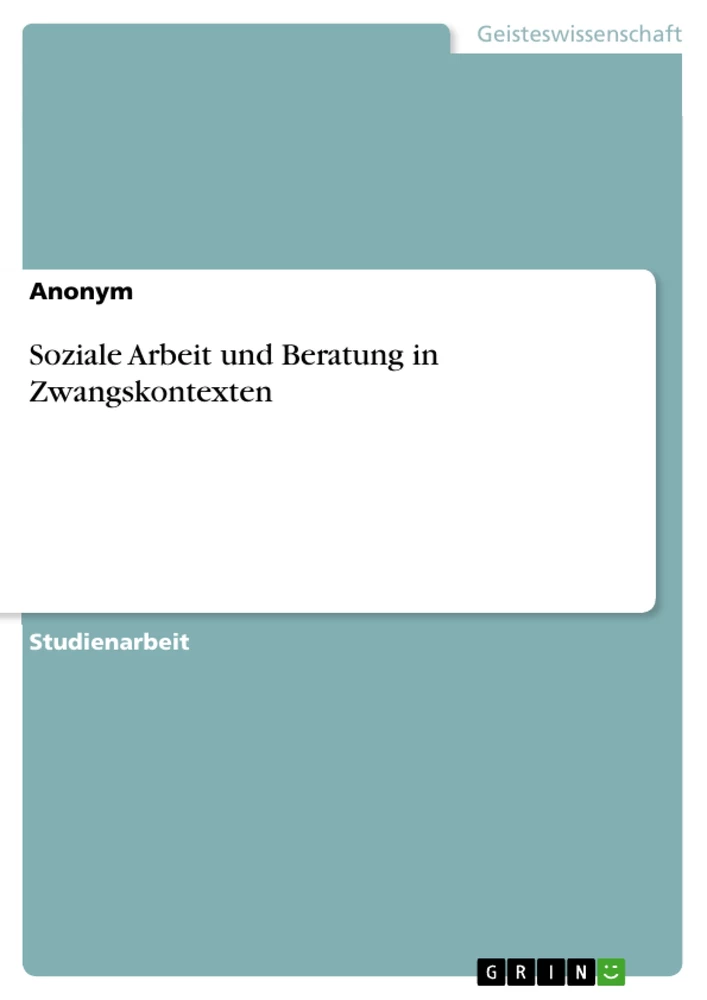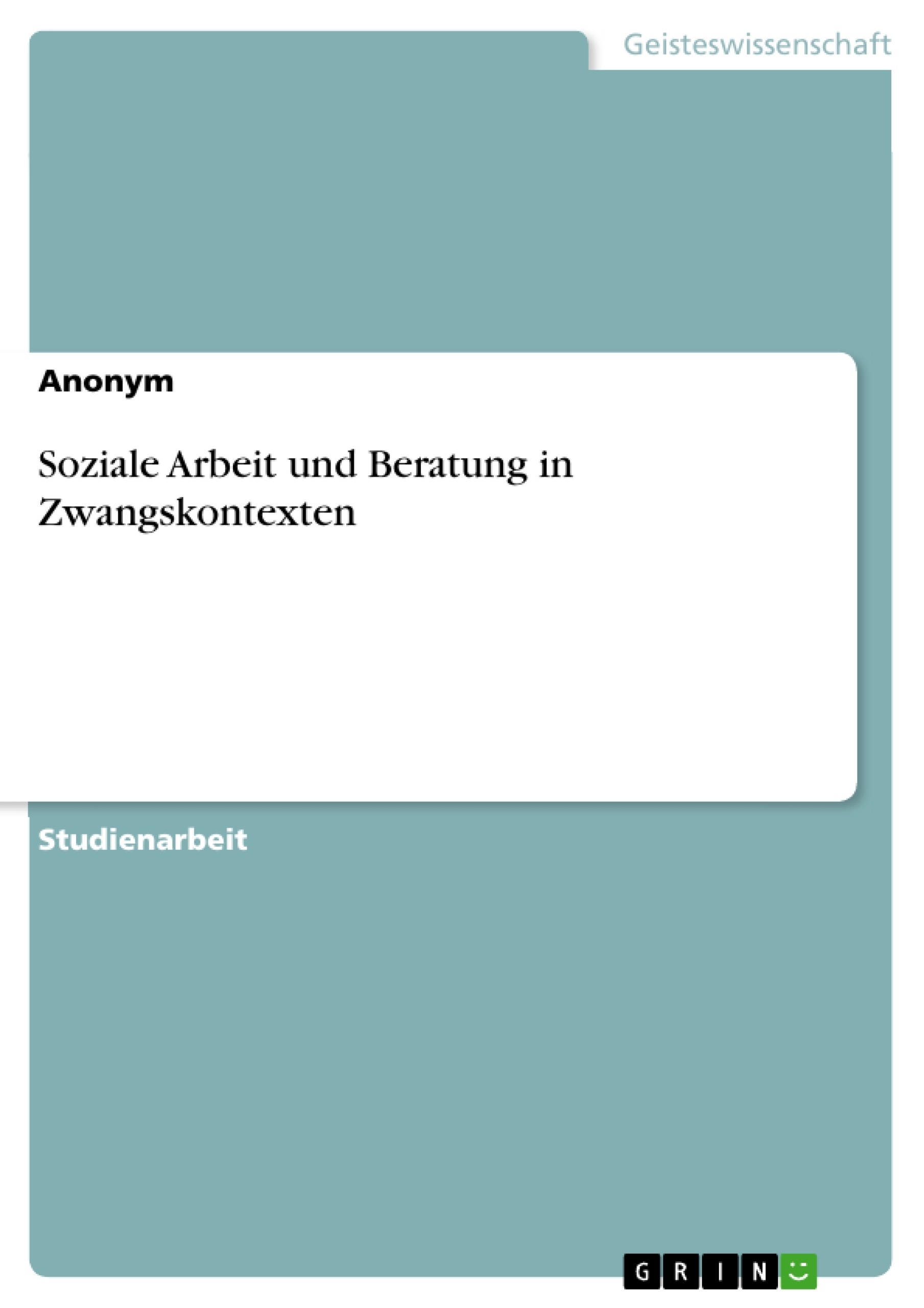In dieser Portfolioarbeit wird Soziale Arbeit und Beratung im Zwangskontext vorgestellt.
Im ersten Abschnitt wird der Begriff „Zwangskontext“ definiert. Dabei werden die Kontaktaufnahme zum Sozialen Dienst und die Faktoren, die Motivation zur Mitarbeit der KlientInnen beeinflussen, fokussiert. Anschließend werden das „doppelte Mandat“ und der „Trialog“ näher erläutert.
Im zweiten Abschnitt werden sowohl fünf Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit vorgestellt als auch überweisende Instanzen oder Auftraggeber, die im unterschiedlichen Maße mit Merkmalen von Zwangskontexten behaftet sind und jeweils andere Interventionsmöglichkeiten bieten.
Im dritten Abschnitt wird dargestellt, inwiefern „Unfreiwilligkeit“ und „Widerstand“ von KlientInnen als Lösungsverhalten angesehen werden können. Anschließend wird erläutert, welche Konsequenzen sich aus dieser Perspektive für das professionelle Handeln ableiten lassen.
Im letzten Abschnitt wird dargestellt, wie aus BesucherInnen freiwillige und für ein Ziel motivierte KlientInnen werden können. Dabei wird auf Vorgehensweisen wie das „Joining“, auf Fragetechniken wie das zirkuläre Fragen oder auch auf Haltungen der SozialarbeiterInnen in der Eltern-Kind-Einrichtung eingegangen. Dies wird in einem fiktiven möglichen Dialog exemplarisch dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
1. „Zwangskontext“
2. Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit mit Merkmalen von Zwangskontexten
2.1 Schule / Schulsozialarbeit
2.2 Bewährungshilfe
2.3 Kinder- und Jugendhilfe - Allgemeiner Sozialer Dienst
2.4 Gesetzliche Betreuung
2.5 Fahrerlaubnisbehörden und GutachterInnen
3. „Unfreiwilligkeit“ und „Widerstand“ (Aufgabe 3)
3.1„Unfreiwilligkeit“ und „Widerstand“ als Lösungsverhalten
3.2 Konsequenzen für das pädagogische Handeln
4. Aus „BesucherInnen“ werden motivierte KlientInnen
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Soziale Arbeit und Beratung in Zwangskontexten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1300334