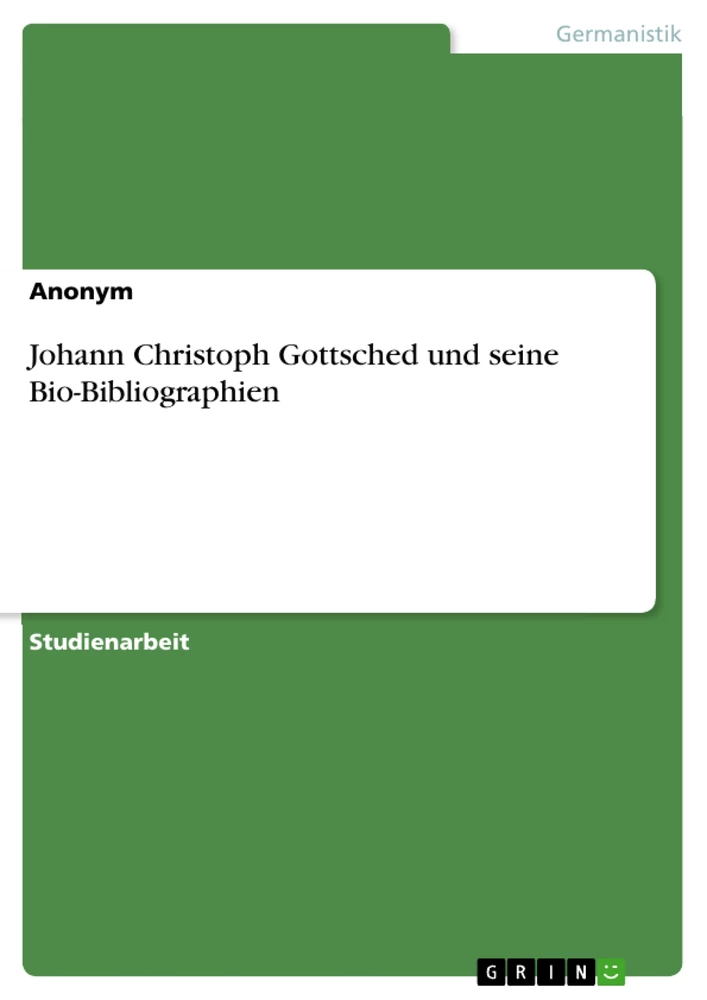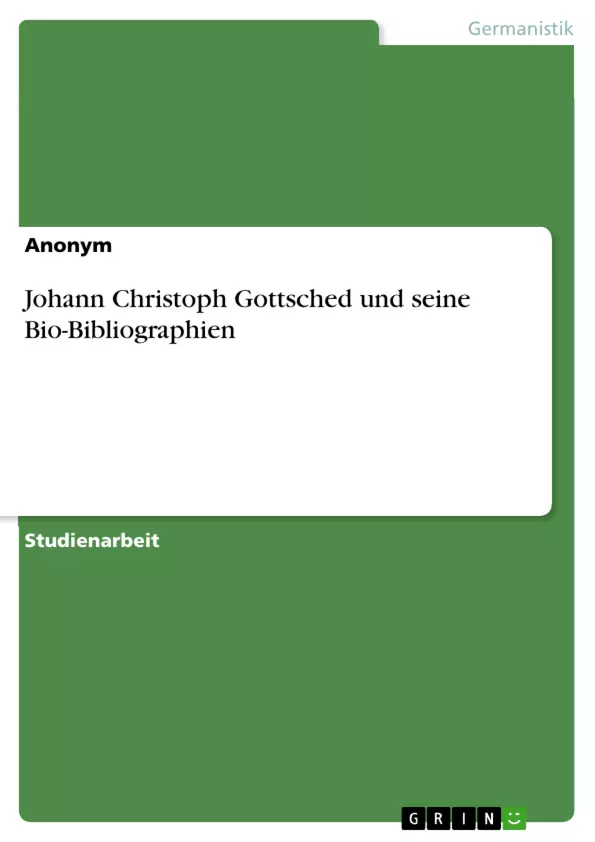Diese Arbeit beschäftigt sich mit einer Recherche zu dem Leben des Johann Christoph Gottsched. Hierzu werden sechs Quellen zu Rate gezogen und explizit auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten untersucht. Dazu wird jede einzelne Quelle genau betrachtet und versucht, eine mögliche Ursache für die Unterschiede zu finden und somit auch zu ermitteln, welche Information nun die richtige ist oder ob vielleicht sogar beide stimmen. Hierbei ist natürlich auch besonders interessant, auf welche Quellen sich die Autoren selbst beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung der Quellen
- Vergleich der Quellen
- Mögliche Ursachen für die Unterschiede
- Zukünftige Überlegungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erforschung des Lebens und Werks von Johann Christoph Gottsched anhand verschiedener Quellen. Die Analyse zielt darauf ab, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den biographischen Daten und bibliographischen Angaben zu identifizieren. Dabei werden die Quellen kritisch untersucht und mögliche Gründe für die Unterschiede aufgezeigt. Die Arbeit untersucht, welche Informationen als korrekt gelten können und ob es möglicherweise unterschiedliche, valide Perspektiven auf Gottscheds Leben gibt.
- Analyse von biographischen Daten und bibliographischen Angaben über Johann Christoph Gottsched
- Identifizierung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in verschiedenen Quellen
- Untersuchung möglicher Gründe für diese Unterschiede
- Bewertung der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Quellen
- Exploration der unterschiedlichen Perspektiven auf Gottscheds Leben und Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Problemfeld der Recherche und Informationssuche im digitalen Zeitalter vor. Sie verdeutlicht, dass verschiedene Quellen oft widersprüchliche Informationen liefern und die Validierung dieser Informationen daher essenziell ist. Der Fokus der Arbeit liegt auf einer exemplarischen Recherche zum Leben von Johann Christoph Gottsched.
Vorstellung der Quellen
Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Quellen vor, die für die Analyse herangezogen werden. Neben Wikipedia werden Lexika, Artikel und Beiträge von verschiedenen Websites sowie ein Aufsatz in einem Sammelwerk vorgestellt. Die Charakteristika und Zuverlässigkeit der jeweiligen Quellen werden kurz erläutert.
Vergleich der Quellen
Dieses Kapitel analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Informationen, die in den verschiedenen Quellen zu Johann Christoph Gottsched bereitgestellt werden. Es wird gezeigt, dass die Quellen in ihrer Ausrichtung auf die Person oder das Werk Gottscheds differieren und dies zu Unterschieden in der Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen führt.
Schlüsselwörter
Johann Christoph Gottsched, Biographie, Bibliographie, Sekundärliteratur, Wikipedia, Lexika, Online-Lexikon, Quellenkritik, Informationsrecherche, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Corona-Pandemie, Lockdown
Häufig gestellte Fragen zu Johann Christoph Gottsched
Wer war Johann Christoph Gottsched?
Gottsched war ein bedeutender deutscher Schriftsteller, Dramaturg und Literaturtheoretiker der Aufklärung, der vor allem für seine Reform des deutschen Theaters bekannt ist.
Warum gibt es Unterschiede in Gottscheds Biographien?
Unterschiede entstehen oft durch die verschiedene Ausrichtung der Quellen (Fokus auf Person vs. Werk) oder die Nutzung unterschiedlicher Primär- und Sekundärliteratur.
Sind Wikipedia-Informationen zu Gottsched zuverlässig?
Wikipedia bietet einen guten Überblick, sollte aber stets mit wissenschaftlichen Lexika und Fachaufsätzen abgeglichen werden, um die Validität der Daten zu prüfen.
Welche Rolle spielten Bio-Bibliographien in der Forschung?
Sie helfen dabei, das Lebenswerk eines Autors systematisch zu erfassen und die zeitgenössische Rezeption sowie die Wirkungsgeschichte nachzuvollziehen.
Wie beeinflusste die Corona-Pandemie die Recherche zu Gottsched?
Durch den Lockdown waren Forscher verstärkt auf digitale Quellen und Online-Lexika angewiesen, was die Frage nach der Zuverlässigkeit digitaler Informationen verschärfte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Johann Christoph Gottsched und seine Bio-Bibliographien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1298847