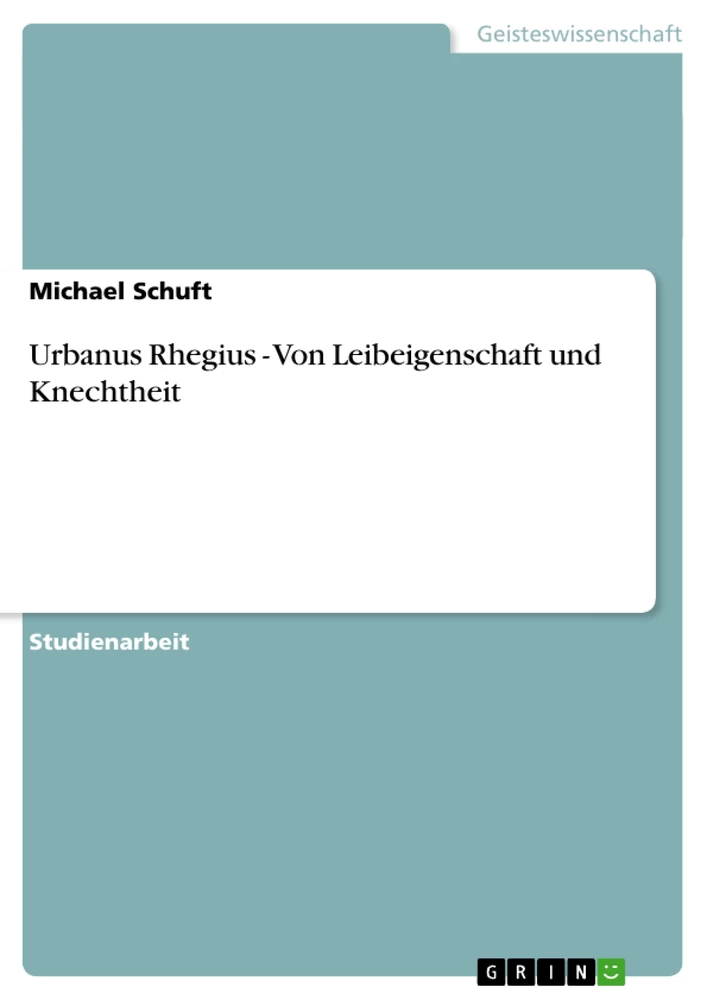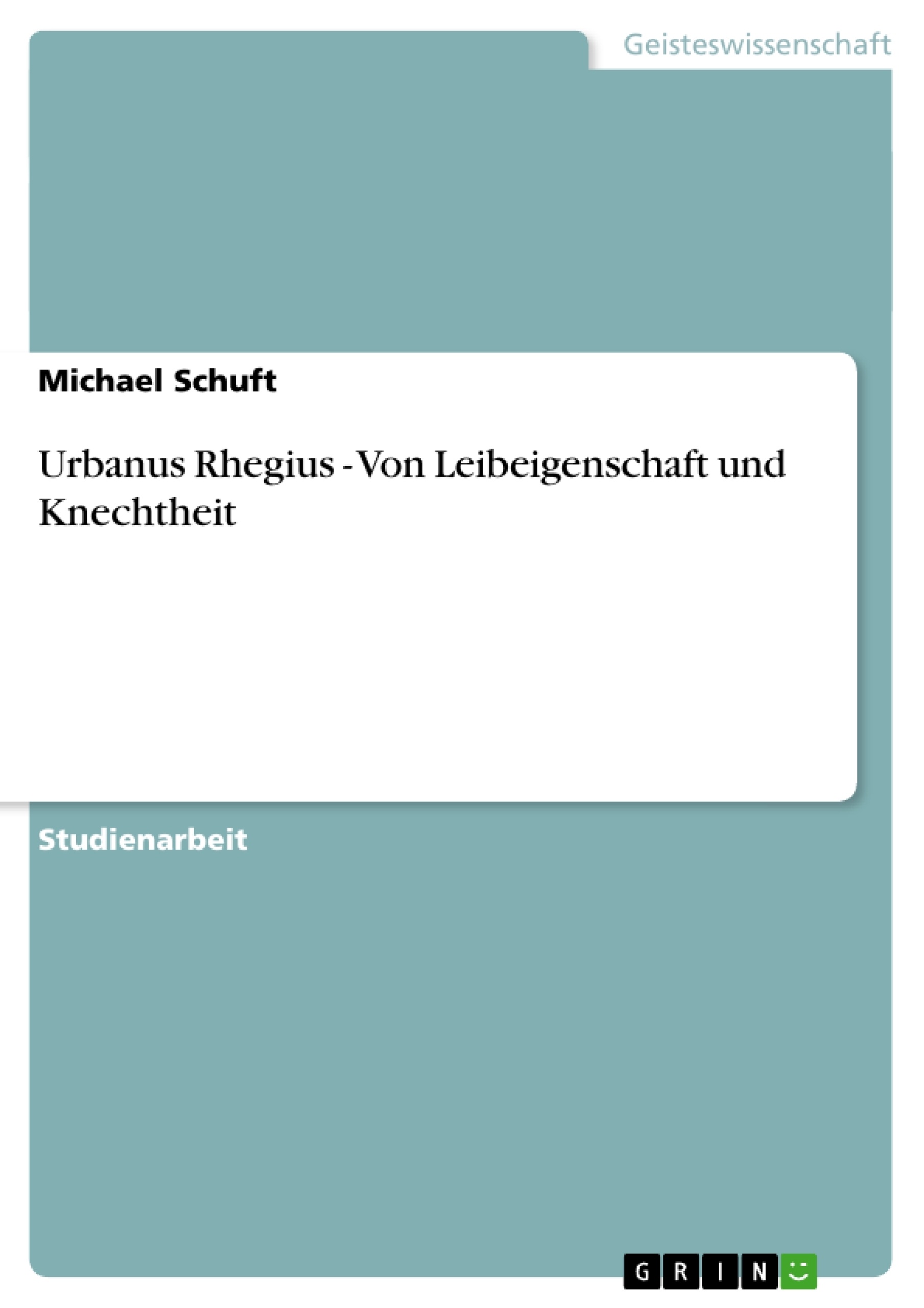Urbanus Rhegius gehört wohl zu den weniger bekannten Persönlichkeiten der Reformationszeit. Gerhard Uhlhorn1 charakterisiert seine Bedeutung für die Reformation in Deutschland so, daß „er zwar nicht in der eigentlichen Bildung des Dogma, aber in der Ausbildung desselben für die Gemeinden Großes geleistet hat.“2 Martin Luther verweist auf ihn (und die hier behandelte Schrift) in seiner Schrift „Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben“ von 1525 im dritten Artikel auf Rhegius als einen guten Freund3. Grund genug, um sich einmal genauer mit einer Schrift dieses Theologen der frühen Reformationszeit zu befassen, zumal er als Theologe aus der „zweiten Reihe“, die dazu beitrug, daß „[...] die Reformation zu einer breitenwirksamen kirchlichen und gesellschaftlichen Erneuerungsbewegung [...]“4 wurde, seinen Teil in Süd- und Norddeutschland geleistet hat.
Urbanus Rhegius gehört zu jenen Persönlichkeiten der Kirchengeschichte, deren Leben und Wirken hinter den „großen“ Namen wohl eher ein Schattendasein führen. Dabei tritt jenes Phänomen zutage, daß vielleicht so manche Persönlichkeit in der Geschichte getroffen hat. War sie ihren Zeitgenossen eine sehr wohl bekannte und geschätzte Größe, gerät sie im Laufe der Zeit nahezu in Vergessenheit. Dabei war Rhegius in gebildeten Kreisen sehr bekannt und geschätzt.5 Reformatorisch gesinnt, verstand er sich als Vorkämpfer der lutherischen Lehre.6 In der Literatur wird er, mit wenigen Ausnahmen, kaum verhandelt. Zugängliche Darstellungen sind rar. Die meisten stammen aus der Zeit vor 1900. Ein Zugang zu seinen Werken selbst ist mit wenigen Ausnahmen ebenso schwierig.
Diese Arbeit wird sich mit einer Quelle befassen, die sich mit einem damals sehr aktuellen und brisanten Thema beschäftigt. Das Land ist von Unruhe und Veränderung geprägt. Mit der Reformation werden Forderungen laut, die breite Massen der Bevölkerung erreichen. Viele verbinden sie mit eigenen Forderungen, die neben den religiösen Reformen auch politische und soziale Reformen im Reich beinhalten. Freiheit, wie sie im Evangelium beschrieben wird, soll in die persönliche Freiheit und Gleichheit umgesetzt werden. Verbunden mit schwelenden Konflikten zwischen Bauern und Oberen ist die Forderung nach der Abschaffung der Leibeigenschaft, begründet auf das „Göttliche Recht“, die zentrale Forderung, auf die Rhegius reagiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zur Person des Urbanus Rhegius
- 2. Die historischen Zusammenhänge
- 2.1. Die Problematik in Augsburg in der Zeit des Bauernkriege
- 2.2. Die historische Einordnung der Quelle
- Exkurs: Leibeigenschaft und „Göttliches Recht“ - zwei zentrale Begriffe im Bauernkrieg
- 3. Formale Fragen an die Quelle
- 3.1. Überblick – Inhaltliche Darstellung und Gliederung
- 4. Interpretation
- 4.1. Christliche und weltliche Freiheit
- 4.2. Rhegii Obrigkeitsverständnis
- 4.3. Leibeigenschaft und Knechtschaft
- 4.4. Zwischenbilanz
- 4.5. An die christlichen Herren
- 4.6. Beendigung der Leibeigenschaft?
- 5. Auswertung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Schrift „Von Leibaygenschaft oder knechthait, wie sich Herren und aygen leut christlich halten sollend, Bericht aus göttlichen Rechten zu Augsburg gepredigt durch Urban Rhegius“ von Urbanus Rhegius, einem Theologen der frühen Reformationszeit. Die Arbeit analysiert die Quelle im Kontext der historischen und sozialen Verhältnisse der Zeit, insbesondere im Hinblick auf die Bauernkriege und die Debatte um die Leibeigenschaft. Ziel ist es, Rhegius' Position zu diesem Thema zu verstehen und seine Argumentation im Kontext der reformatorischen Bewegung zu beleuchten.
- Die Person und das Wirken von Urbanus Rhegius
- Die historischen Zusammenhänge der Quelle, insbesondere die Bauernkriege und die Situation in Augsburg
- Die Interpretation der Quelle im Hinblick auf die Themen Freiheit, Obrigkeit und Leibeigenschaft
- Die theologische Position von Rhegius im Vergleich zu Luther
- Die Auswertung der Quelle im Gesamtzusammenhang der Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Urbanus Rhegius als eine weniger bekannte Persönlichkeit der Reformationszeit vor und erläutert die Bedeutung seiner Schrift „Von Leibaygenschaft oder knechthait“ im Kontext der damaligen Zeit. Das erste Kapitel beleuchtet die Vita des Rhegius, wobei der Fokus auf seine theologische Entwicklung und seine Hinwendung zur Reformation liegt. Das zweite Kapitel widmet sich den historischen Zusammenhängen der Quelle, insbesondere der Problematik der Bauernkriege und der Situation in Augsburg. Ein Exkurs beleuchtet die zentralen Forderungen der Bauern im Hinblick auf die Leibeigenschaft und das „Göttliche Recht“. Das dritte Kapitel behandelt die formale Struktur und den Inhalt der Quelle. Die Interpretation der Quelle im vierten Kapitel analysiert Rhegius' Positionen zu den Themen Freiheit, Obrigkeit und Leibeigenschaft. Dabei werden Vergleiche zu Luther gezogen, um die geistige Nähe und Verbundenheit Rhegius' zu ihm in theologischen Gesichtspunkten aufzuzeigen. Die Auswertung der Quelle im fünften Kapitel betrachtet die Ergebnisse der Interpretation im Gesamtzusammenhang der Arbeit, um Rhegius' Position gegenüber den Aufständischen deutlich zu machen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Person Urbanus Rhegius, die Reformation, die Bauernkriege, die Leibeigenschaft, das „Göttliche Recht“, die christliche Freiheit, das Obrigkeitsverständnis und die theologische Position von Rhegius im Vergleich zu Luther. Die Arbeit beleuchtet die Situation in Augsburg im Kontext der Bauernkriege und analysiert die Quelle „Von Leibaygenschaft oder knechthait“ im Hinblick auf die zentralen Themen der damaligen Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Urbanus Rhegius?
Urbanus Rhegius war ein bedeutender Theologe der frühen Reformationszeit, der als Vorkämpfer der lutherischen Lehre in Süd- und Norddeutschland wirkte.
Was war seine Position zur Leibeigenschaft?
In seiner Schrift von 1525 setzte er sich kritisch mit der Leibeigenschaft auseinander und versuchte, das Verhältnis zwischen Herren und Untertanen aus "göttlichem Recht" zu klären.
Was bedeutet "Göttliches Recht" im Kontext der Bauernkriege?
Die Bauern beriefen sich auf das Evangelium, um soziale und politische Forderungen wie die Abschaffung der Leibeigenschaft und persönliche Freiheit zu rechtfertigen.
Wie unterschied sich Rhegius' Obrigkeitsverständnis von dem Luthers?
Die Arbeit zeigt eine große geistige Nähe zu Luther auf; beide betonten die Notwendigkeit der weltlichen Ordnung, mahnten aber auch die christliche Verantwortung der Herren an.
Was versteht Rhegius unter "christlicher Freiheit"?
Er unterschied streng zwischen der geistlichen Freiheit des Christenmenschen vor Gott und der weltlichen Bindung bzw. Gehorsamspflicht gegenüber der Obrigkeit.
Warum ist Urbanus Rhegius heute eher unbekannt?
Obwohl er zu Lebzeiten hochgeschätzt war, geriet er als Theologe der "zweiten Reihe" hinter den großen Namen wie Luther oder Melanchthon im Laufe der Zeit in Vergessenheit.
- Arbeit zitieren
- Michael Schuft (Autor:in), 2008, Urbanus Rhegius - Von Leibeigenschaft und Knechtheit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/129798