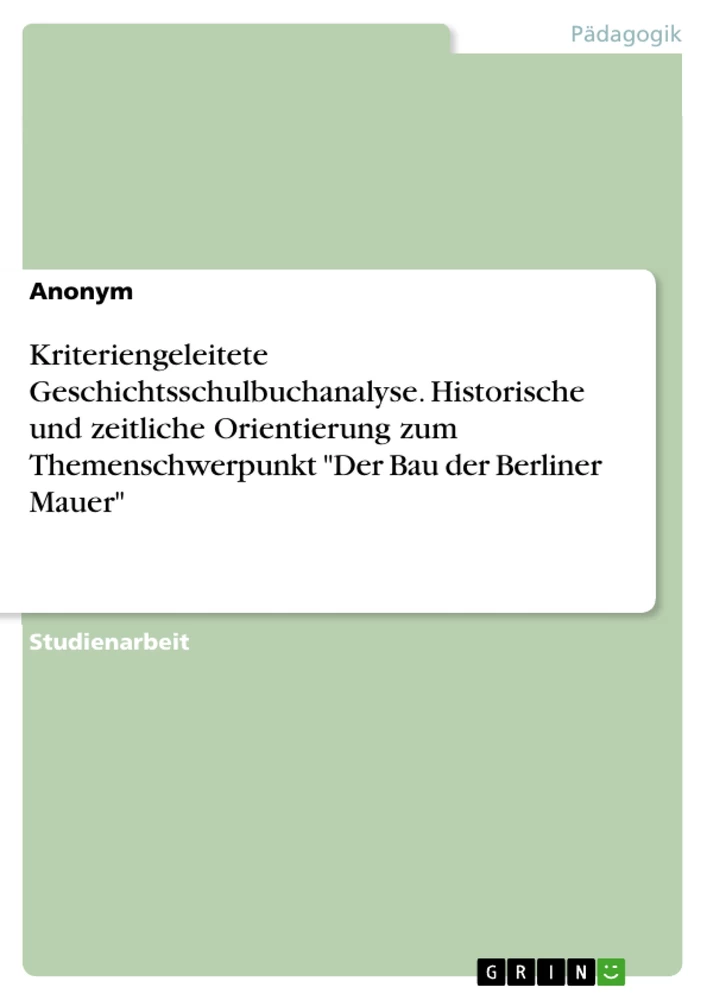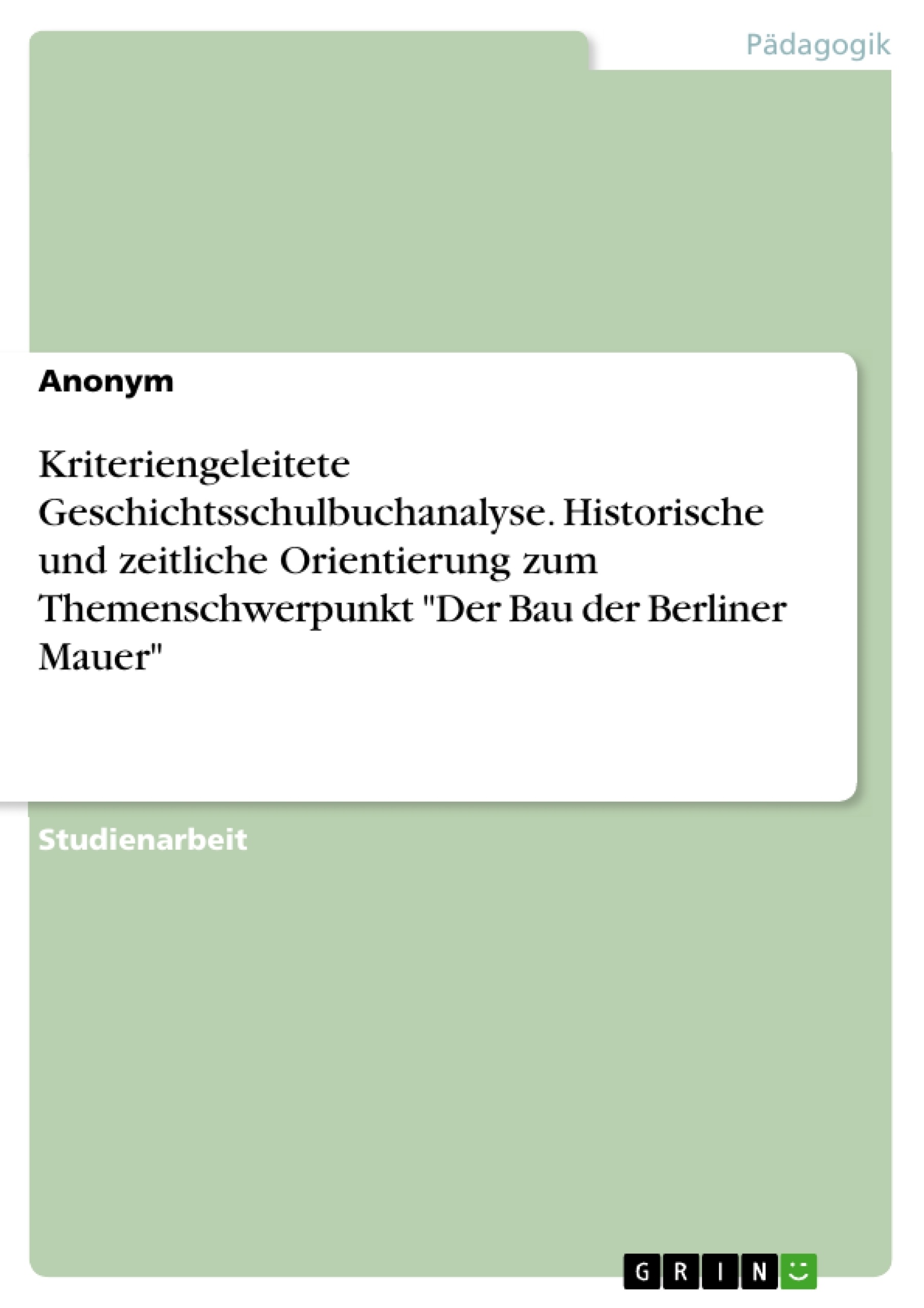Das Ziel der folgenden Analyse ist es, die verschiedenen schriftlichen und bildlichen Materialien (Q1, Q2, Q3, Q4, D1) sowie die dazugehörigen sechs Aufgaben auf den Schulbuchseiten in Bezugnahme von ausgewählter Sekundärliteratur kritisch zu untersuchen und zu bewerten.
Der einführende Verfassertext agiert nach Schönemann und Thünemann als essenzieller Kernbereich des Darstellungsteils in Geschichtsschulbüchern, da dieser den SuS zunächst historische Orientierung verschaffen soll.
Der Titel des vorliegenden Verfassertextes "Der Bau der Mauer im August 1961" gibt den SuS zunächst eine historische und zeitliche Orientierung und führt die Lernenden direkt in das Thema des Mauerbaus ein. Zudem verfügt der Text über sachliche Richtigkeit und ist insofern adressatengerecht geschrieben, dass er einerseits sehr kurz ist und andererseits auf Metaphern sowie auf schwierige Passiv- und Nebensatzkonstruktionen verzichtet wird. Es findet also eine sprachliche Berücksichtigung für SuS statt, da ebenfalls von unbekannten Begriffen, die ohne Erklärungen Verwendung finden, abgelassen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Beschreibung
- Kriteriengeleitete Analyse der schriftlichen sowie bildlichen Quellen und Darstellungen
- Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert eine Doppelseite aus dem Geschichtsbuch "Zeitreise 3" unter dem Titel "Der Bau der Mauer", die den Mauerbau im August 1961 thematisiert. Die Analyse konzentriert sich auf eine kritische Bewertung der schriftlichen und bildlichen Quellen sowie der Arbeitsaufträge, die im Arbeitsteil des Buches präsentiert werden.
- Die Analyse des Verfassertextes und des Arbeitsteils hinsichtlich ihrer Adressatengerechtigkeit und Qualität
- Die Bewertung der Auswahl und Präsentation der Quellen im Hinblick auf Authentizität und Multiperspektivität
- Die Untersuchung der Arbeitsaufträge hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die Schüler*innen zum kritischen Denken anzuregen
- Die Diskussion der Rolle von Lernwiderständen und der Notwendigkeit, historische Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten
- Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Quellenangaben und der Herausforderung des Umgangs mit gekürzten und abgetippten Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
Beschreibung
Die Doppelseite des Schulbuches beschäftigt sich mit dem Bau der Berliner Mauer im August 1961. Sie enthält einen Verfassertext mit dem Titel "Der Bau der Mauer im August 1961" und einen Arbeitsteil mit fünf Materialien und sechs Aufgaben. Die Materialien umfassen sowohl historische Bildquellen (Q1, Q4) als auch schriftliche Quellen (Q2, Q3) sowie eine Statistik (D1). Die Arbeitsaufträge beziehen sich sowohl auf den Verfassertext als auch auf die Materialien.
Kriteriengeleitete Analyse der schriftlichen sowie bildlichen Quellen und Darstellungen
Der einführende Verfassertext bietet eine sachliche Darstellung des Mauerbaus, die jedoch den Mangel an multiperspektivischem Erzählen aufweist, da lediglich die DDR-Regierung als verantwortlicher Akteur dargestellt wird. Die Quellen des Arbeitsteils, bestehend aus gekürzten Versionen von Originalquellen, bieten den Schüler*innen unterschiedliche Perspektiven auf den Mauerbau. Die Aufgaben fordern die Schüler*innen zum kritischen Umgang mit den Materialien und zur Beantwortung von historischen Fragestellungen auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit analysiert die Darstellung des Mauerbaus in einem Geschichtsbuch und fokussiert dabei auf die folgenden Themen: Schulbuchanalyse, Quellenkritik, Multiperspektivität, Adressatengerechtigkeit, Lernwiderstände, Geschichtsdidaktik, DDR-Geschichte.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Kriteriengeleitete Geschichtsschulbuchanalyse. Historische und zeitliche Orientierung zum Themenschwerpunkt "Der Bau der Berliner Mauer", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1297439