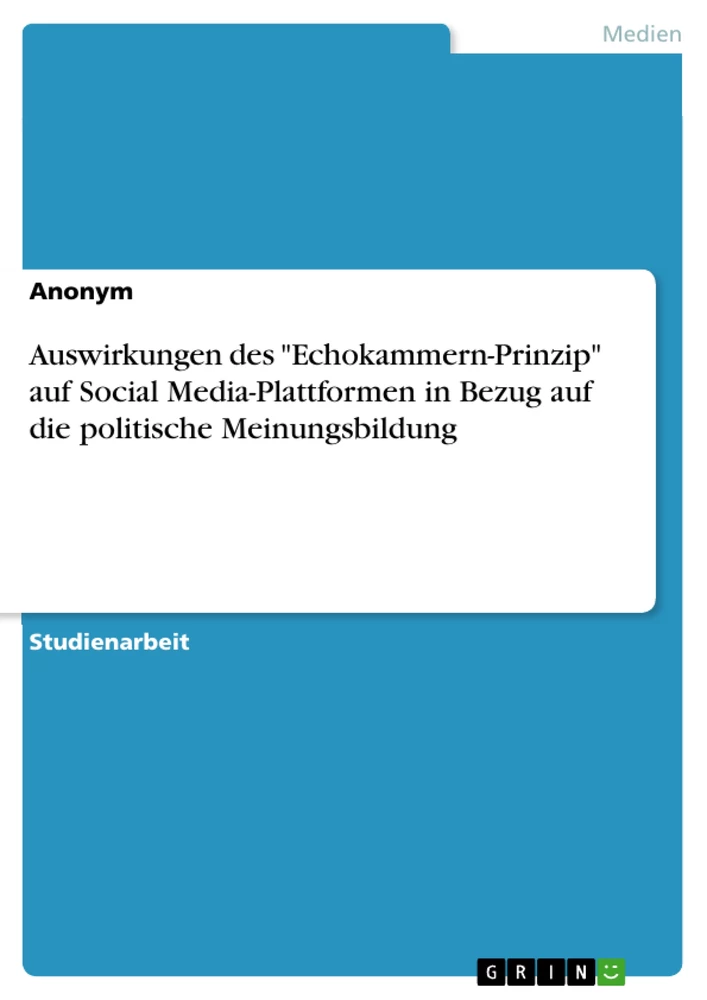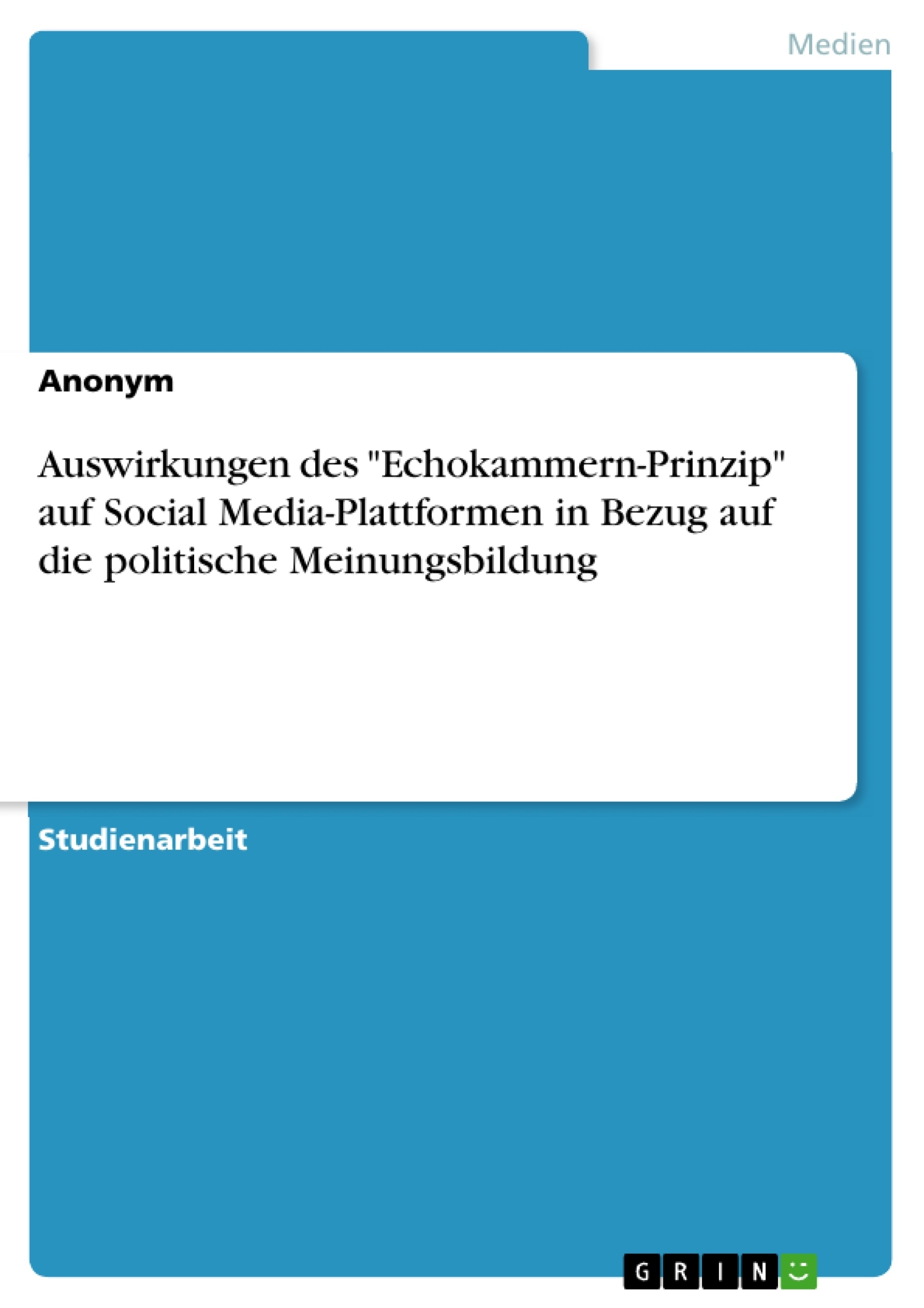Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Inwieweit lassen sich die Auswirkungen des Echokammer-Prinzips auf die politische Meinungsbildung in den Social Media Plattformen, mit den Auswirkungen in der realen Welt vergleichen? Um diese Frage beantworten zu können, ist die folgende Arbeit in unterschiedliche Kapitel unterteilt. Einführend wird das Echokammer-Prinzip und die Social Media Plattformen erläutert. Im Zuge dessen werden auch die reale Welt und die politische Meinung genauer definiert. Diese Definitionen gelten als theoretische Grundlage der Arbeit. Im nächsten Kapitel werden die Auswirkungen des Echokammer-Prinzips auf die politische Meinungsbildung jeweils in den Social Media Plattformen und der realen Welt aufgezeigt. Ein abschließender Vergleich und eine Beurteilung werden durch das Fazit erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Echokammern-Prinzip
- 2.2 Social Media-Plattform
- 2.3 Reale Welt
- 2.4 Politische Meinung
- 3. Auswirkung des Echokammer-Prinzips auf die politische Meinungsbildung.
- 3.1 Auswirkung in den Social Media-Plattformen
- 3.2 Auswirkung in der realen Welt
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen des Echokammer-Prinzips auf die politische Meinungsbildung in der realen Welt mit denen in Social Media-Plattformen zu vergleichen.
- Definition und Abgrenzung des Echokammer-Prinzips in realer und digitaler Welt
- Analyse der Auswirkungen des Echokammer-Prinzips auf die Meinungsbildung in Social Media
- Untersuchung der Auswirkungen des Echokammer-Prinzips auf die Meinungsbildung in der realen Welt
- Vergleich der Auswirkungen in beiden Welten
- Diskussion möglicher Folgen des Echokammer-Prinzips für die politische Meinungsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Diese Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Echokammern" im Kontext der politischen Meinungsbildung dar. Sie beleuchtet die Rolle des Internets und von Social Media in der heutigen Gesellschaft und beschreibt den Wandel vom Web 1.0 zum Web 2.0.
Kapitel 2: Definitionen
Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit. Dazu gehören das Echokammer-Prinzip, Social Media-Plattformen, die reale Welt und die politische Meinung.
Kapitel 3: Auswirkung des Echokammer-Prinzips auf die politische Meinungsbildung
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Echokammer-Prinzips auf die politische Meinungsbildung in Social Media-Plattformen sowie in der realen Welt.
Schlüsselwörter
Echokammer-Prinzip, Social Media, Filterblase, politische Meinungsbildung, reale Welt, Online-Identität, Offline-Identität, Algorithmen, Informationsblase, Meinungsvielfalt, Dissonanz, Mehrheitskultur.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Auswirkungen des "Echokammern-Prinzip" auf Social Media-Plattformen in Bezug auf die politische Meinungsbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1297086