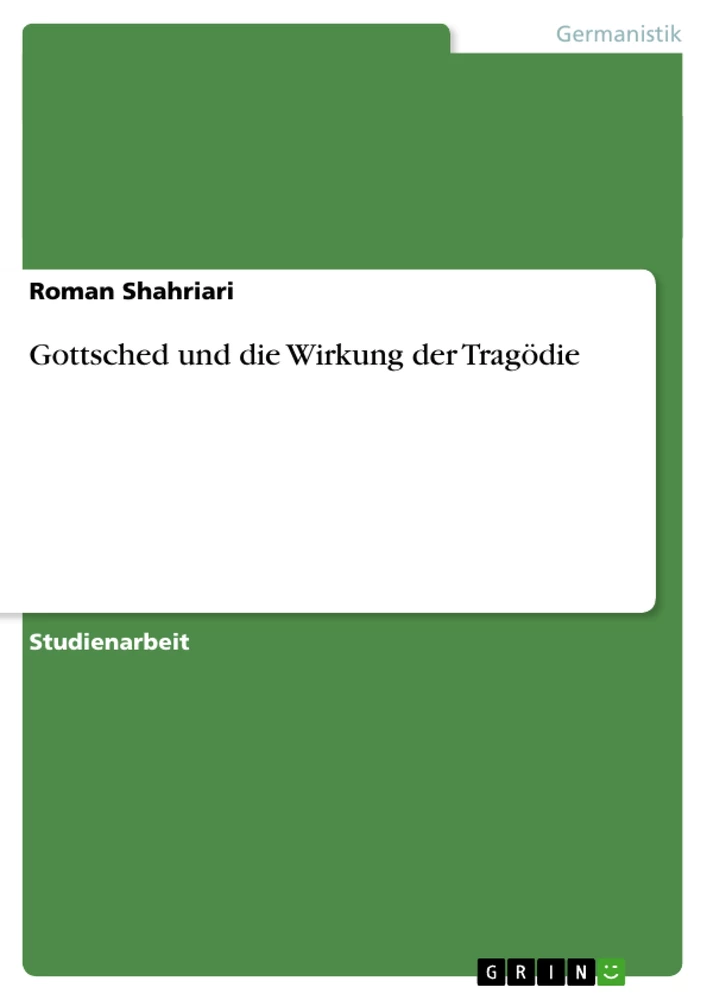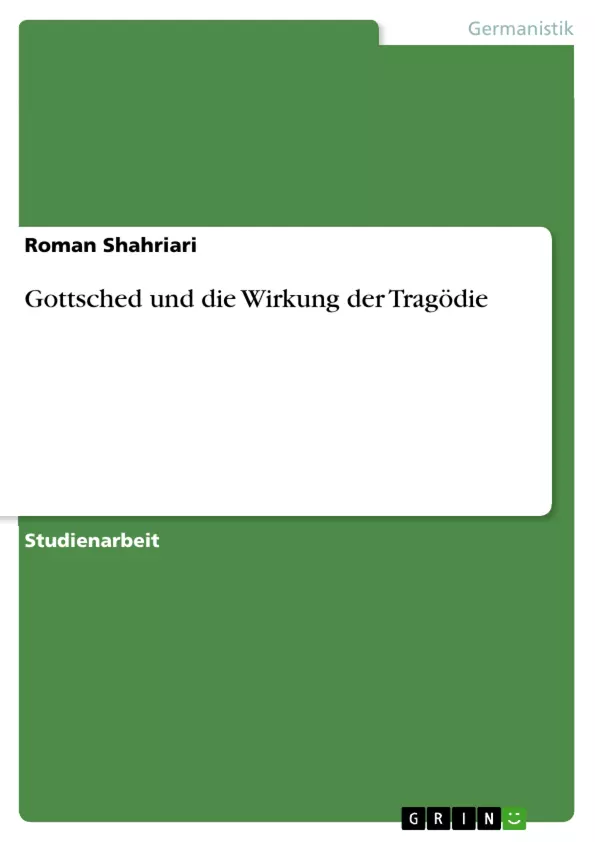Wie bestimmt Gottsched, der einflussreiche frühaufklärerische Poetologe und Dichter, theoretische Gestalt und praktische Wirkung der Tragödie? Diese Arbeit versucht, die wirkungsästhetischen Grundzüge der Gottschedschen Poetologie, besonders im Hinblick auf die Tragödie, herauszuarbeiten. Dabei wird zunächst das Wesen der Dichtung bzw. das Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit untersucht.
Im nächsten Schritt werden die Grundbegriffe von Gottscheds Tragödientheorie bestimmt, denn gerade die Tragödie hat für Gottsched eine herausgehobene Stellung innerhalb der Poesie.
Anschließend werden verschiedene Konzeptionen des tragischen Helden, das Bewunderungskonzept und das Fehlerkonzept, analysiert. Damit hängt aufs Engste das Wirkungskonzept des Trauerspiels zusammen, das um die aristotelischen Begriffe eleos, phobos und katharsis kreist. Wo es hilfreich und notwendig ist, werden zentrale Stellen der Poetik des Aristoteles miteinbezogen.
Abschließend wird auf die weitreichende wirkungsästhetische Dimension eingegangen, denn Theater und Trauerspiel wird im poetologischen System Gottscheds eine moralisch-didaktische Funktion zugeschrieben, die zur Stabilisierung eines politisch-sozialen Gemeinwesens, aber auch zur individuellen Versittlichung des Menschen beitragen soll.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Die Grundbegriffe von Gottscheds Tragödientheorie
- 1. Wesensbestimmung der Dichtung / Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit
- 2. Die Klassifizierung der Fabel
- 3. Der Handlungsaufbau der Tragödie
- 4. Die Konzeption des tragischen Helden
- 4.1. Das Fehlerkonzept
- 4.2. Das Bewunderungskonzept
- III Das Wirkungskonzept der Tragödie
- 1. eleos, phobos und katharsis bei Aristoteles
- 2. Die tragischen Wirkungskategorien bei Gottsched
- IV Die Dimension der Wirkungsästhetik
- V Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die wirkungsästhetischen Grundlagen von Gottscheds Poetologie, insbesondere im Hinblick auf die Tragödie. Es wird das Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit beleuchtet, die Grundbegriffe seiner Tragödientheorie definiert und die Konzeptionen des tragischen Helden analysiert. Die aristotelischen Begriffe eleos, phobos und katharsis spielen dabei eine zentrale Rolle. Schließlich wird die moralisch-didaktische Funktion des Theaters im System Gottscheds im Kontext der politischen und sozialen Stabilität untersucht.
- Gottscheds Tragödientheorie und deren Grundbegriffe
- Das Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit bei Gottsched
- Die Konzeption des tragischen Helden (Fehler- und Bewunderungskonzept)
- Das Wirkungskonzept der Tragödie und die Relevanz von eleos, phobos und katharsis
- Die moralisch-didaktische Funktion des Theaters in Gottscheds Poetologie
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung beginnt mit Lessings kritischer Einschätzung von Gottscheds Einfluss auf das deutsche Theater. Sie kontrastiert Lessings negative Sicht mit der neueren Forschung, die Gottscheds Leistungen im Kontext der frühen Aufklärung würdigt. Die Arbeit skizziert ihren Fokus: die Analyse der wirkungsästhetischen Grundzüge von Gottscheds Poetologie, insbesondere in Bezug auf die Tragödie, mit dem Ziel, das Wesen der Dichtung, das Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit, die Konzeption des tragischen Helden und das Wirkungskonzept des Trauerspiels zu untersuchen.
II Die Grundbegriffe von Gottscheds Tragödientheorie: Dieses Kapitel erörtert die zentralen Begriffe von Gottscheds Tragödientheorie. Es beginnt mit der Wesensbestimmung der Dichtung und dem Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit, wobei Gottscheds Ansatz, die "Gemüts-Neigungen des Menschen" als Quelle der Dichtung zu sehen, und seine Betonung von Form, Verstand und Geschmack im kreativen Prozess im Kontext der Aufklärung hervorgehoben werden. Die Diskussion über "guten Geschmack" als Verbindung von Vernunft und Regeln wird erläutert und Gottscheds Betonung der Nachahmung der Natur als Grundlage von Schönheit und Vollkommenheit in künstlichen Werken wird im Kontext seiner Wolffianischen Philosophie eingeordnet.
Schlüsselwörter
Gottsched, Tragödie, Frühaufklärung, Poetologie, Wirkungsästhetik, Dichtung, Wirklichkeit, Fehlerkonzept, Bewunderungskonzept, eleos, phobos, katharsis, moralisch-didaktische Funktion, Theaterreform.
Häufig gestellte Fragen zu Gottscheds Tragödientheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die wirkungsästhetischen Grundlagen von Johann Christoph Gottscheds Poetologie, insbesondere im Hinblick auf seine Tragödientheorie. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit, den Grundbegriffen seiner Theorie, der Konzeption des tragischen Helden und der Wirkungsweise der Tragödie.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht Gottscheds Tragödientheorie, das Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit in seiner Poetologie, die Konzeption des tragischen Helden (einschließlich des Fehler- und Bewunderungskonzepts), das Wirkungskonzept der Tragödie mit Bezug auf Aristoteles' eleos, phobos und katharsis, und die moralisch-didaktische Funktion des Theaters in Gottscheds Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundbegriffen von Gottscheds Tragödientheorie, ein Kapitel zum Wirkungskonzept der Tragödie, ein Kapitel zur Dimension der Wirkungsästhetik und ein Literaturverzeichnis.
Wie wird Gottscheds Tragödientheorie definiert?
Die Arbeit definiert Gottscheds Tragödientheorie anhand zentraler Begriffe wie der Wesensbestimmung der Dichtung, dem Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit, der Klassifizierung der Fabel, dem Handlungsaufbau der Tragödie und der Konzeption des tragischen Helden (unter Berücksichtigung von Fehler- und Bewunderungskonzept). Gottscheds Ansatz, die "Gemüts-Neigungen des Menschen" als Quelle der Dichtung zu sehen, und seine Betonung von Form, Verstand und Geschmack werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielen Aristoteles' Begriffe eleos, phobos und katharsis?
Aristoteles' Begriffe eleos (Mitleid), phobos (Furcht) und katharsis (Reinigung) spielen eine zentrale Rolle im Verständnis von Gottscheds Wirkungskonzept der Tragödie. Die Arbeit analysiert, wie Gottsched diese Begriffe in seine eigene Theorie integriert und wie sie zur Wirkung seiner Tragödien beitragen.
Welche Bedeutung hat die moralisch-didaktische Funktion des Theaters?
Die Arbeit untersucht die moralisch-didaktische Funktion des Theaters im System Gottscheds und deren Bedeutung im Kontext der politischen und sozialen Stabilität der damaligen Zeit. Gottscheds Ansatz zur Theaterreform und seine Vorstellung von "gutem Geschmack" werden in diesem Zusammenhang beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gottsched, Tragödie, Frühaufklärung, Poetologie, Wirkungsästhetik, Dichtung, Wirklichkeit, Fehlerkonzept, Bewunderungskonzept, eleos, phobos, katharsis, moralisch-didaktische Funktion, Theaterreform.
Wie wird Lessings Kritik an Gottsched in der Arbeit berücksichtigt?
Die Einleitung beginnt mit Lessings kritischer Einschätzung von Gottscheds Einfluss auf das deutsche Theater. Die Arbeit kontrastiert Lessings negative Sicht mit der neueren Forschung, die Gottscheds Leistungen im Kontext der frühen Aufklärung würdigt.
- Arbeit zitieren
- Roman Shahriari (Autor:in), 2004, Gottsched und die Wirkung der Tragödie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/129671