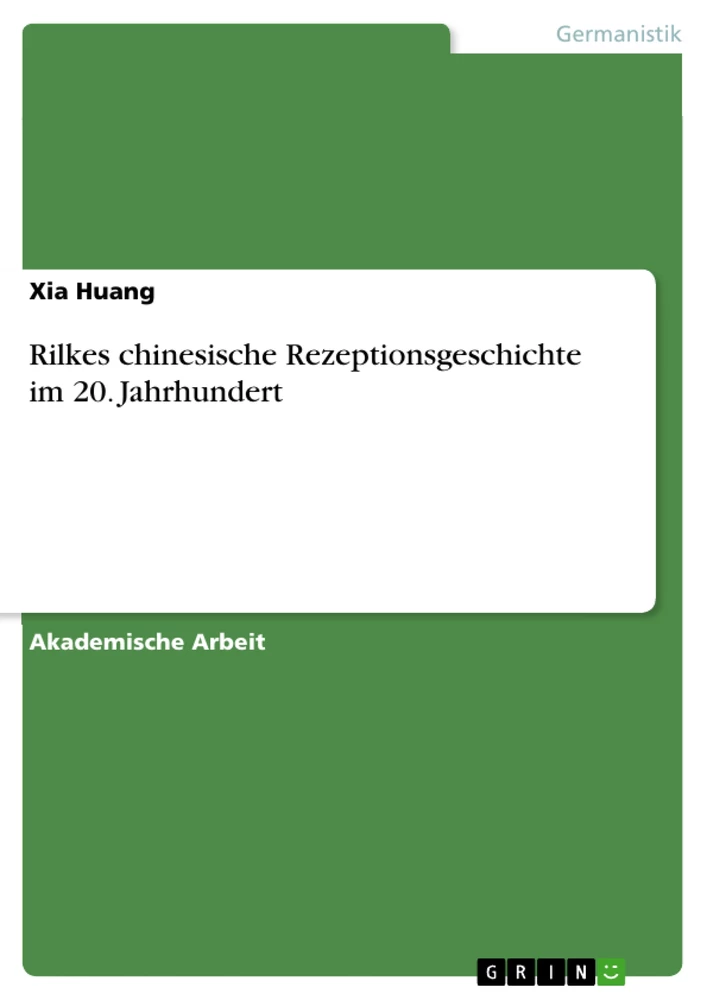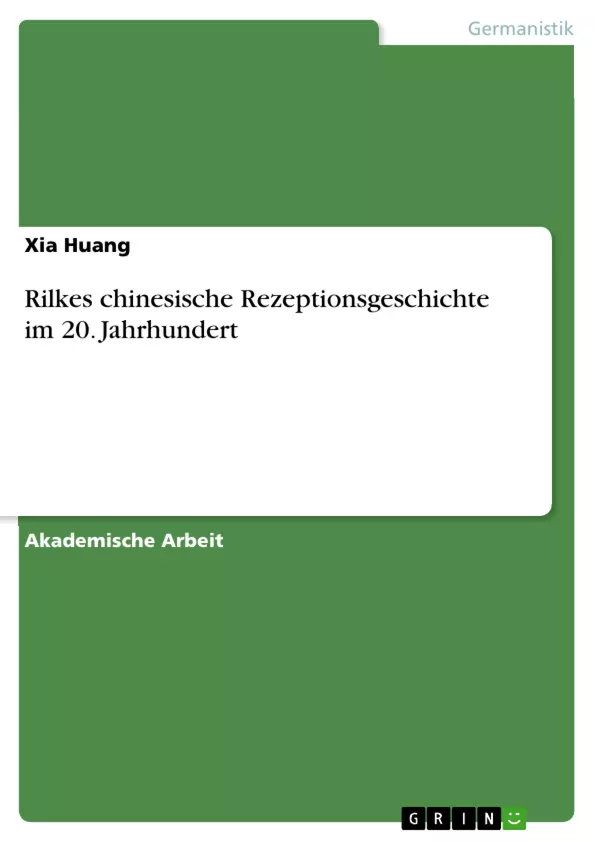In dieser Arbeit geht es um Rilkes chinesische Rezeptionsgeschichte im 20. Jahrhundert. Er wurde in China als der beste deutschsprachige Dichter nach Goethe und Hölderlin angesehen, während Goethe und Hölderlin im Sinne der dichterischen Produktion viel weniger Achtung bei den chinesischen Dichtern genießen. Obwohl die anderen Dichter der ästhetischen Moderne des Abendlandes, zum Beispiel der französische Dichter Charles Baudelaire (1821–1867), der irische Dichter W. B. Yeats (1865–1939), der britische Dichter T. S. Eliot (1888–1965) und W. H Auden (1907–1973) auch eine große Resonanz bei den chinesischen Dichtern gefunden haben, sieht man Rilke in China etwas anders.
Inhaltsverzeichnis
- Rilkes chinesische Rezeptionsgeschichte im 20. Jahrhundert
- Einleitung
- Rilkes Rezeption in China im 20er Jahrhundert
- Die ersten Übersetzungen und Vorstellungen
- Erste Übersetzungen und Vorstellungen in den frühen 1920er Jahren
- Erste Übersetzungen und Vorstellungen in den späten 1920er Jahren
- Rilkes Rezeption in China im 30er Jahrhundert
- Rilkes Rezeption in China im 30er Jahrhundert
- Rilkes Rezeption in China im 30er Jahrhundert
- Rilkes Rezeption in China im 30er Jahrhundert
- Rilkes Rezeption in China im 30er Jahrhundert
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rezeptionsgeschichte des deutschen Dichters Rainer Maria Rilke im chinesischen Sprachraum im 20. Jahrhundert. Sie beleuchtet die ersten Übersetzungen, Vorstellungen und Interpretationen seines Werkes sowie deren Einfluss auf die chinesische Literatur und Kultur.
- Die Entstehung und Entwicklung der Rilke-Rezeption in China
- Der Einfluss Rilkes auf die chinesische Lyrik
- Die Rolle von Übersetzungen in der Vermittlung Rilkes Werkes
- Die Bedeutung des Briefwechsels für die chinesische Leserschaft
- Die Rezeption von Rilkes Werken in verschiedenen literarischen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die ersten sporadischen Vorstellungen und Übersetzungen deutschsprachiger Literatur in China, mit besonderem Fokus auf die frühe Rezeption Rilkes in den 1920er Jahren. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die frühen Übersetzungen, die ersten Bewertungen und die einflussreichen Beiträge zur Etablierung Rilkes als einer bedeutenden literarischen Figur in China.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der Rilke-Rezeption im 30er Jahrhundert. Hier werden die wichtigsten Übertragungen, Interpretationen und kritischen Analysen seines Werkes, die in dieser Zeit entstanden sind, beleuchtet. Die Entwicklung der Rezeption Rilkes in China wird anhand der vielfältigen literarischen und gesellschaftlichen Einflüsse der Epoche analysiert.
Die Arbeit zeichnet ein detailliertes Bild der Rezeptionsgeschichte Rilkes in China und zeigt auf, wie seine Werke über die Jahrzehnte hinweg vom chinesischen Publikum aufgenommen und interpretiert wurden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen deutschsprachige Literatur, chinesische Rezeption, Rainer Maria Rilke, Lyrik, Übersetzungen, Briefwechsel, literarische Kritik, und die Entwicklung der modernen chinesischen Literatur. Der Fokus liegt auf dem Einfluss Rilkes auf die chinesische Dichtung und Kultur im 20. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Stellenwert hat Rainer Maria Rilke in der chinesischen Literatur?
Rilke wird in China oft als der bedeutendste deutschsprachige Dichter nach Goethe und Hölderlin angesehen und hat einen massiven Einfluss auf die moderne chinesische Lyrik ausgeübt.
Wann begannen die ersten Rilke-Übersetzungen in China?
Die erste Rezeptionswelle begann in den 1920er Jahren durch sporadische Vorstellungen und Übersetzungen in literarischen Zeitschriften.
Warum fanden Rilkes Werke in China so großen Anklang?
Seine ästhetische Moderne und die Tiefe seiner Lyrik trafen den Nerv chinesischer Intellektueller, die nach neuen Ausdrucksformen abseits traditioneller Muster suchten.
Welche Rolle spielten seine Briefe für das chinesische Publikum?
Besonders die "Briefe an einen jungen Dichter" waren in China sehr populär, da sie nicht nur literarische, sondern auch lebensphilosophische Orientierung boten.
Wie entwickelte sich die Rezeption in den 1930er Jahren?
In den 30er Jahren vertiefte sich die Auseinandersetzung durch umfangreichere Übertragungen und kritische Analysen, die Rilke fest im chinesischen Bildungskanon verankerten.
- Arbeit zitieren
- Xia Huang (Autor:in), Rilkes chinesische Rezeptionsgeschichte im 20. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1296556