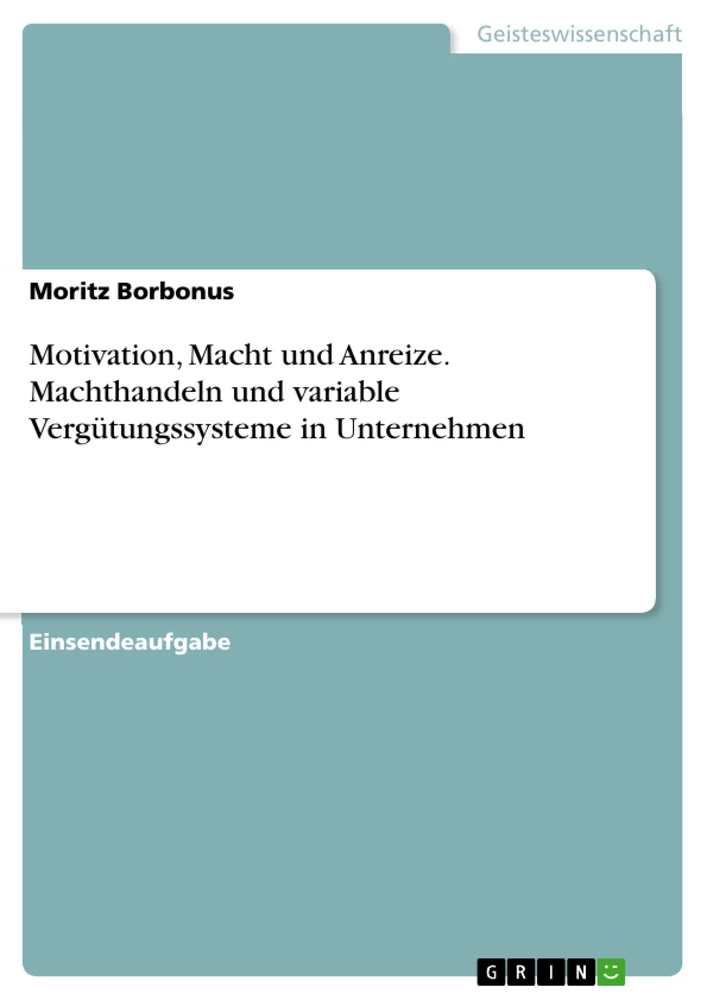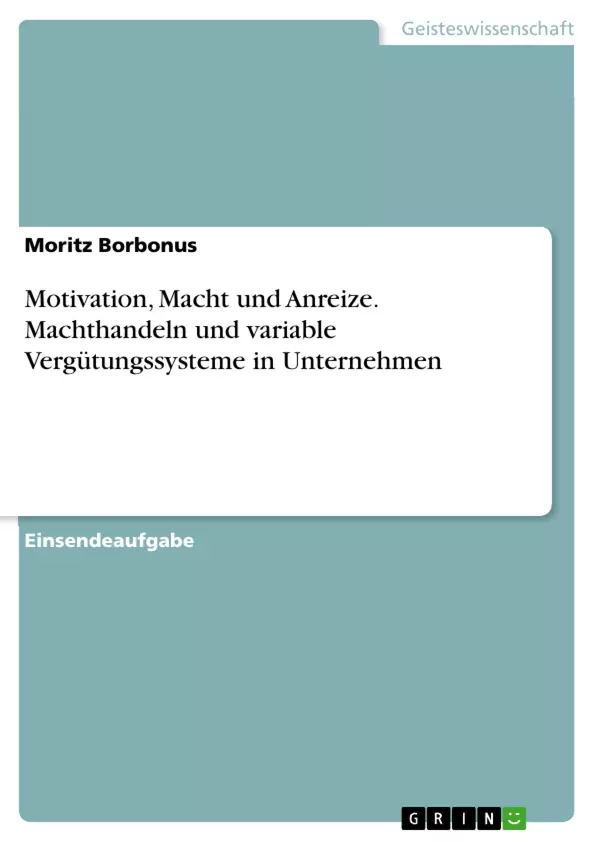Diese Arbeit behandelt die Themen der Motive oder Motivation des Machthandelns und welche Auswirkungen Machtmotive von Führungskräften haben können. Im Anschluss wird das Risikowahlmodell von Atkinson mit dem VIE-Modell nach Voom verglichen. Abschließend werden intrinsische und extrinsische Motivation entschieden, um eine Aussage über die Vor- und Nachteile variabler Vergütungssysteme in Unternehmen treffen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Textteil zu Aufgabe 1
- Was ist Motivation bzw. ein Motiv
- Was ist Macht
- Deskriptives Modell des Machthandelns
- Implikationen eines ausgeprägten Machtmotivs auf den Führungsstil
- Entwicklungsherausforderungen für Führungskräfte mit ausgeprägtem Machtmotiv
- Textteil zu Aufgabe 2
- Abgrenzung des Risikowahl- vom Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Modell
- Risikowahl-Modell in Anwendung
- Textteil zu Aufgabe 3
- Wiederholung Motivation und Anreiz
- Abgrenzung intrinsischer und extrinsischer Motivation
- Spannbreite intrinsisch und extrinsisch motivierten Verhaltens
- Intrinsische und extrinsische Motivation im Führungsprozess
- Definition variabler Vergütungssysteme
- Vor- und Nachteile variabler Vergütungssysteme in Bezug auf intrinsische und extrinische Motivation
- Verbesserung einer fehlenden intrinsischen Motivation bei Arbeitnehmern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik der Motivation, insbesondere im Kontext von Macht und Führung. Sie analysiert, wie sich das Machtmotiv auf das Verhalten von Führungskräften auswirkt und wie sich dies auf die Motivation und Leistung von Mitarbeitern auswirkt. Zudem werden verschiedene Modelle der Motivationstheorie, wie das Risikowahl-Modell und das Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Modell, miteinander verglichen und in Bezug auf ihre Anwendbarkeit im Führungsprozess beleuchtet.
- Das Machtmotiv und dessen Auswirkungen auf Führungsverhalten
- Die Rolle von Motivation in der Führung
- Die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation
- Anwendungen von Motivationsmodellen im Führungsprozess
- Die Bedeutung variabler Vergütungssysteme in Bezug auf intrinsische und extrinsische Motivation
Zusammenfassung der Kapitel
Textteil zu Aufgabe 1
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Motivation und dem Machtmotiv im Speziellen. Es werden die verschiedenen Komponenten der Motivation, wie Bedürfnisse, Ziele und Interessen, erläutert. Zudem wird der Begriff der Macht definiert und dessen Einfluss auf das Verhalten von Führungskräften näher beleuchtet.
Textteil zu Aufgabe 2
Dieser Abschnitt vergleicht das Risikowahl-Modell mit dem Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Modell. Dabei werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Modelle aufgezeigt und deren Anwendbarkeit in der Praxis illustriert.
Textteil zu Aufgabe 3
Im Fokus dieses Kapitels steht die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Es werden die verschiedenen Arten von Motivation, ihre Auswirkungen auf das Verhalten von Mitarbeitern und die Rolle von variablen Vergütungssystemen in diesem Zusammenhang untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet zentrale Themen der Motivationspsychologie, wie das Machtmotiv, intrinsische und extrinsische Motivation sowie die Anwendung von Motivationsmodellen im Führungsprozess. Dabei werden verschiedene Ansätze der Motivationstheorie, wie das Risikowahl-Modell und das Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Modell, betrachtet und deren Implikationen für Führungskräfte untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus der Tätigkeit selbst (Spaß, Interesse), während extrinsische Motivation durch äußere Reize wie Geld oder Lob gesteuert wird.
Wie wirkt sich ein starkes Machtmotiv auf den Führungsstil aus?
Führungskräfte mit hohem Machtmotiv neigen dazu, Einfluss und Kontrolle auszuüben, was je nach Ausprägung motivierend oder demotivierend auf Mitarbeiter wirken kann.
Was besagt das Risikowahlmodell von Atkinson?
Es erklärt die Motivation in Leistungssituationen basierend auf der Erfolgserwartung und dem Anreizwert einer Aufgabe.
Sind variable Vergütungssysteme immer sinnvoll?
Die Arbeit diskutiert Vor- und Nachteile; sie können extrinsische Motivation steigern, aber unter Umständen die intrinsische Motivation verdrängen (Korrumpierungseffekt).
Was ist das VIE-Modell nach Vroom?
Ein Prozessmodell der Motivation, das auf den Faktoren Valenz (Wert), Instrumentalität und Erwartung basiert.
- Arbeit zitieren
- Moritz Borbonus (Autor:in), 2020, Motivation, Macht und Anreize. Machthandeln und variable Vergütungssysteme in Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1291454